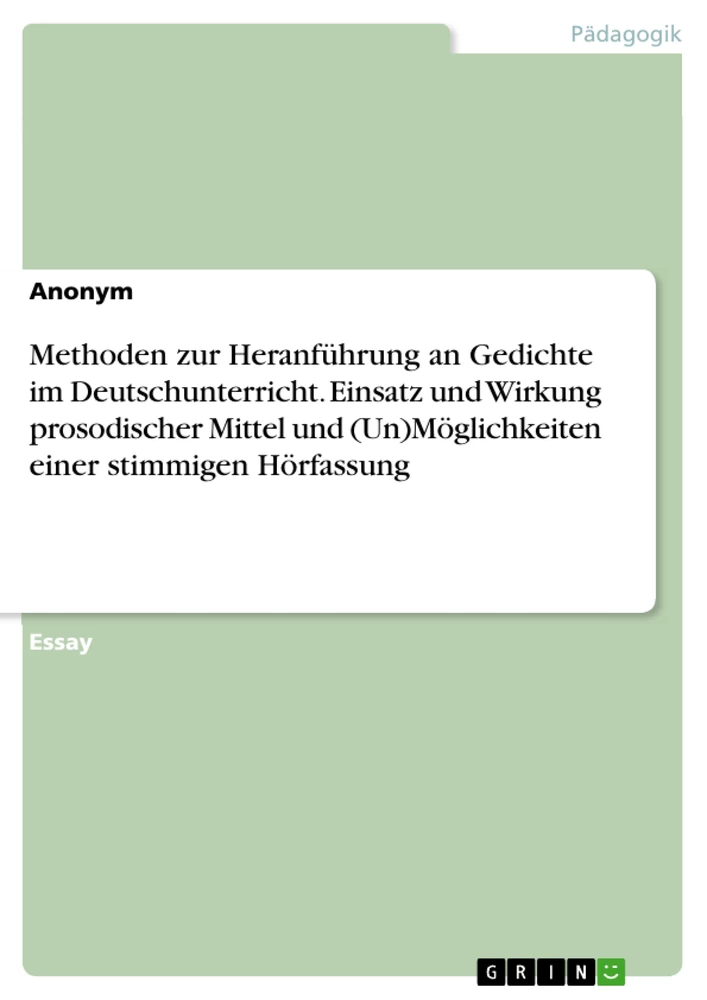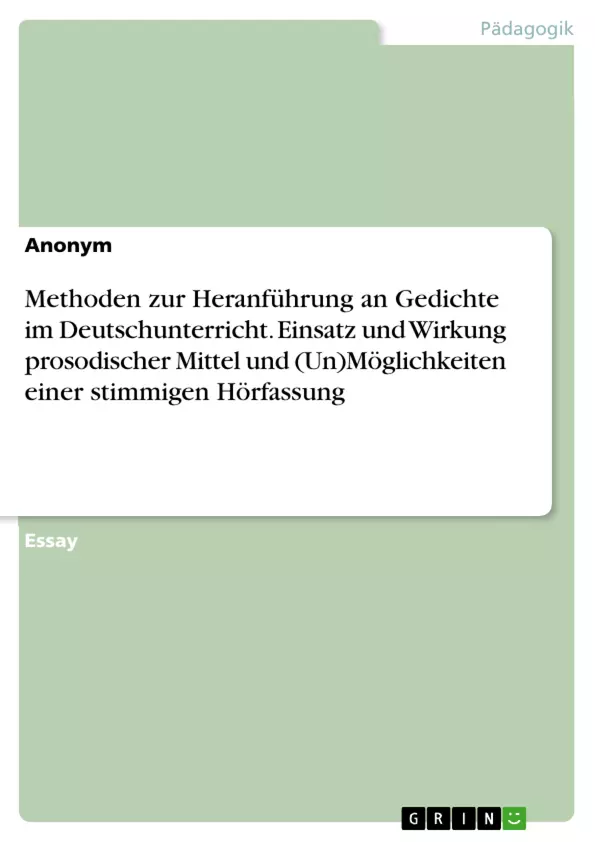Auf die Fragen, wie man einen Sprechausdruck beschreiben kann, wodurch sich eine (un)stimmige Sprechfassung auszeichnet und wie ein kreativer Gedichtzugang im Rahmen eines schüler:innenorientierten Unterrichts gewährleistet werden kann, soll diese Ausarbeitung Antworten finden. Dafür werde ich im Analyseteil meinen eigenen Sprechausdruck hinsichtlich seiner Wirkung untersuchen und herausstellen, inwiefern sich meine persönliche Idee vom Gedicht "Der Mördermarder" akustisch widerspiegelt. Im zweiten Teil werde ich die neuen Erkenntnisse auf das Gedicht "Der Panther" von Rainer Maria Rilke übertragen und mich fragen, welche Aspekte des Sprechausdrucks für eine stimmige Sprechversion förderlich wären. Das letzte Kapitel beinhaltet Überlegungen bezüglich exemplarischer Methoden, die im Unterricht zur Hinführung zum Gedicht förderlich wären. Das Fazit beinhaltet eine kurze Reflexion der Erkenntnisse und schließt mit weiteren praktischen Überlegungen für einen kreativen, schüler:innen-orientierten Lyrikunterricht in der Schule ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der eigenen Sprechfassung – Der Mördermarder
- Zur persönlichen Idee des Gedichts
- Einsatz und Wirkung prosodischer Mittel
- Evaluation und Bewertung der Stimmigkeit
- Transfer auf das Patengedicht - Der Panther
- Zur persönlichen Idee des Gedichts
- (Un)Möglichkeiten einer stimmigen Sprechversion
- Transfer auf die Schule
- Exemplarische Methoden zur Heranführung an Gedichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay setzt sich mit lyrischen Texten auseinander und untersucht den produktiven Umgang mit Gedichten im Rahmen der Didaktik der Mündlichkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der eigenen Sprechfassung, dem Transfer auf ein Patengedicht und der Entwicklung von Methoden zur Heranführung an Gedichte im Schulunterricht.
- Analyse des eigenen Sprechausdrucks im Kontext der Gedichtinterpretation
- Transfer der Erkenntnisse auf ein anderes Gedicht
- Entwicklung von Methoden zur produktiven Auseinandersetzung mit Lyrik im Unterricht
- Bedeutung des Sprechausdrucks für die Gedichtrezeption
- Kreative Heranführung an Gedichte im Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die didaktische Ausrichtung des Essays dar, die sich an der Herangehensweise des Seminars "Didaktik der Mündlichkeit" orientiert. Sie beschreibt die eigene Erfahrung mit dem analytischen Umgang mit Lyrik in der Schulzeit und die durch das Seminar gewonnene Einsicht in den produktiven und kreativen Zugang zu Gedichten. Zudem werden die zentralen Fragestellungen des Essays und die Struktur der Arbeit erläutert.
1.1. Analyse der eigenen Sprechfassung – Der Mördermarder
Der erste Teil des Essays analysiert die eigene Sprechfassung des Gedichts "Der Mördermarder" von Robert Gernhardt. Die persönliche Idee des Gedichts wird anhand von Sprache, Form, lyrischem Ich und Atmosphäre erläutert. Anschließend werden die eingesetzten prosodischen Mittel beschrieben und ihre Wirkung auf die Hörenden untersucht.
1.2. Zur persönlichen Idee des Gedichts
Die persönliche Idee des Gedichts "Der Mördermarder" wird anhand verschiedener Aspekte erläutert, die die Besonderheiten des Textes ausmachen. Es werden Sprache, Form, lyrisches Ich und Atmosphäre beleuchtet.
1.3. Einsatz und Wirkung prosodischer Mittel
Dieser Abschnitt analysiert die markanten Momente der eigenen Sprechfassung in der Hörfassung. Die prosodischen Mittel Tempo, Dynamik, Melodie und Artikulation werden anhand von Müllers Übersicht analysiert. Die Wirkung der Vortragsweise auf die Hörenden wird beschrieben.
1.4. Evaluation und Bewertung der Stimmigkeit
Dieser Teil bewertet die Stimmigkeit der eigenen Sprechfassung im Hinblick auf die intendierte Gedichtidee. Es werden die hörbaren Aspekte des Sprechausdrucks und ihre Wirkung auf die Hörerin beschrieben und analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Essays sind die Analyse des eigenen Sprechausdrucks, die produktive Auseinandersetzung mit Lyrik, die Entwicklung von Methoden zur Heranführung an Gedichte im Unterricht, die Bedeutung des Sprechausdrucks für die Gedichtrezeption, kreative Heranführung an Gedichte im Schulunterricht, Prosodische Mittel, Sprechfassung, "Der Mördermarder", "Der Panther", Robert Gernhardt, Rainer Maria Rilke.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann man einen Sprechausdruck bei Gedichten beschreiben?
Ein Sprechausdruck wird durch prosodische Mittel wie Tempo, Dynamik (Lautstärke), Melodie und Artikulation charakterisiert.
Was macht eine stimmige Hörfassung eines Gedichts aus?
Stimmigkeit bedeutet, dass die akustische Gestaltung (Sprechweise) die beabsichtigte Idee, Atmosphäre und Form des lyrischen Textes widerspiegelt.
Welche Gedichte werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht Robert Gernhardts „Der Mördermarder“ und Rainer Maria Rilkes „Der Panther“ im Hinblick auf ihre stimmliche Umsetzung.
Welche Methoden eignen sich für schülerorientierten Lyrikunterricht?
Die Arbeit schlägt kreative und produktive Zugänge vor, bei denen Schüler selbst Sprechfassungen entwickeln, anstatt Gedichte nur rein analytisch zu behandeln.
Warum ist die Didaktik der Mündlichkeit wichtig für Gedichte?
Sie fördert das Verständnis für die Lautgestalt von Lyrik und ermöglicht den Lernenden einen emotionalen und persönlichen Zugang zum Text.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Methoden zur Heranführung an Gedichte im Deutschunterricht. Einsatz und Wirkung prosodischer Mittel und (Un)Möglichkeiten einer stimmigen Hörfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1304066