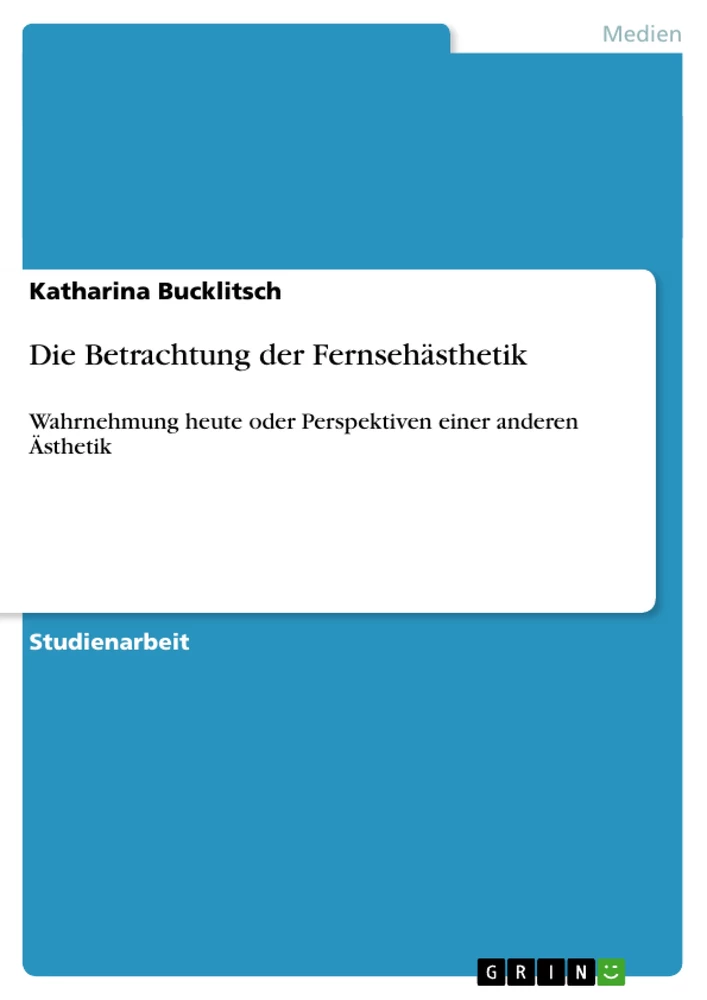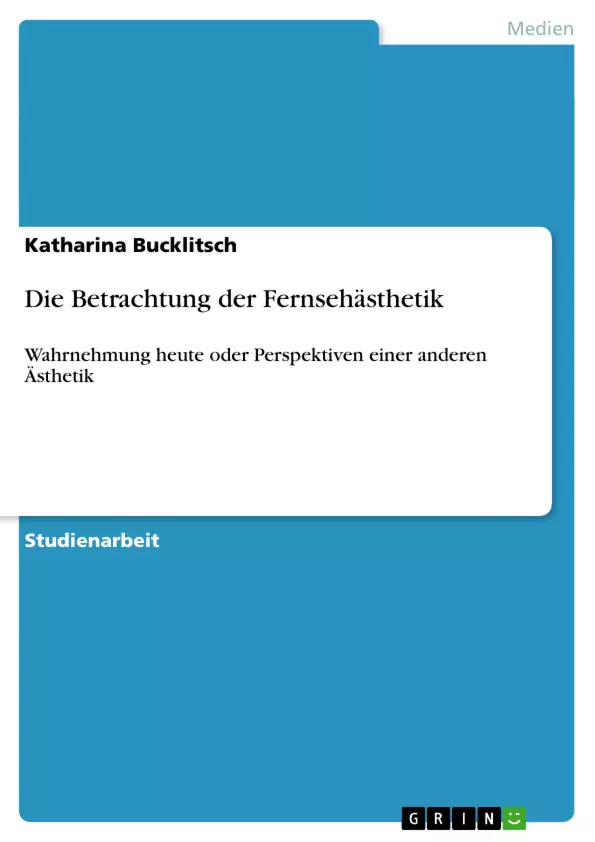„Der Mensch“, schrieb Alfred Kurella, „hat als Resultat seiner jahrtausendelangen tätigen Kulturentwicklung ein ästhetisches Vermögen mitbekommen. Dieses ästhetische Vermögen dient ihm in der Praxis bei der Aneignung der Wirklichkeit, beim Erfassen der Lebenswahrheit, man kann wohl sagen, in starker Weise wie das logische Denken!“
Gegenwärtig gilt es, die Auffassung vom Gegenstand der Ästhetik und ihrer Ausweitung über die bisher untersuchten Bereiche hinaus neu zu durchdenken, da das ursprüngliche griechische Verständnis von Ästhetik als Lehre von der Wahrnehmung ungeeignet scheint, das gesamte Spektrum der Inhalte zusammenzufassen, die in unserer Zeit in diesem Feld bearbeitet werden.
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Ästhetik im ausgehenden 20./ beginnenden 21. Jahrhundert, begründet auf die Geschichte, Entwicklung und Umwandlung der so genannten „Philosophie des Schönen“ bis heute. Allem vorangestellt ist die Frage, ob man noch immer von einer Ästhetik im eigentlichen Sinne sprechen kann bzw. welche Aufgaben diese heute zu erfüllen hat. Da bisher nur selten in den Medienwissenschaften, der Kunstwissenschaft oder der Philosophie die Rede von Ästhetik oder Stil ist, wenn es um das Fernsehen geht, möchte ich an diesem Beispiel die Veränderung des ästhetischen Begriffs belegen. Dabei geht es darum, „einige traditionelle [...] Begriffe der Ästhetik im Blick auf das Fernsehen neu zu denken und zu modifizieren“. Die Aussagen beruhen freilich nicht auf der Behauptung, dass es grundsätzlich (k)eine Ästhetik des Fernsehens gibt, sondern vielmehr findet eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik statt, die Genanntes auch immer wieder in Frage stellt.
2. Ästhetik als „Philosophie des Schönen“
Die Ästhetik als selbstständige Wissenschaft ist im 18. Jahrhundert aus der Philosophie heraus entstanden, begründet auf Baumgarten und Kant. Sie beschreibt die Lehre vom stilvollen Schönen und der Erfahrung des Schönen, im engeren Sinne die Lehre vom Kunstschönen und dessen Erfahrung. Spricht man also vom Ästhetischen, ist nicht selten die Rede von einer anderen Bezeichnung „für die scheinhafte Anwesenheit, für eine auf den Wahrnehmungsvollzug gerichtete Aufmerksamkeit, für eine sinnliche Sinnhaftigkeit und oft schlicht für die Wahrnehmbarkeit einer Sache“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ästhetik als ,,Philosophie des Schönen“
- Übergang von reiner zur angewandten Kunst
- Medienästhetik
- Die Schwierigkeit einer Fernsehästhetik
- a) Massen- vs. Individualmedium – Bildschirm oder Mattscheibe
- b) Fernsehen als kulturelle Ware
- c) Die Sichtbarkeit des Bildes
- d) Videoclips - Verfilmung von Musikstücken
- Ästhetik als Form der Wahrnehmung
- Schlussbetrachtung – Nullmedium Fernsehen?
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern sich der Begriff der Ästhetik auf das Medium Fernsehen anwenden lässt. Sie untersucht die Entwicklung der Ästhetik von der „Philosophie des Schönen“ bis hin zur Medienästhetik und analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Fernsehästhetik ergeben.
- Entwicklung des Begriffs der Ästhetik
- Anwendbarkeit der Ästhetik auf das Fernsehen
- Sichtbarkeit des Bildes im Fernsehen
- Fernsehen als kulturelle Ware
- Fernsehen als Massenmedium
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Fernsehästhetik ein und stellt die zentrale Frage nach der Anwendbarkeit des Begriffs der Ästhetik auf das Fernsehen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Ästhetik und die Herausforderungen, die sich aus der medialen Transformation ergeben.
Das Kapitel „Ästhetik als ..Philosophie des Schönen"“ beleuchtet die Entstehung der Ästhetik als eigenständige Wissenschaft im 18. Jahrhundert und ihre Definition als Lehre vom stilvollen Schönen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die traditionelle Definition der Ästhetik auf die moderne Medienlandschaft übertragen lässt.
Das Kapitel „Übergang von „reiner“ zur „angewandten“ Kunst“ analysiert die Entwicklung der Ästhetik im Kontext der Industrialisierung und der Entstehung neuer Kunstformen wie Film und Fernsehen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie sich die ästhetischen Wertvorstellungen in der Kulturindustrie verändern.
Das Kapitel „Medienästhetik“ befasst sich mit der Frage, wie sich die Ästhetik auf die Medienlandschaft anwenden lässt. Es werden die spezifischen Herausforderungen der Medienästhetik beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf die Interaktion von Bild und Ton, die Massenkommunikation und die kulturelle Bedeutung von Medien.
Das Kapitel „Die Schwierigkeit einer Fernsehästhetik“ untersucht die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Fernsehästhetik ergeben. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie die Unterscheidung zwischen Massen- und Individualmedium, die Rolle des Fernsehens als kulturelle Ware und die Sichtbarkeit des Bildes im Fernsehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fernsehästhetik, die Medienästhetik, die Philosophie des Schönen, die Entwicklung der Ästhetik, die Kulturindustrie, das Massenmedium, die Sichtbarkeit des Bildes, die kulturelle Ware und die Herausforderung der Fernsehästhetik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Fernsehästhetik?
Fernsehästhetik befasst sich mit der visuellen und auditiven Gestaltung des Mediums Fernsehen und der Frage, wie Wahrnehmung und Stil im Kontext von Massenmedien definiert werden.
Wie hat sich der Begriff der Ästhetik historisch entwickelt?
Ursprünglich als „Philosophie des Schönen“ im 18. Jahrhundert (Baumgarten, Kant) entstanden, wandelte sich der Begriff hin zu einer umfassenden Lehre der Wahrnehmung und Medienästhetik.
Ist das Fernsehen ein Massen- oder Individualmedium?
Die Arbeit untersucht diese Schwierigkeit: Während Fernsehen als Massenmedium konzipiert ist, findet die Rezeption oft im privaten, individuellen Raum statt, was die ästhetische Bewertung beeinflusst.
Warum wird Fernsehen als "kulturelle Ware" bezeichnet?
Im Sinne der Kulturindustrie wird Fernsehen oft als industriell produziertes Gut betrachtet, bei dem ökonomische Interessen die ästhetische Form und den Inhalt mitbestimmen.
Welchen Einfluss haben Videoclips auf die Fernsehästhetik?
Videoclips stellen eine Verfilmung von Musikstücken dar und haben neue visuelle Stilelemente und schnelle Schnittfolgen etabliert, die die allgemeine Bildsprache des Fernsehens prägten.
Kann man beim Fernsehen von einer "Ästhetik im eigentlichen Sinne" sprechen?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit dieser Frage auseinander und prüft, ob traditionelle Begriffe der Kunstästhetik auf ein technisches Massenmedium wie das Fernsehen übertragbar sind.
- Quote paper
- Katharina Bucklitsch (Author), 2007, Die Betrachtung der Fernsehästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130601