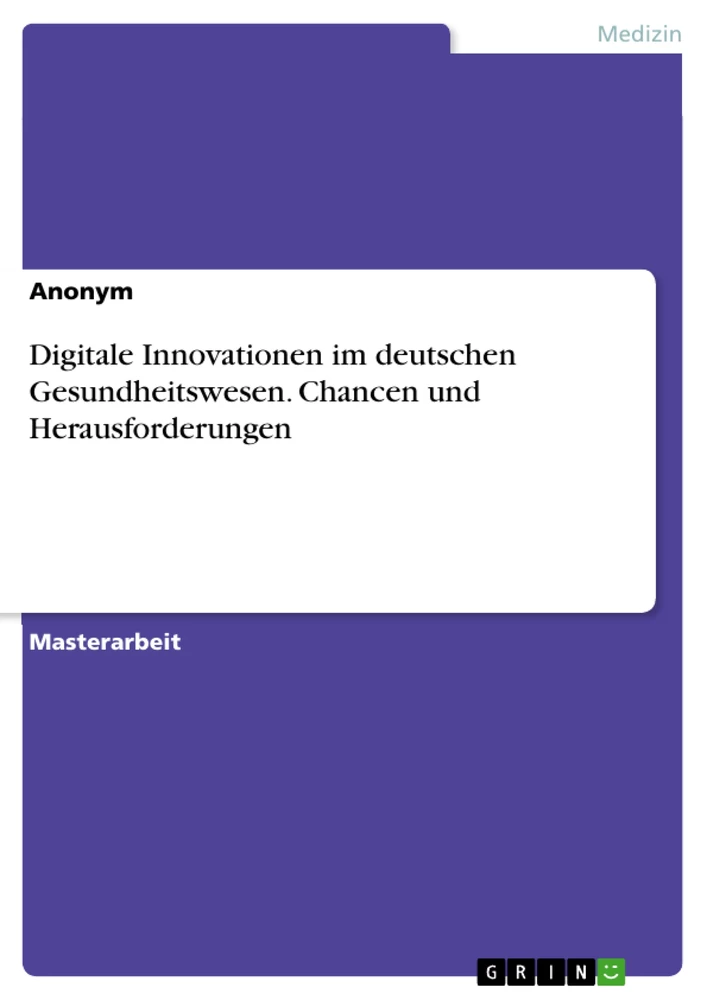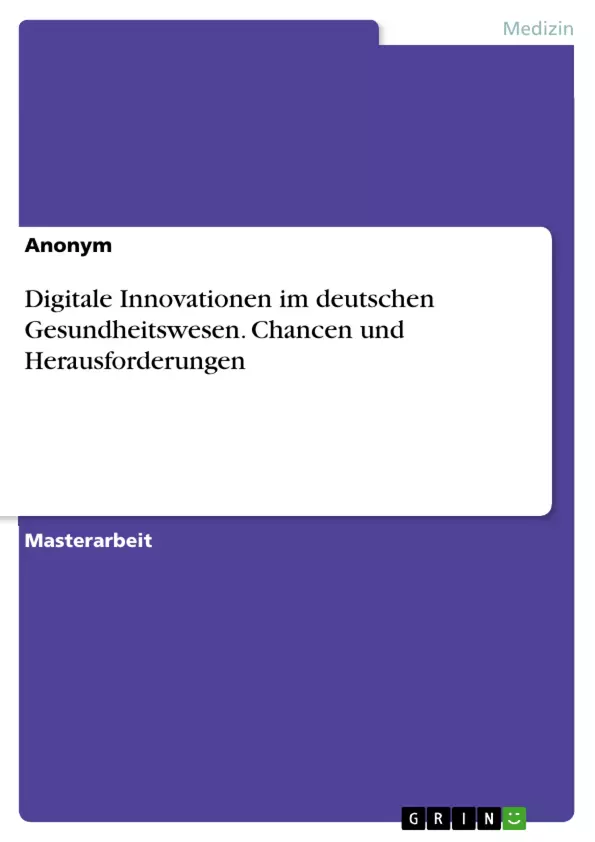Ziel dieser Arbeit ist es die Chancen und Herausforderungen von Anbietern digitaler Gesundheitsinnovationen im System der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) herauszuarbeiten. Am Beispiel der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden besondere Anforderungen des GKV-Systems qualitativ herausgearbeitet. Darüber hinaus werden explorativ spezifische Faktoren eruiert. In der Fallstudie werden die gewählten Fälle zugelassener DiGA auf die Erfüllung der Anforderungen überprüft. An Beispielen erläutert die Verfasserin die mögliche Bewältigung der Herausforderungen. Abschließend werden Empfehlungen für DiGA-Hersteller herausgearbeitet.
Mit dem digitalen Versorgungsgesetz (DVG) wurde die Zulassung von digitalen Gesundheitsinnovationen in die gesetzliche Krankenversicherung erleichtert. Zwar gibt es eine große Nachfrage in den App-Stores zu frei zugänglichen Gesundheits-Apps. Diese Nachfrage spiegelt sich jedoch nicht im GKV-System wider. Anhand der Verordnungsdaten aus dem DiGA-Bericht des GKV-Spitzenverbands, sowie des DIGA-Reports 2022 von der Techniker Krankenkasse (TK) lässt sich ablesen, dass es bisher kaum Ausbreitung von DiGA in der GKV gibt.
Es liegen zur Annahme und Akzeptanz von digitalen Innovationen bereits viele Forschungsergebnisse und Modelle zur Erklärung individueller Entscheidungen zur Übernahme und Nutzung einer Innovation durch Individuen im privaten Markt vor. Anbieter von digitalen Gesundheitsinnovationen müssen jedoch für die Annahme ihrer Produkte und Dienstleistungen im GKV-System ein wesentlich tieferes Verständnis über Entscheidungsvorgänge der beteiligten Stakeholder erarbeiten, da Entscheidungsprozesse durch mehrere Beteiligte beeinflusst werden können. Diese systemische Betrachtung ist bisher vor allem in angloamerikanischen Gesundheitssystemen angewandt worden. In Deutschland ist diese Forschung weniger verbreitet. Am Beispiel der jahrelangen Hindernisse bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte erkennt man jedoch, dass allein die Sichtweise auf das Produkt und den einzelnen Kunden nicht ausreichend ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Struktur der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Innovationsforschung zu Adoption, Diffusion und Akzeptanz
- Definition Innovation
- Rogers Diffusionstheorie
- Technologieakzeptanzforschung
- Einfluss des Change Agents auf den Innovations-Entscheidungs-Prozess
- Stand der Forschung von Gesundheitsinnovationen
- Systemische Betrachtung
- Implementierungsforschung
- Consolidated Framework for Implementation Research
- Der Markt der gesetzlichen Krankenversicherung
- Innovationsförderung zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Gemeinsame und divergente Ziele der Stakeholder in der GKV
- Möglichkeiten und Grenzen von Kooperationen
- Digitale Gesundheitsanwendungen
- Methodik
- Zielsetzung
- Methodenwahl
- Untersuchendes Datenmaterial
- Dokumentenanalyse
- Fallstudie Digitale Gesundheitsanwendungen
- Rahmenstruktur zur Kategorienbildung
- Datenauswertung
- Stellungnahmen
- Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer
- Pressemitteilung DGIM vom 22.03.2022
- Bericht des GKV-Spitzenverbandes
- Pressemitteilung des Spitzenverband Digitale Versorgung vom 15.03.2022
- Diskussion der Kritikpunkte und Lösungsvorschläge
- Preise
- Zusatznutzen
- Evidenz
- Innovationsgrad
- Prozess der Einbindung in den Behandlungsalltag
- Digital Readiness im deutschen Gesundheitssystem
- Prozess des Fast-Tracks
- Fallstudie Digitale Gesundheitsanwendungen
- Analyse alternativer Zugangswege der digitalen Versorgung in die GKV
- Analyse der Mental Health Apps
- DIGA im Indikationsgebiet Psyche
- DIGA des Unternehmens GAIA AG
- DIGA des Unternehmens HelloBetter
- DIGA des Unternehmens Selfapy
- Invirto
- somnio
- Novego
- Mindable
- Nichtraucherhelden
- Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Mental Health Apps
- Analyse der Onkologie Apps
- Beurteilung und Interpretation
- Limitationen
- Datenerhebung
- Kritische Auseinandersetzung der Methodendurchführung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert Chancen und Herausforderungen von digitalen Innovationen im deutschen Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DIGA). Die Arbeit befasst sich mit der Einführung neuer Technologien im Gesundheitswesen und untersucht, wie diese die Versorgung von Patientinnen und Patienten verbessern können.
- Die Adoption und Diffusion von Innovationen im Gesundheitswesen
- Die Akzeptanz von DIGA durch Patientinnen und Patienten sowie Fachpersonal
- Die Rolle von Stakeholdern im Prozess der Gesundheitsinnovation
- Die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit und Qualität bei der Einführung von DIGA
- Die Herausforderungen und Chancen der Implementierung von DIGA im deutschen Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar und erläutert die Struktur der Arbeit.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Innovationsforschung, insbesondere zu Adoption, Diffusion und Akzeptanz. Es werden Definitionen, Theorien und Modelle vorgestellt, die für die Analyse von digitalen Innovationen im Gesundheitswesen relevant sind.
- Der Markt der gesetzlichen Krankenversicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Markt der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und den Herausforderungen der Innovationsförderung in diesem System. Es werden die Ziele und Interessen der verschiedenen Stakeholder beleuchtet, sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Kooperationen.
- Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die Methodenwahl und das untersuchte Datenmaterial. Es wird die Dokumentenanalyse und die Fallstudie zu Digitalen Gesundheitsanwendungen näher erläutert.
- Stellungnahmen: Dieses Kapitel präsentiert Stellungnahmen verschiedener Akteure im Gesundheitswesen zu den Chancen und Herausforderungen von DIGA.
- Diskussion der Kritikpunkte und Lösungsvorschläge: Dieses Kapitel diskutiert kritische Punkte und Lösungsvorschläge im Zusammenhang mit der Einführung von DIGA im deutschen Gesundheitswesen. Es werden Aspekte wie Preise, Zusatznutzen, Evidenz, Innovationsgrad, Einbindung in den Behandlungsalltag und die digitale Bereitschaft des Gesundheitssystems betrachtet.
- Fallstudie Digitale Gesundheitsanwendungen: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie zu Digitalen Gesundheitsanwendungen, wobei verschiedene Anwendungsbereiche, wie Mental Health Apps und Onkologie Apps, analysiert werden.
- Limitationen: Dieses Kapitel diskutiert die Limitationen der Arbeit, insbesondere in Bezug auf die Datenerhebung und die Methodendurchführung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Digitale Gesundheitsanwendungen, Innovationsforschung, Adoption, Diffusion, Akzeptanz, Gesundheitswesen, gesetzliche Krankenversicherung, Stakeholder, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Implementierung, Methodologie, Dokumentenanalyse, Fallstudie, Kritikpunkte, Lösungsvorschläge, Digital Readiness.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)?
DiGA sind „Apps auf Rezept“, die durch das Digitale Versorgungsgesetz (DVG) als Teil der vertragsärztlichen Versorgung in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen wurden.
Warum ist die Verbreitung von DiGA im GKV-System noch gering?
Herausforderungen liegen in der Akzeptanz durch Fachpersonal, komplexen Entscheidungsvorgängen der Stakeholder und dem Nachweis eines medizinischen Zusatznutzens.
Welche medizinischen Bereiche werden in der Fallstudie untersucht?
Die Studie analysiert insbesondere DiGA aus den Bereichen Mental Health (Psychische Erkrankungen) und Onkologie.
Was bedeutet „Fast-Track“ bei DiGA?
Der Fast-Track ist ein beschleunigtes Zulassungsverfahren beim BfArM, das digitale Innovationen schneller in die Erstattung der Krankenkassen bringen soll.
Was versteht man unter „Digital Readiness“ im Gesundheitswesen?
Es beschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit des Gesundheitssystems und seiner Akteure, digitale Innovationen in den Behandlungsalltag zu integrieren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Digitale Innovationen im deutschen Gesundheitswesen. Chancen und Herausforderungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306131