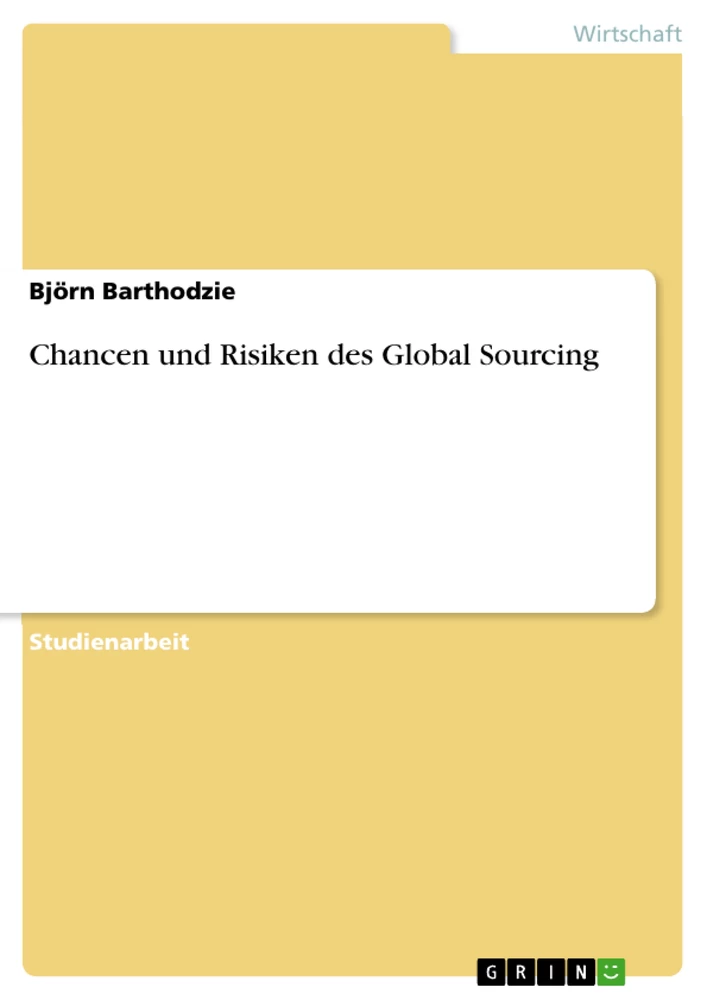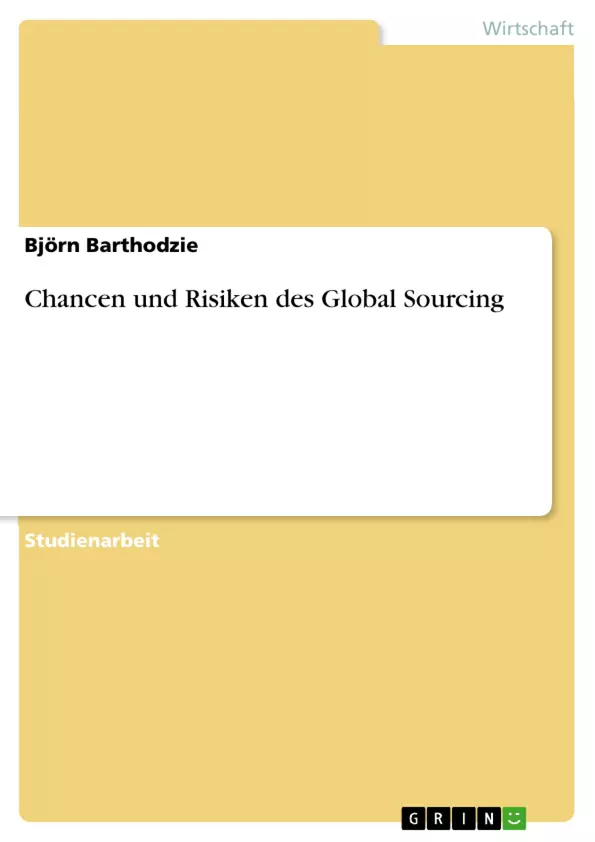Die Covid-19 Pandemie hat das gesellschaftliche Leben verändert. Doch neben der Maskenpflicht und Ausgangssperren hat es auch die Weltwirtschaft getroffen. Mit Beginn der Pandemie Anfang 2020 stand die Weltwirtschaft für kurze Zeit still. In der Volksrepublik China waren Fabriken beispielsweise wochenlang nicht in Betrieb. Die im Sommer 2020 steigende Nachfrage nach Konsumgütern sorgte für eine Disruption der Lieferketten.
Als Katalysator folgte die Havarie der Ever Given im März 2021. Doch vor der Pandemie, im Zuge der Liberalisierung des Welthandels und des steigenden Konkurrenzkampfes, entschieden sich neben den Konzernen viele mittelständische Unternehmen für eine globale Beschaffungsstrategie. Inwiefern hat die Pandemie die Chancen und Risiken der Global Sourcing Strategie verändert und inwiefern erfolgt hierdurch ein Strategiewechsel des deutschen Mittelstandes?
Zunächst werden die Begrifflichkeiten Mittelstand und Global Sourcing zur besseren Einordnung definiert. Im Hauptteil werden die Chancen und Risiken der Global Sourcing Strategie analysiert, welche eine zentrale Rolle spielen und sich in der Pandemie verändert haben. Nach der Erläuterung der grundlegenden Chancen und Risiken folgt die jeweilige Veränderung in der Pandemie. Es folgen die Voraussetzungen zur Nutzung der Global Sourcing Strategie und die Analyse der neuen Strategien für den deutschen Mittelstand. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und es wird die im ersten Kapitel gestellte Forschungsfrage abschließend bewertet. Zuletzt erfolgt ein Ausblick für die kommenden Jahre.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 2.1 Mittelstand
- 2.2 Global Sourcing
- 3. Chancen
- 3.1.1 Kostenreduktion
- 3.1.2 Kostenreduktion in der Pandemie
- 3.2.1 Risikodiversifizierung
- 3.2.2 Risikodiversifizierung in der Pandemie
- 4. Risiken
- 4.1.1 Logistische Risiken
- 4.1.2 Logistische Risiken in der Covid 19 Pandemie
- 4.2.1 Politische Risiken
- 4.2.2 Politische Risiken in der Pandemie
- 5. Voraussetzungen an die Nutzung der Global Sourcing Strategie
- 6. Analyse Mittelstand
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Chancen und Risiken von Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand. Die Arbeit analysiert, inwiefern sich die Chancen und Risiken durch die Pandemie verändert haben und ob dies zu einem Strategiewechsel geführt hat.
- Definition von Mittelstand und Global Sourcing
- Chancen von Global Sourcing (Kostenreduktion, Risikodiversifizierung)
- Risiken von Global Sourcing (logistische und politische Risiken)
- Auswirkungen der Pandemie auf Chancen und Risiken
- Anpassung der Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Lieferketten. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Veränderungen der Chancen und Risiken von Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand und die Struktur der Arbeit vor.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Mittelstand" und "Global Sourcing". Es differenziert zwischen quantitativen und qualitativen Merkmalen zur Definition des Mittelstandes, basierend auf Kriterien wie Mitarbeiterzahl und Umsatz, und verweist auf verschiedene Definitionen von Institutionen wie dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) und der Europäischen Kommission. Die Definition von Global Sourcing wird ebenfalls erläutert und eingegrenzt, um ein klares Verständnis des Untersuchungsgegenstandes zu schaffen.
3. Chancen: Dieses Kapitel analysiert die Chancen von Global Sourcing-Strategien. Es konzentriert sich auf die Kostenreduktion durch die Auslagerung von Produktions- oder Dienstleistungsprozessen in Länder mit niedrigeren Lohnkosten und die Risikodiversifizierung durch die Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Produktionsstandorten. Die Auswirkungen der Pandemie auf diese Chancen werden im Detail untersucht, wobei u.a. die veränderten Lohnkosten und die Unterbrechungen der Lieferketten berücksichtigt werden.
4. Risiken: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Risiken von Global Sourcing, insbesondere logistischen Risiken wie Lieferengpässen und Transportproblemen, sowie politischen Risiken wie Handelsschranken und geopolitische Instabilität. Die Arbeit analysiert, wie die Covid-19 Pandemie diese Risiken verschärft hat, zum Beispiel durch die Schließung von Fabriken, den Suezkanal-Zwischenfall und die globalen Lieferkettenprobleme. Die Folgen dieser verschärften Risiken für Unternehmen werden detailliert untersucht.
5. Voraussetzungen an die Nutzung der Global Sourcing Strategie: Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung einer Global Sourcing Strategie. Es analysiert kritische Faktoren, die Unternehmen berücksichtigen müssen, um die Chancen zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Dies umfasst u.a. die Auswahl geeigneter Lieferanten, die Risikomanagement-Strategien und die Berücksichtigung von ethischen und sozialen Aspekten.
6. Analyse Mittelstand: Dieses Kapitel untersucht die Anpassungen der Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand im Lichte der Pandemie. Es analysiert, wie mittelständische Unternehmen auf die Herausforderungen reagiert haben und welche Strategien sie zukünftig verfolgen. Die Ergebnisse könnten z.B. zeigen, ob Unternehmen ihre Lieferketten diversifiziert, die regionale Beschaffung ausgebaut oder auf neue Technologien gesetzt haben.
Schlüsselwörter
Global Sourcing, Mittelstand, Covid-19 Pandemie, Lieferketten, Risikodiversifizierung, Kostenreduktion, logistische Risiken, politische Risiken, Strategiewechsel, deutsche Wirtschaft.
FAQ: Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Chancen und Risiken von Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand. Sie analysiert, wie sich die Pandemie auf diese Chancen und Risiken ausgewirkt hat und ob dies zu einem Strategiewechsel geführt hat.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Mittelstand und Global Sourcing, die Chancen von Global Sourcing (Kostenreduktion, Risikodiversifizierung), die Risiken von Global Sourcing (logistische und politische Risiken), die Auswirkungen der Pandemie auf Chancen und Risiken und die Anpassung der Global Sourcing Strategien im deutschen Mittelstand.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung (Mittelstand und Global Sourcing), Chancen von Global Sourcing, Risiken von Global Sourcing, Voraussetzungen für die Nutzung von Global Sourcing Strategien, Analyse des Mittelstandes und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird unter "Mittelstand" verstanden?
Die Arbeit definiert den Begriff "Mittelstand" und differenziert zwischen quantitativen und qualitativen Merkmalen. Es werden verschiedene Definitionen von Institutionen wie dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) und der Europäischen Kommission berücksichtigt.
Was wird unter "Global Sourcing" verstanden?
Der Begriff "Global Sourcing" wird klar definiert und eingegrenzt, um ein eindeutiges Verständnis des Untersuchungsgegenstandes zu gewährleisten.
Welche Chancen bietet Global Sourcing?
Die Arbeit analysiert die Chancen von Global Sourcing, insbesondere die Kostenreduktion durch Auslagerung in Länder mit niedrigeren Lohnkosten und die Risikodiversifizierung durch die Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten.
Wie hat die Pandemie die Chancen von Global Sourcing beeinflusst?
Die Arbeit untersucht detailliert, wie die Pandemie die Chancen von Global Sourcing verändert hat, z.B. durch veränderte Lohnkosten und Unterbrechungen der Lieferketten.
Welche Risiken birgt Global Sourcing?
Die Arbeit konzentriert sich auf logistische Risiken (Lieferengpässe, Transportprobleme) und politische Risiken (Handelsschranken, geopolitische Instabilität).
Wie hat die Pandemie die Risiken von Global Sourcing verschärft?
Die Arbeit analysiert, wie die Covid-19 Pandemie die Risiken von Global Sourcing verschärft hat, z.B. durch Fabrikschließungen, den Suezkanal-Zwischenfall und globale Lieferkettenprobleme.
Welche Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Global Sourcing Strategie notwendig?
Die Arbeit beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung einer Global Sourcing Strategie, einschließlich der Auswahl geeigneter Lieferanten, Risikomanagement-Strategien und ethischer und sozialer Aspekte.
Wie haben mittelständische Unternehmen auf die Pandemie reagiert?
Die Arbeit analysiert, wie mittelständische Unternehmen auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert haben und welche Strategien sie zukünftig verfolgen (z.B. Diversifizierung der Lieferketten, Ausbau der regionalen Beschaffung, Einsatz neuer Technologien).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Global Sourcing, Mittelstand, Covid-19 Pandemie, Lieferketten, Risikodiversifizierung, Kostenreduktion, logistische Risiken, politische Risiken, Strategiewechsel, deutsche Wirtschaft.
- Arbeit zitieren
- Björn Barthodzie (Autor:in), 2022, Chancen und Risiken des Global Sourcing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306534