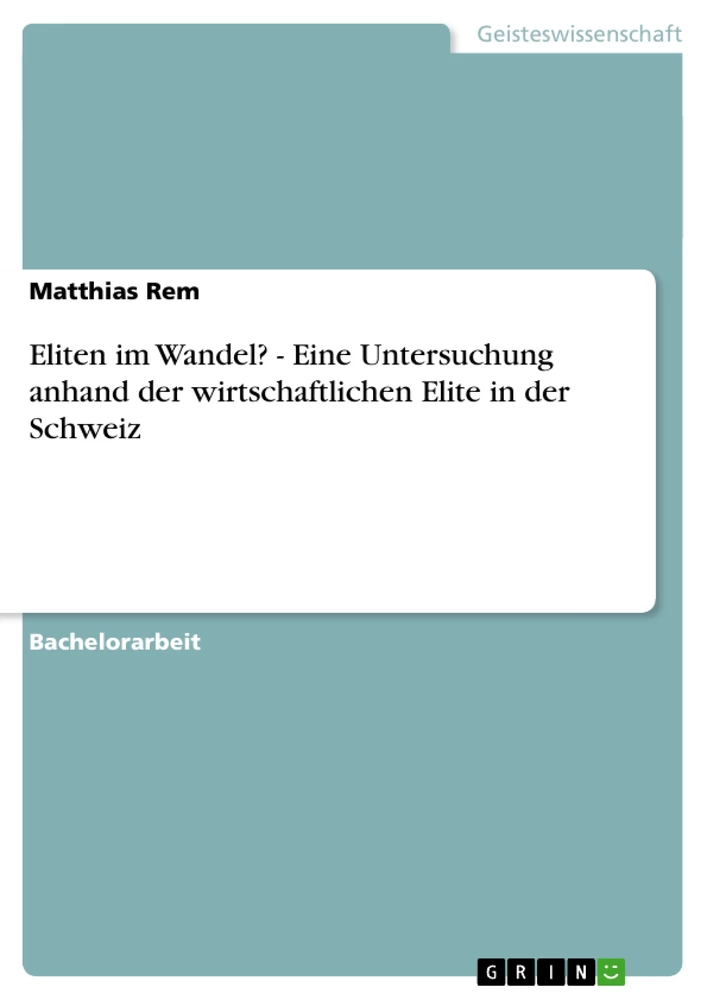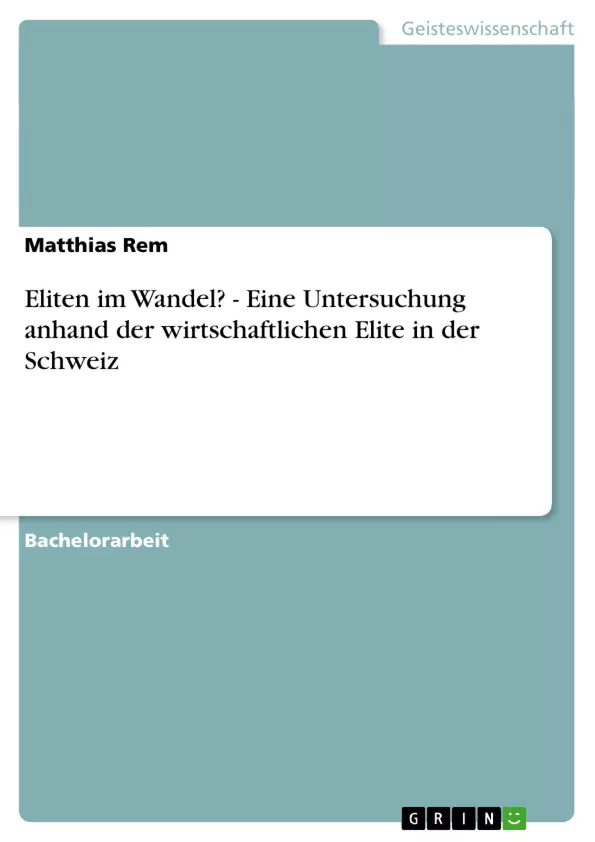„«Geld- und machtgeile Manager», urteilt die Baslerin Margrit Voegelin und lässt
ihrem Ärger über diese «Bosse» in den Leserbriefspalten des «Blicks» freien Lauf;
«das Verbrechen hält Einzug in der Chefetage», meint gar Leserbriefschreiber
Christian Rickenbacher im Wirtschaftsblatt «Cash», und «korrupte
Verwaltungsräte» mit exorbitanter Entlöhnung von Topmanagern einen
«pseudolegalen Anstrich»“ (Lüchinger 2005). Gerade heute steht die „Elite“ erneut
am Pranger. Im Jahr 2008 wird die Welt von einer globalen Finanzkrise getroffen,
welche auch die Schweiz nicht verschont. Die Aktienkurse der Grossbanken UBS
und CS sinken in den Keller. Da die Wirtschaft der Schweiz und die Bevölkerung
von diesen Banken abhängig sind, versucht die Schweizer Regierung die UBS mit
finanzieller Unterstützung in Höhe von 60 Milliarden zu retten. Anfang des Jahres
2009 wird bekannt, dass die UBS dennoch sieben Milliarden an Boni auszahlen will,
was zu breitem Unmut führt. Noch nie in der Nachkriegsgeschichte waren die
ökonomischen Eliten stärker in der Kritik als heutzutage.
Dabei stellt sich die Frage, wer in den Chefetagen sitzt und wie diese Personen jene
Positionen erlangt haben. In einem demokratischen Land wie der Schweiz existiert
die Schulpflicht für alle Kinder. Dabei findet idealerweise eine Selektion nach
Leistung statt. Die schulisch begabten Kinder besuchen das Gymnasium, schliessen
ein Studium ab und bekommen durch die hohe Bildung eine gut bezahlte
Arbeitsstelle. Schlechtere Schüler werden durch die Selektion gefördert und nicht
überfordert. Es herrscht der Gedanke der Gleichheit bei Geburt und der Selektion
nach Leistung. Dadurch sollen die Auszubildenden ihren Fähigkeiten entsprechend
optimal gefördert werden. Leider hat sich bereits in den 1960er Jahren gezeigt, dass
dies nicht der Fall ist. Kinder aus der Oberschicht hatten die Möglichkeiten ein
Studium abzuschliessen und durch die Beziehungen des Elternhauses und deren
Kapital war der Zugang zur ökonomischen Elite für sie offen. Kinder aus der
Unterschicht dagegen konnten schulisch noch so begabt sein, sie hatten alleine aus finanziellen Gründen schlechtere Voraussetzungen eine gute Bildung zu geniessen.
Diese fehlende Bildung und viele andere Faktoren wie zum Beispiel das Geschlecht
verschlossen den Zugang zur Elite. Die Geschichte hat bereits oft die menschliche
Schwäche und Machtgier der führenden Persönlichkeiten gezeigt[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eliten und Elitensoziologie
- Definition Elite
- Die Elitensoziologie
- Die historischen Strömungen
- Die klassische Elitensoziologie
- Niccolò Machiavelli
- Vilfredo Pareto
- Gemeinsamkeiten der Klassiker
- Funktionseliten
- Kritische Elitensoziologie
- Die aktuellen Ansätze der Elitensoziologie
- Pluralistisch-demokratische Ansätze
- Konzept der Machtelite
- Das neue Elite-Paradigma
- Einordnung der aktuellen Strömungen
- Operationalisierung der Eliten
- Das Untersuchungsfeld und Probleme
- Die Schweiz als Untersuchungsfeld
- Das Problem der Zeitspanne
- Fehlende empirische Daten für die Vergangenheit
- Bourdieu und die Chancenungleichheit
- Indikatoren anhand von Bourdieu
- Die drei Kapitalarten
- Das ökonomische Kapital
- Operationalisierung des ökonomischen Kapitals
- Das kulturelle Kapital
- Das objektivierte Kulturkapital
- Das inkorporierte Kulturkapital
- Das institutionalisierte Kulturkapital
- Operationalisierung des kulturellen Kapitals
- Das soziale Kapital
- Operationalisierung des sozialen Kapitals
- Konvertierbarkeit der Kapitalarten
- Der Habitus
- Operationalisierung des Habitus
- Geschlecht
- Empirische Untersuchung der Eliten
- Eliten in den 1960er
- Bildung
- Netzwerke
- Soziale Herkunft
- Geschlecht
- Merkmale der ökonomischen Elite in den 1960er
- Aktuelle wirtschaftliche Elite in der Schweiz
- Bildung
- Netzwerke
- Die Swiss American Chamber of Commerce
- Soziale Herkunft
- Bildung und Herkunft
- Geschlecht
- Das Zusammenspiel der Indikatoren
- Vergleich
- Bildung
- Netzwerke
- Soziale Herkunft
- Geschlecht
- Schlussfolgerung
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Die Entwicklung der wirtschaftlichen Elite in der Schweiz
- Der Einfluss von Bildung, Netzwerken, sozialer Herkunft und Geschlecht auf den Zugang zur Elite
- Die Rolle von Kapitalarten und Habitus in der Elitenbildung
- Die Frage nach der Offenheit oder Geschlossenheit der Elite
- Die Bedeutung von gesellschaftlichen Veränderungen für die Zusammensetzung der Elite
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob sich die wirtschaftliche Elite in der Schweiz im Wandel befindet. Die Arbeit analysiert die Zusammensetzung der Elite in den 1960er Jahren und vergleicht sie mit der heutigen Elite. Dabei werden die Indikatoren Bildung, Netzwerke, soziale Herkunft und Geschlecht herangezogen, um die Veränderungen in der Zusammensetzung der Elite aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik vor und führt in die Forschungsfrage ein. Sie beleuchtet die Kritik an der Elite im Kontext der globalen Finanzkrise und stellt die Frage nach der Zusammensetzung der Elite in der Schweiz. Die Einleitung skizziert die Forschungsmethodik und die Struktur der Arbeit.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Elite und der Elitensoziologie. Es werden verschiedene Definitionen der Elite vorgestellt und die historischen Strömungen der Elitensoziologie beleuchtet. Das Kapitel analysiert die klassischen Elitensoziologen wie Machiavelli und Pareto sowie die Funktionseliten und die kritische Elitensoziologie. Es werden auch die aktuellen Ansätze der Elitensoziologie, wie der pluralistisch-demokratische Ansatz, das Konzept der Machtelite und das neue Elite-Paradigma, vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Operationalisierung der Eliten. Es werden die Herausforderungen der Untersuchung der Eliten in der Schweiz, insbesondere die fehlenden empirischen Daten für die Vergangenheit, diskutiert. Das Kapitel stellt die Indikatoren Bildung, Netzwerke, soziale Herkunft und Geschlecht vor, die auf Bourdieus Kapitaltheorie basieren. Es werden die drei Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) sowie der Habitus als wichtige Faktoren für den Zugang zur Elite erläutert.
Das vierte Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung der Eliten. Es werden die Eliten in den 1960er Jahren und die aktuelle wirtschaftliche Elite in der Schweiz anhand der Indikatoren Bildung, Netzwerke, soziale Herkunft und Geschlecht analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Bildungswege, die Netzwerke, die soziale Herkunft und das Geschlecht der Eliten in beiden Zeitperioden.
Das fünfte Kapitel vergleicht die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der Eliten in den 1960er Jahren und der heutigen Elite. Es werden die Veränderungen in der Zusammensetzung der Elite in Bezug auf Bildung, Netzwerke, soziale Herkunft und Geschlecht analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die wirtschaftliche Elite, die Elitensoziologie, die Schweiz, Bildung, Netzwerke, soziale Herkunft, Geschlecht, Kapitalarten, Habitus, Wandel, Offenheit, Geschlossenheit, Finanzkrise, Kritik, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Zusammensetzung der Schweizer Wirtschaftselite verändert?
Die Arbeit vergleicht die Elite der 1960er Jahre mit der heutigen und untersucht, ob der Zugang offener geworden ist oder ob soziale Herkunft weiterhin dominiert.
Welche Rolle spielt Bourdieus Kapitaltheorie in dieser Studie?
Die Theorie wird genutzt, um den Einfluss von ökonomischem, kulturellem (Bildung) und sozialem Kapital (Netzwerke) auf den Aufstieg in Spitzenpositionen zu messen.
Ist Bildung der Schlüssel zum Aufstieg in die Elite?
Obwohl Bildung formal wichtig ist, zeigen Studien oft, dass Kinder aus der Oberschicht aufgrund ihrer Herkunft und Beziehungen (Habitus) deutlich bessere Chancen auf Spitzenjobs haben.
Wie steht es um den Frauenanteil in der Schweizer Wirtschaftselite?
Die Arbeit analysiert Geschlecht als einen der Hauptindikatoren und stellt fest, dass Frauen in den Chefetagen trotz Fortschritten weiterhin unterrepräsentiert sind.
Was sind "Funktionseliten"?
Dies sind Personen, die ihre Machtposition aufgrund ihrer spezifischen Funktion innerhalb eines gesellschaftlichen Teilsystems (z.B. Wirtschaft oder Politik) innehaben.
- Quote paper
- Matthias Rem (Author), 2009, Eliten im Wandel? - Eine Untersuchung anhand der wirtschaftlichen Elite in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130755