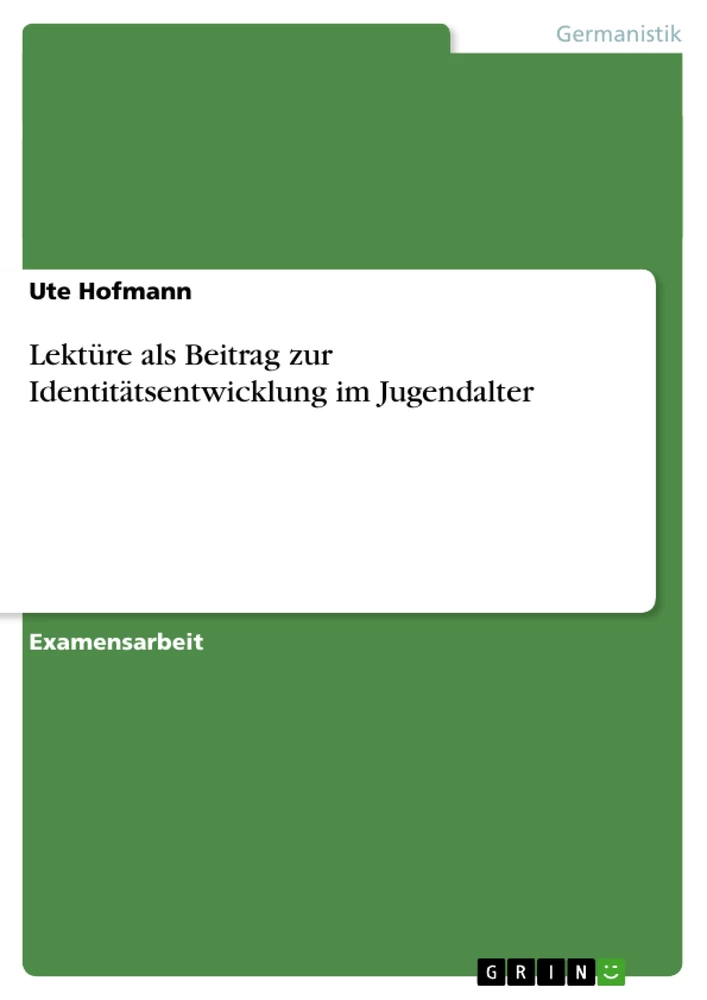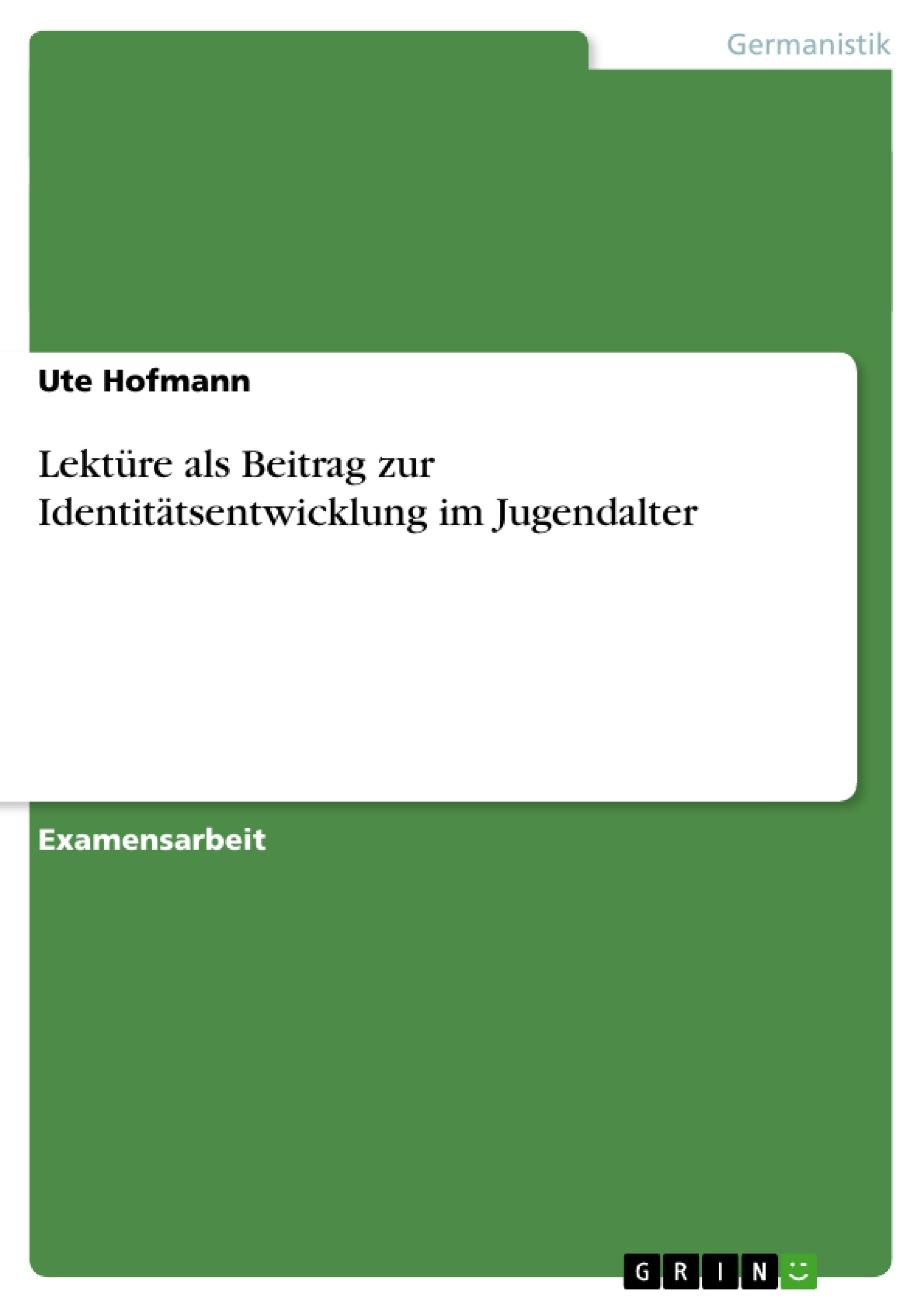Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, wie es literarische Lektüre vermag, Einfluss auf die Identitätsentwicklung im Jugendalter zu nehmen. Aus diesen Erkenntnissen werden die didaktischen Konsequenzen für den Literaturunterricht, insbesondere der Hauptschule, erörtert und in abschließende methodische Überlegungen übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identitätsentwicklung im Jugendalter
- Begriffsklärungen
- Ausgewählte Theorien zur Identitätsentwicklung
- Der psychosoziale Ansatz von Erikson
- Der psychoanalytische Ansatz von Blos
- Der symbolische Interaktionismus: Mead und Krappmann
- Patchwork-Identität
- Zusammenfassung und Ausblick
- Die Bedeutung des Lesens im Jugendalter
- Kommunikationswissenschaftliche Ansätze
- Lesebiographische Forschung
- Lektüre als Refugium für das Unerledigte
- Substitution, Projektion und Empathie
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten
- Zusammenfassung und Ausblick
- Exkurs zum Verhältnis von Text und Leser
- Wolfgang Isers Überlegungen zum Lesevorgang
- Lesen als Flow-Erlebnis
- Schullektüre, Literaturunterricht und Identitätsbildung
- Schullektüre vs. Privatlektüre?
- Literaturdidaktische Positionen zur Wirkung von Lektüre auf Identitätsbildung
- Jürgen Kreft als erster Vertreter einer identitätsorientierten Literaturdidaktik
- Die identitätsorientierte Literaturdidaktik um Kaspar H. Spinner
- Stufen des Textverstehen
- Literarische Lektüre als „Probe-Handeln“
- Empathie und Fremdverstehen
- Imaginationsfähigkeit
- Literatur als Übergangsraum
- Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Übergangslesen
- Literarisierung als Aneignung von Alterität
- Zusammenfassung und Ausblick
- Methodische Überlegungen
- Methoden zur Leseförderung
- Methoden des identitätsorientierten Umgangs mit Literatur
- Methoden zur geschlechtsspezifischen Differenzierung im Literaturunterrichts
- Versuch einer Zusammenführung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie literarische Lektüre im Jugendalter die Identitätsentwicklung beeinflusst. Sie untersucht die vielfältigen Aspekte des Themas und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Lesen und Identität im Kontext der Literaturdidaktik.
- Identitätsbildung im Jugendalter
- Die Bedeutung des Lesens im Jugendalter
- Das Verhältnis zwischen Text und Leser
- Schullektüre, Literaturunterricht und Identitätsbildung
- Methodische Überlegungen zur Förderung von Identitätsbildung durch Lektüre
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt den Begriff der Identität und stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Identitätsentwicklung im Jugendalter vor, darunter die Arbeiten von Erikson, Blos, Mead, Krappmann und Keupp. Kapitel 2 widmet sich dem Leseverhalten von Jugendlichen und untersucht die unterschiedlichen Motive, Rezeptionshaltungen und geschlechtsspezifischen Unterschiede im Umgang mit Literatur. Kapitel 3 befasst sich mit dem Verhältnis von Text und Leser im Lektürevorgang, wobei die Überlegungen von Wolfgang Iser zur Rezeptionsästhetik und das Konzept des "Flow-Erlebens" im Vordergrund stehen. Kapitel 4 analysiert die Rolle von Schullektüre und Literaturunterricht bei der Identitätsbildung, wobei verschiedene didaktische Ansätze, insbesondere der identitätsorientierte Literaturunterricht, betrachtet werden. Kapitel 5 schließlich liefert methodische Überlegungen zur Förderung eines identitätsorientierten Umgangs mit Literatur im Unterricht, wobei auch Aspekte der geschlechtsspezifischen Differenzierung berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Identität, Jugendalter, Identitätsentwicklung, Lektüre, Leseverhalten, Literaturdidaktik, Literaturunterricht, Rezeptionsästhetik, Flow-Erlebnis, geschlechtsspezifische Differenzierung
- Quote paper
- Ute Hofmann (Author), 2002, Lektüre als Beitrag zur Identitätsentwicklung im Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13079