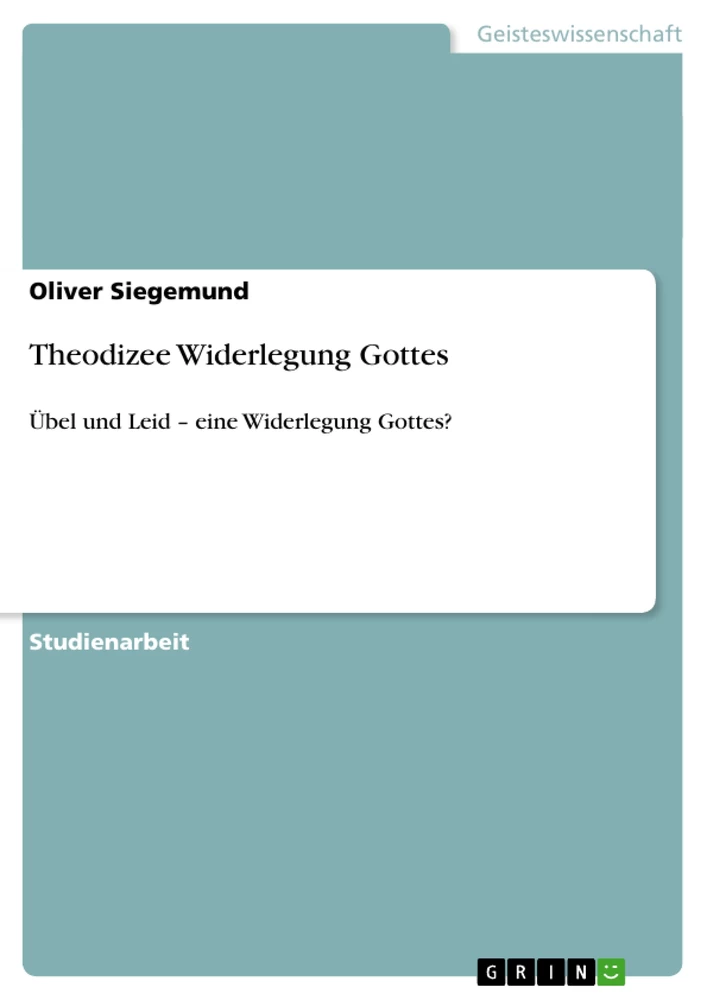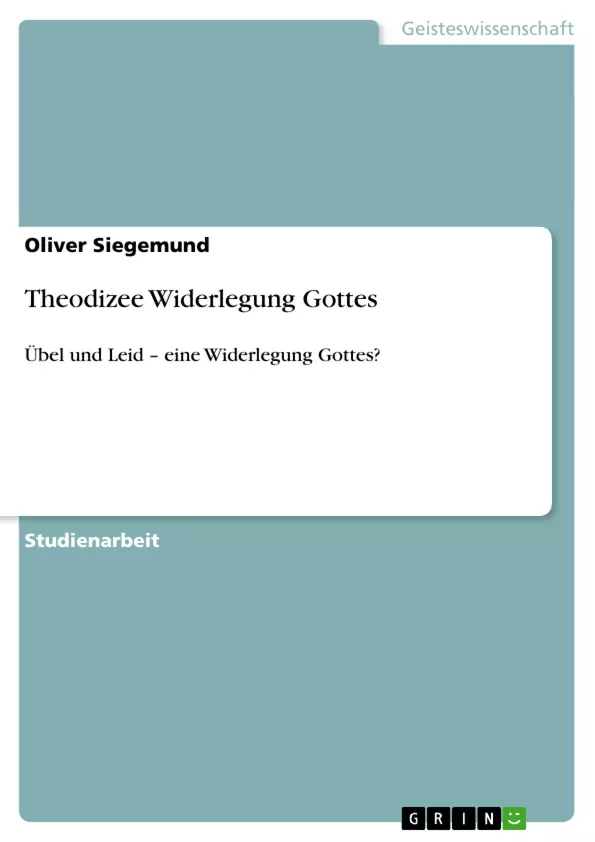Etwas, dass nahezu alle Menschen miteinander verbindet, ist die Erkenntnis von Übel und Leid, welche sowohl als gesellschaftlich-kollektiv (z.B. witschaftliche Rezession bzw. Naturkatasrophe) als auch persönlich-individuell erfahren werden. Für Übel und Leid kennzeichnend ist, dass ihre Empfinden mit relativer Stärke wahrgenommen wird, denn jemand, der so leidet, dass er krank wird, weil er sich als Millionär nicht reich genug fühlt, leidet unter Umständen genauso stark, wie ein Obdachloser der erkrankt, weil ihn sein Schlafsack nicht ausreichend gegen die Kälte geschützt hat.
Da Übel und Leid offenbar existenzielle menschliche Freiheiten bedrohen, versucht der Mensch ihre Ursachen zu finden. Gefundene Ursachen werden in der Folge entweder verurteilt oder legitimiert. Nun ist es leicht nachzuvollziehen, dass jenes Leid, welches durch menschliche Gewalt verursacht wurde (moralische Übel), leichter verurteilt oder legitimiert werden kann, als solches, dessen Ursachen eindeutig nicht an menschliches Handeln geknüpft waren (natürliches Übel). Letzteres stellt ein großes Problem da, weil hier anscheinden niemand für verursachtes Übel und Leid nachhaltig verantwortlich gemacht und verurteilt werden kann: Es hat keinen Sinn die Natur zu verurteilen, da die Umsetzung eventueller Strafen unmöglich ist.
Während der Atheist keine Person für natürliches Übel und Leid verantwortlich machen kann und dies als Erkenntnislücke hinnimmt, ist die Natur für den Christen das Werk eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gottes. Diese christliche Sicht aber führt geradewegs in einen logischen Widerspruch. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Uminterpretation des Problems
- Aufhebung des Widerspruchs durch Preisgabe einer Prämisse
- Preisgabe der Allgüte
- Preisgabe der Allmacht
- Gläubiger Verzicht auf eine Lösung
- Lösung des Widerspruchs durch Zusatzannahmen
- Free-will-defence
- Soul-making-theodicy
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Problem von Übel und Leid im Kontext des christlichen Gottesbildes. Ziel ist es, die logischen Widersprüche zu analysieren, die sich aus der Existenz von Leid in einer Welt ergeben, in der ein allmächtiger und allgütiger Gott herrscht. Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze zur Lösung des Theodizee-Problems, die sich mit der Uminterpretation des Problems, der Preisgabe von Prämissen und der Einführung von Zusatzannahmen befassen.
- Das Theodizee-Problem: Die Existenz von Übel und Leid in einer Welt mit einem allmächtigen und allgütigen Gott.
- Uminterpretation des Problems: Die Kritik an der Suche nach einer rein theoretischen Lösung.
- Preisgabe von Prämissen: Die Modifikation des Gottesbildes durch die Aufhebung der Allmacht oder Allgüte.
- Zusatzannahmen: Die Einführung von Konzepten wie dem freien Willen oder der Seelenbildung, um das Problem zu lösen.
- Gläubiger Verzicht auf eine Lösung: Die Akzeptanz des Widerspruchs als Ausdruck des Mysteriums Gottes.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Übel und Leid ein und stellt die Problematik im Kontext des christlichen Gottesbildes dar. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Leid existiert, wenn Gott es verhindern will und kann. Die Uminterpretation des Problems befasst sich mit der Kritik an der Suche nach einer rein theoretischen Lösung des Theodizee-Problems. Es wird argumentiert, dass eine praktische Lösung des Problems wichtiger ist als eine theoretische. Im Kapitel "Aufhebung des Widerspruchs durch Preisgabe einer Prämisse" werden die beiden Attribute der Allmacht und der Allgüte Gottes in Frage gestellt. Es wird diskutiert, ob die Preisgabe eines dieser Attribute eine Lösung des Theodizee-Problems ermöglichen könnte. Das Kapitel "Gläubiger Verzicht auf eine Lösung" befasst sich mit der Akzeptanz des Widerspruchs als Ausdruck des Mysteriums Gottes. Es wird argumentiert, dass eine Lösung des Theodizee-Problems nicht unbedingt notwendig ist, um den Glauben an Gott zu rechtfertigen. Im Kapitel "Lösung des Widerspruchs durch Zusatzannahmen" werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die das Theodizee-Problem zu lösen versuchen. Dazu gehören die Free-will-defence, die besagt, dass Gott den Menschen einen freien Willen gegeben hat, und die Soul-making-theodicy, die argumentiert, dass Leid notwendig ist, um die Seele zu bilden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Theodizee-Problem, Übel und Leid, das christliche Gottesbild, die Allmacht und Allgüte Gottes, die Uminterpretation des Problems, die Preisgabe von Prämissen, Zusatzannahmen, der freie Wille, die Seelenbildung, der gläubige Verzicht auf eine Lösung und das Mysterium Gottes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Problem der Theodizee?
Das Theodizee-Problem beschreibt den logischen Widerspruch zwischen der Existenz von Übel und Leid und dem Glauben an einen allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gott.
Was versteht man unter der „Free-will-defence“?
Dieser Ansatz besagt, dass Gott den Menschen einen freien Willen gegeben hat und moralisches Übel die notwendige Folge der menschlichen Freiheit ist, die Gott respektiert.
Was bedeutet „Soul-making-theodicy“?
Diese Theorie argumentiert, dass Leid und Herausforderungen in der Welt notwendig sind, um die menschliche Seele zu formen und moralisches Wachstum zu ermöglichen.
Kann man den Widerspruch durch die Preisgabe einer Prämisse lösen?
Ja, theoretisch könnte man entweder die Allmacht oder die Allgüte Gottes in Frage stellen, um den logischen Widerspruch aufzuheben, was jedoch das klassische christliche Gottesbild verändern würde.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen moralischem und natürlichem Übel?
Moralisches Übel wird durch menschliches Handeln verursacht, während natürliches Übel (z. B. Naturkatastrophen) nicht an menschliche Entscheidungen geknüpft ist und daher schwerer zu rechtfertigen scheint.
- Quote paper
- Oliver Siegemund (Author), 2008, Theodizee Widerlegung Gottes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130852