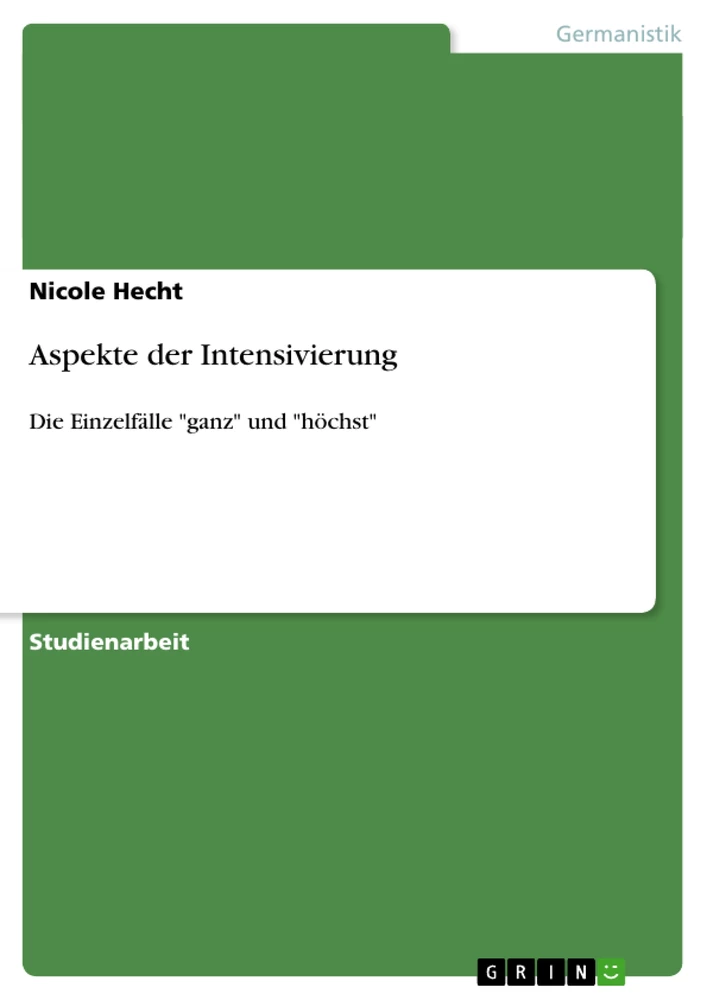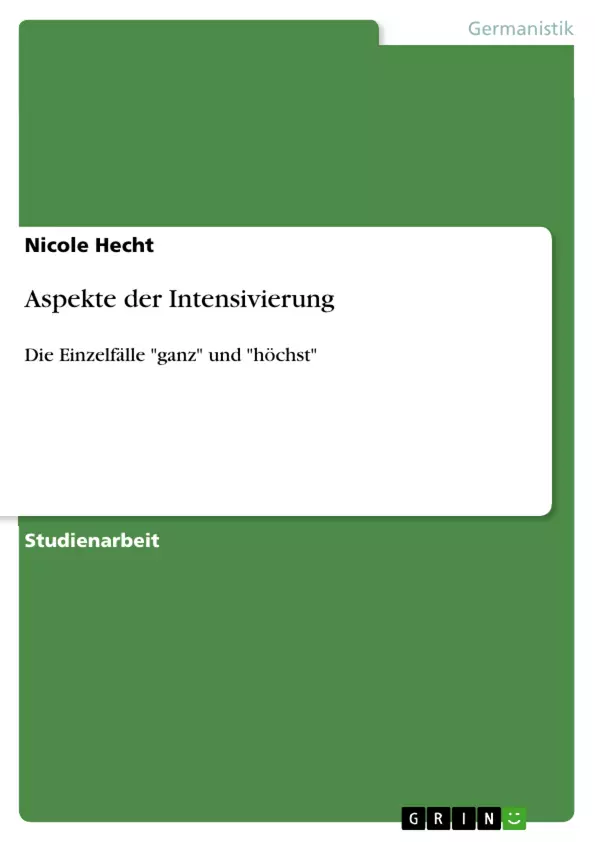Im Zeitalter der Extreme ist sie zu einem Lieblingskind der Deutschen geworden – die Intensivierung. Denn durch sie ist es möglich eine Aussage zu modifizieren, d.h. etwas zu verstärken oder abzuschwächen. Hierbei sind der Intensität nur wenig Grenzen gesetzt. Intensivierung ist heutzutage allgemein gebräuchlich, besonders in der Umgangs- oder Alltagssprache findet sie Verwendung. Aber auch in der Fachsprache hat die Intensivierung ihren Platz gefunden, allerdings nicht in einem solch hohen Maß wie im alltäglichen und dialogischen Gebrauch der Sprache.
Diese Arbeit befaßt sich speziell mit der Problematik der Kollokationen von ganz und höchst mit einem Adjektiv. Diese Partikeln sind insofern besonders interessant, da sie Problemfälle der Intensivierung sind. Zum einen weil sie sowohl eine verstärkende, als auch eine abschwächende Funktion haben (ganz), zum anderen weil sie nicht mit jedem Adjektiv verträglich sind (höchst). Außerdem zählen sie zu den wenigen Partikeln, denen eigene Untersuchungen gewidmet worden sind. Problematisch ist jedoch, daß die Partikelforschung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist.
„Die Partikeln weisen gegenüber (...) anderen Funktionswörtern Besonderheiten auf, die deshalb kaum erkannt worden sind, weil sie sehr lange von der Sprachwissenschaft vernachlässigt worden sind und erst in den letzten beiden Jahrzehnten stärker in das Blickfeld der Forschung getreten sind.“
Vermutlich findet sich aus diesem Grund nur wenig Literatur zu den speziellen Themen dieser Hausarbeit, deshalb stützen sich die folgenden Thesen hauptsächlich auf die Arbeiten von Pusch (1981), Rainer (1984) und van Os (1989). Ferner wird ein Einblick gegeben, inwieweit diese Partikel Auswirkung auf Intensivierungsskalen haben. Diese Aussagen beruhen weitestgehend auf den im Seminar erarbeiteten Zusammenhängen, da die Fachliteratur darüber nur wenig Angaben macht.
Zunächst wird jedoch ein grober Einblick in die „Welt der Partikelforschung“ gegeben, um eine Grundlage für die etwas spezielleren Untersuchungen an ganz und höchst zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeine Vorbemerkungen
- 1.1 Was ist Intensivierung?
- 1.2 Was sind ganz und höchst - Problematik der Klassifizierung
- 1.3 Merkmale und Funktionen der Partikeln
- 1.4 Steigerungspartikeln
- 2. Untersuchungen von „ganz“
- 2.1 Vorbemerkungen und Erläuterung des Themas
- 2.2 Ganz als Intensivierer (Verstärker)
- 2.2.1 Betonung von ganz
- 2.2.2 Ganz bei „nichtgraduierbaren“ Ausdrücken
- 2.2.2.1 Ganz bei superlativischen Adjektiven mit Grenzwert
- 2.2.2.2 Ganz bei superlativischen Adjektiven ohne Grenzwert
- 2.2.3 Ganz bei nicht oder negativ wertenden Adjektiven
- 2.3 Ganz als Deintensivierer (Abschwächer)
- 2.3.1 Das abwertende ganz
- 2.3.2 Das metaphorisierende ganz
- 2.4 Intensivierungsskalen von ganz
- 2.4.1 Absolute Intensivierung mit Skalenendpunkt
- 2.4.2 Absolute Intensivierung ohne Skalenendpunkt
- 2.4.3 Gemäßigte Intensivierung
- 2.5 Die ganz-Diskussion – Ergebnisse und Schlußbetrachtung
- 3. Untersuchung von „höchst“
- 3.1 Vorbemerkungen und Themenerläuterung zu höchst
- 3.2 Untersuchungen zu höchst
- 3.2.1 Die Untersuchungsmethode
- 3.2.2 Das Kriterium der Einsilbigkeit
- 3.2.3 Der Fremdwortcharakter des Adjektivs
- 3.2.4 Die Frequenz des Adjektivs
- 3.2.5 Höchst-Kollokate mit Dimensionsadjektiven
- 3.2.6 Kritische Betrachtung dieser Kriterien
- 3.2.7 Konkreter und figurativer Gebrauch von Adjektiven
- 3.2.8 Skalenbezug von höchst
- 3.3 Höchst- Ergebnisse und Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kollokationen der Partikeln „ganz“ und „höchst“ mit Adjektiven. Die Zielsetzung besteht darin, die spezifischen intensivierenden und deintensivierenden Funktionen dieser Partikel zu analysieren und die Herausforderungen ihrer Klassifizierung zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch ihren Einfluss auf Intensivierungsskalen.
- Funktion und Verwendung von „ganz“ als Intensivierer und Deintensivierer
- Klassifizierungsprobleme von „ganz“ und „höchst“ im Kontext der Partikelforschung
- Die Kompatibilität von „höchst“ mit verschiedenen Adjektiven
- Der Einfluss von „ganz“ und „höchst“ auf Intensivierungsskalen
- Analyse der relevanten Fachliteratur und deren Diskrepanzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeine Vorbemerkungen: Dieses einleitende Kapitel definiert den Begriff der Intensivierung, differenziert zwischen morphologischer und syntaktischer Intensivierung und führt in die Problematik der Klassifizierung von "ganz" und "höchst" ein. Es beleuchtet die schwierige Einordnung dieser Partikel in bestehende linguistische Klassifikationssysteme und verweist auf unterschiedliche Terminologien in der Fachliteratur. Die Schwierigkeiten resultieren aus der Mehrdeutigkeit des Begriffs "Partikel" selbst und den unterschiedlichen Ansätzen der Sprachwissenschaftler bei der Einteilung von Wortarten. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die komplexen Fragen vor, die im Hauptteil der Arbeit behandelt werden, indem er die bestehenden Meinungsverschiedenheiten in der Fachliteratur zum Thema aufzeigt.
2. Untersuchungen von „ganz“: Dieses Kapitel analysiert die Partikel „ganz“ umfassend. Es untersucht „ganz“ sowohl in seiner Funktion als Intensivierer (Verstärker) – mit Unterscheidungen nach Betonung, Anwendung auf graduierbare und nicht-graduierbare Adjektive, und Verwendung mit positiv, negativ oder neutral konnotierten Adjektiven – als auch in seiner Funktion als Deintensivierer (Abschwächer), wobei abwertende und metaphorisierende Verwendungen differenziert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Einflusses von „ganz“ auf Intensivierungsskalen, wobei verschiedene Arten der Intensivierung (absolut mit und ohne Skalenendpunkt, gemäßigt) differenziert werden. Das Kapitel fasst die Diskussion um „ganz“ zusammen und zieht eine Schlussfolgerung.
3. Untersuchung von „höchst“: Das Kapitel widmet sich der Analyse der Partikel „höchst“. Es beginnt mit einleitenden Bemerkungen und einer Erläuterung der Thematik. Die Untersuchung selbst gliedert sich in mehrere Unterpunkte, die verschiedene Kriterien zur Beschreibung des Gebrauchs von „höchst“ heranziehen: die Untersuchungsmethode, die Einsilbigkeit des Adjektivs, den Fremdwortcharakter, die Frequenz des Adjektivs, Kollokationen mit Dimensionsadjektiven, eine kritische Betrachtung dieser Kriterien, den konkreten und figurativen Gebrauch von Adjektiven und schliesslich den Skalenbezug von „höchst“. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und eine Schlussbetrachtung folgt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Intensivierungspartikeln "ganz" und "höchst"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die intensivierenden und deintensivierenden Funktionen der Partikeln „ganz“ und „höchst“ in Verbindung mit Adjektiven. Sie untersucht deren jeweilige Verwendung, die Herausforderungen ihrer sprachwissenschaftlichen Klassifizierung und ihren Einfluss auf Intensivierungsskalen.
Welche Aspekte von „ganz“ werden untersucht?
Die Analyse von „ganz“ umfasst dessen Funktion als Intensivierer (Verstärker) und Deintensivierer (Abschwächer). Es werden dabei verschiedene Anwendungsfälle unterschieden: Betonung von „ganz“, Verwendung mit graduierbaren und nicht-graduierbaren Adjektiven, positive, negative und neutrale Konnotationen der Adjektive, abwertende und metaphorisierende Verwendungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Einflusses von „ganz“ auf verschiedene Arten von Intensivierungsskalen (absolut mit und ohne Skalenendpunkt, gemäßigt).
Welche Aspekte von „höchst“ werden untersucht?
Die Untersuchung von „höchst“ betrachtet verschiedene Kriterien zur Beschreibung seines Gebrauchs: die angewandte Untersuchungsmethode, die Einsilbigkeit des Adjektivs, dessen Fremdwortcharakter, die Frequenz des Adjektivs, Kollokationen mit Dimensionsadjektiven, eine kritische Betrachtung dieser Kriterien, den konkreten und figurativen Gebrauch von Adjektiven und schließlich den Skalenbezug von „höchst“.
Welche Probleme der Klassifizierung werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Einordnung von „ganz“ und „höchst“ in bestehende linguistische Klassifikationssysteme. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs „Partikel“ selbst und die unterschiedlichen Ansätze der Sprachwissenschaftler bei der Einteilung von Wortarten führen zu Diskrepanzen in der Fachliteratur und machen eine eindeutige Klassifizierung herausfordernd.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Allgemeine Vorbemerkungen (Definitionen, Klassifizierungsprobleme); 2. Untersuchungen von „ganz“ (Intensivierung, Deintensivierung, Skalen); 3. Untersuchung von „höchst“ (verschiedene Kriterien zur Beschreibung des Gebrauchs).
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Fragen: Die Funktion und Verwendung von „ganz“ als Intensivierer und Deintensivierer, die Klassifizierungsprobleme von „ganz“ und „höchst“, die Kompatibilität von „höchst“ mit verschiedenen Adjektiven, der Einfluss von „ganz“ und „höchst“ auf Intensivierungsskalen und die Analyse der relevanten Fachliteratur und deren Diskrepanzen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind in den jeweiligen Kapitelabschnitten ("Ergebnisse und Schlussbetrachtung") zusammengefasst. Die Arbeit bietet einen detaillierten Einblick in die komplexen Funktionen und die Klassifizierungsprobleme der intensivierenden und deintensivierenden Partikeln "ganz" und "höchst".
- Citar trabajo
- M.A. Nicole Hecht (Autor), 2002, Aspekte der Intensivierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130891