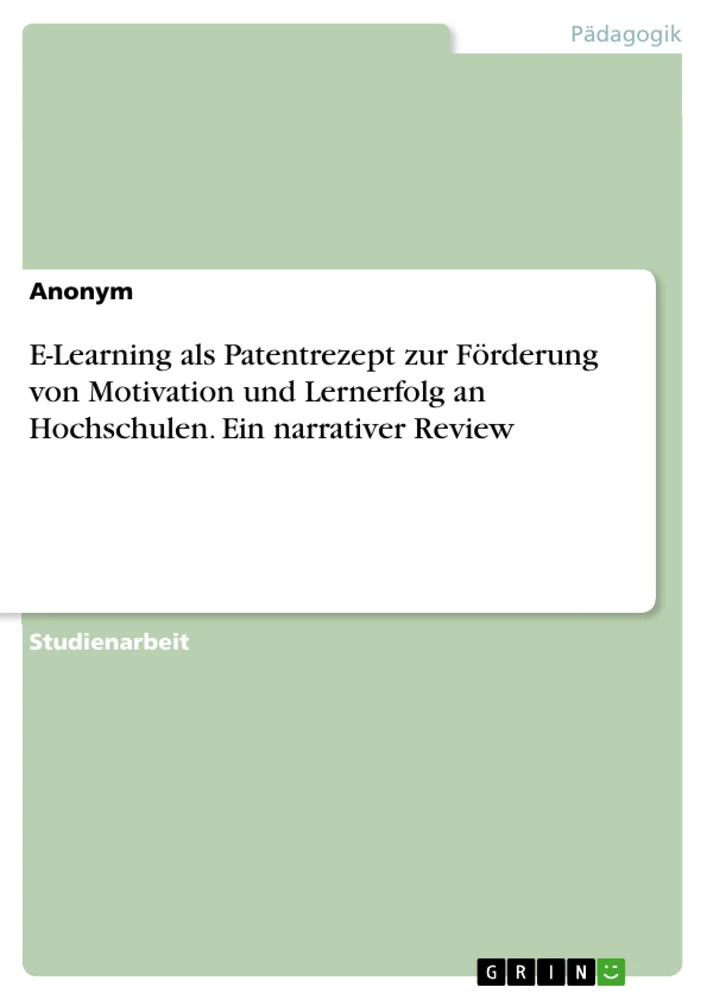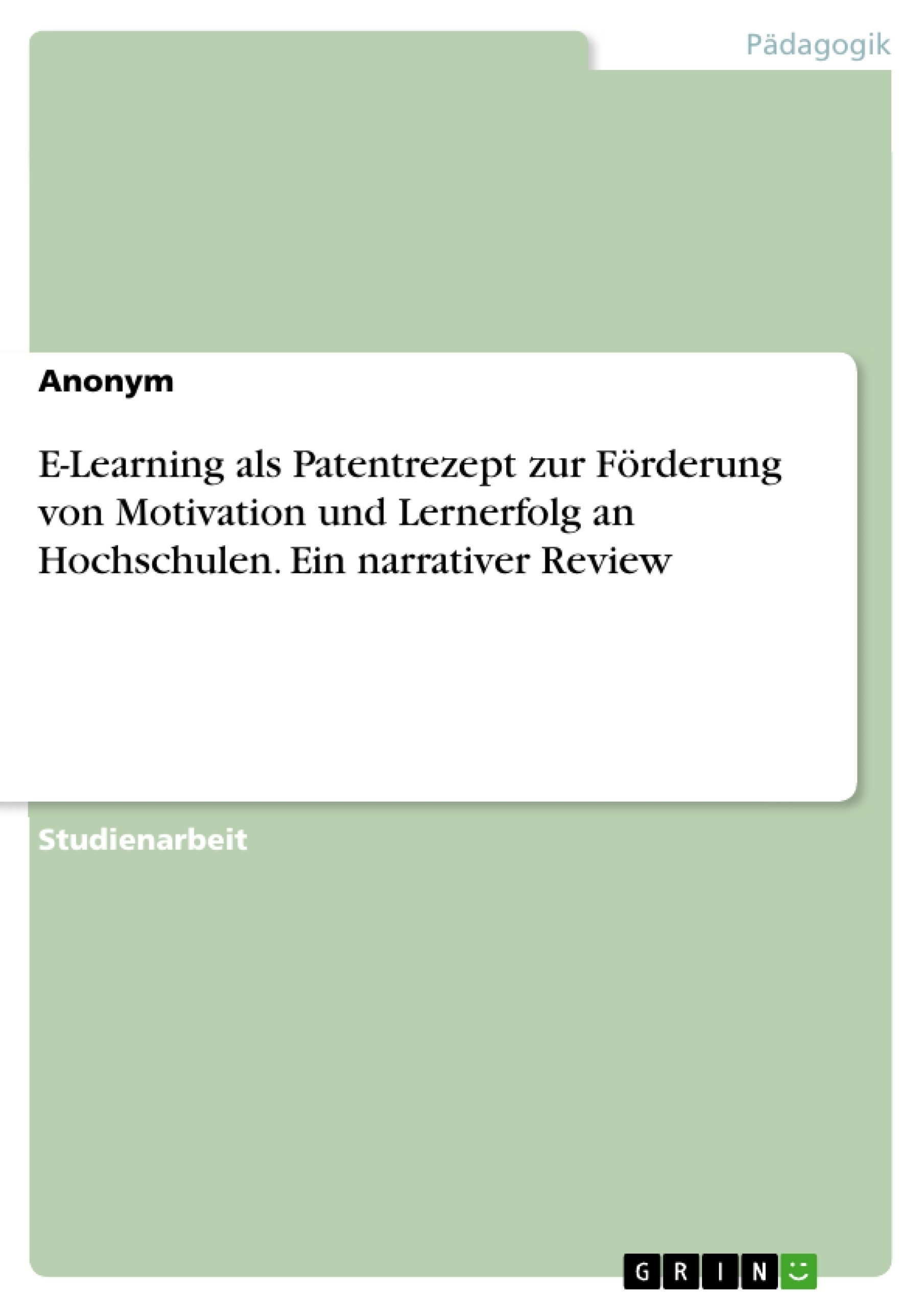Im Laufe der letzten Jahre ist die Umstellung von herkömmlichen Lehrmethoden auf online basierte Lehrformate in Lehr- und Lernumgebungen immer wichtiger geworden. Somit stellt sich die Frage, ob die Nutzung eines E–Learning im Hochschulkontext die Motivation und den Lernerfolg erhöhen kann. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und fünf Studien aus unterschiedlichen Datenbanken herangezogen und analysiert. Dabei kam man zu der Erkenntnis, dass eine online basierte Lehre die Motivation fördern und die Lernleistungen steigern kann und es somit einen positiven Einfluss gibt. Auf Grundlage der Ergebnisse können praktische Implikationen für die Nutzung eines E–Learning gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- E-Learning
- Methode
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Review beleuchtet die Effekte von E-Learning auf die Motivation und den Lernerfolg von Studierenden im Hochschulkontext. Die Arbeit untersucht, ob die Nutzung von E-Learning einen positiven Einfluss auf die Lernmotivation und den Lernerfolg hat.
- Definition und Merkmale von E-Learning
- Bedeutung von Motivation im Lernprozess
- Zusammenhang zwischen E-Learning und Lernerfolg
- Analyse bestehender Studien zum Einfluss von E-Learning
- Ableitung praktischer Implikationen für die Hochschullehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Wandel in der Lehre und den steigenden Stellenwert von E-Learning vor. Sie verdeutlicht die Bedeutung von E-Learning für die Gestaltung von Lernumgebungen und die Förderung von Motivation und Lernerfolg.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel definiert den Begriff E-Learning und erläutert die wichtigsten Elemente und Dimensionen des Konstrukts. Es beleuchtet den Einfluss von digitalen Technologien auf den Lernprozess und die verschiedenen Innovationen im Bereich E-Learning.
- Methode: Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise des Reviews, die Auswahlkriterien für die Studien und die Art der Datenanalyse.
- Ergebnisse: Hier werden die wichtigsten Ergebnisse der ausgewählten Studien präsentiert und zusammengefasst.
- Diskussion: Dieses Kapitel analysiert und interpretiert die Ergebnisse des Reviews und beleuchtet die Implikationen für die Hochschullehre.
Schlüsselwörter
E-Learning, Motivation, Lernerfolg, Hochschullehre, digitale Technologien, Lernumgebung, Bildungsprozesse, Innovationen, Studienreview.
Häufig gestellte Fragen
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt dieses Reviews?
Die Arbeit untersucht, ob die Nutzung von E-Learning im Hochschulkontext die Motivation und den Lernerfolg von Studierenden steigern kann.
Welche Methode wurde für die Untersuchung verwendet?
Es wurde ein narrativer Review auf Basis einer systematischen Literaturrecherche durchgeführt, bei dem fünf relevante Studien analysiert wurden.
Hat E-Learning einen positiven Einfluss auf die Motivation?
Ja, die Analyse der Studien ergab, dass eine online-basierte Lehre die Motivation fördern kann.
Führt E-Learning zu besseren Lernleistungen?
Die Ergebnisse zeigen, dass E-Learning die Lernleistungen steigern kann und somit einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg hat.
Welche praktischen Implikationen ergeben sich aus der Arbeit?
Auf Grundlage der Ergebnisse werden Empfehlungen für die Nutzung von E-Learning zur Gestaltung moderner Lernumgebungen in der Hochschullehre abgeleitet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, E-Learning als Patentrezept zur Förderung von Motivation und Lernerfolg an Hochschulen. Ein narrativer Review, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1308929