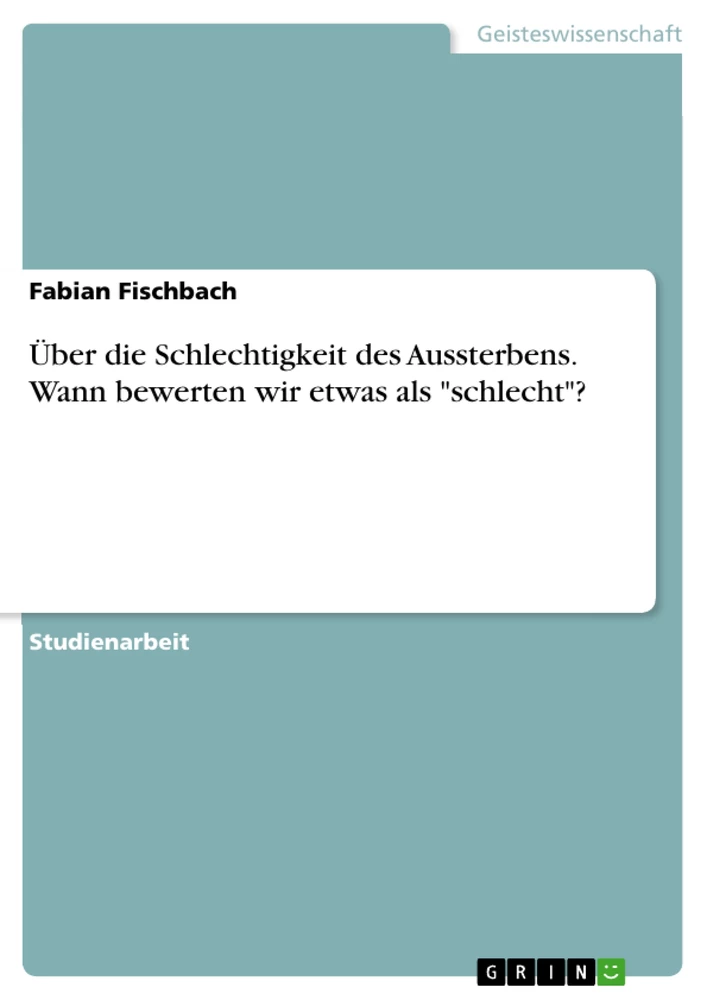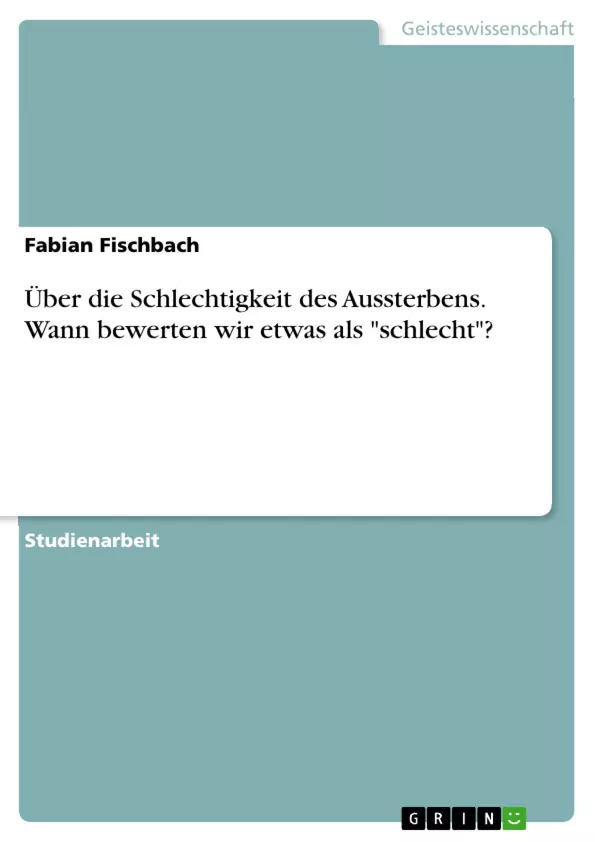Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob es sich beim anthropogen verursachten Massenaussterben um etwas an sich Schlechtes handelt und wenn dem so ist, worauf sich diese Bewertung gründet.
Um sich einer Antwort zu nähern, soll sich zunächst im Allgemeinen damit beschäftigt werden, was es bedeutet, etwas als an sich schlecht zu bewerten. Beurteilungen dieser Art stehen in einem Zusammenhang mit Werten beziehungsweise Bewertungen im Allgemeinen, insbesondere mit intrinsischen Werten. Im ersten inhaltlichen Kapitel soll daher zunächst eine Werteauffassung dargelegt werden, auf deren Grundlage es möglich ist, die Frage nach der Schlechtigkeit von etwas argumentativ zu klären. Massenaussterben ist eine andere Bezeichnung für Biodiversitätsverlust und schließt sich an die Debatte um Letzteren an. Kapitel 3 soll einige gängige Begründungen für den Wert der Biodiversität analysieren, um herauszustellen, dass deren Wert, einigen Positionen zufolge, in erster Linie instrumentell bestimmt wird. Die damit verbundenen Argumentationen lassen sich teilweise analog auf Spezies übertragen. Es soll gegen diesen Hintergrund herausgestellt werden, wie das basalere Phänomen des Aussterbens in der Biodiversitätsdebatte zu verorten ist und aus welcher Perspektive es idealerweise analysiert wird, um es als unabhängiges Phänomen zu bewerten. Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Begriff der Spezies. Da Aussterben auf Speziesebene geschieht, ist eine Auseinandersetzung mit der biologischen Speziesindividuation unerlässlich. In Kapitel 4 sollen einige Eigenschaften von biologischen Arten herausgestellt werden. Von wichtiger Bedeutung ist dabei, dass diese, unter anderem, als unstrukturierte Kollektive aufgefasst werden können. Aufgrund der Ontologie solcher Entitäten, ergibt sich ein wichtiger Zusammenhang vom Individuum zur Gruppe, der bei der Diskussion nicht außer Acht gelassen werden sollte. Der zuvor erarbeitete Rahmen soll in Kapitel 5 genutzt werden, um eine Antwort auf die Ausgangsfrage zu finden. Dabei wird zunächst Bezug auf einige Probleme genommen und abschließend ein Vorschlag zum Umgang mit diesen gemacht. Im abschließenden Kapitel soll auf die explizite Problematik des Massenaussterbens gegenüber dem Aussterben an sich zurückgekommen und einige Implikationen des Genannten herausgestellt und die vorangegangene Argumentation rekonstruiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sterben, Aussterben und Massenaussterben im Anthropozän
- 2 Schlecht an sich
- 3 Isolation der Arten in der Biodiversitätsdebatte
- 4 Speziesindividuation und das Verhältnis von Kollektiv und Individuum
- 5 Die Verortung intrinsischer Werte und das Schlechte am Aussterben
- 5.1 Die Reduzierbarkeit von Arten
- 5.2 Schlecht für alle?
- 6 Das Schlechte am Aussterben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob das anthropogen verursachte Massenaussterben an sich schlecht ist und welche Begründungen hierfür angeführt werden können. Sie geht der Frage nach, ob Aussterben an sich schlecht ist, unabhängig von der Größenordnung des Ereignisses. Die Analyse konzentriert sich auf den intrinsischen Wert von Arten und deren Rolle in der Biodiversitätsdebatte.
- Der intrinsische Wert von Arten
- Die Rolle des Aussterbens in der Biodiversitätsdebatte
- Speziesindividuation und das Verhältnis von Kollektiv und Individuum
- Moralische Beurteilung von Aussterbeprozessen
- Das anthropogene Massenaussterben im Kontext des Anthropozäns
Zusammenfassung der Kapitel
1 Sterben, Aussterben und Massenaussterben im Anthropozän: Der Text beginnt mit einer Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten des Sterbens, betonte, dass der Tod an sich nicht unbedingt schlecht ist, sondern die Umstände seines Eintretens moralisch relevant sein können. Er differenziert zwischen dem natürlichen Aussterben von Arten und dem anthropogen verursachten Massenaussterben, das sich durch sein Ausmaß und seine Vermeidbarkeit von anderen Aussterbeprozessen unterscheidet. Die drastisch erhöhte Aussterberate im Anthropozän wird mit dem Verlust der Biodiversität und den Folgen des menschlichen Einflusses auf die Umwelt in Verbindung gebracht. Der Text hebt die Unumgänglichkeit des natürlichen Aussterbens hervor, betont aber gleichzeitig die einzigartige und beunruhigende Dimension des anthropogenen Massenaussterbens, das durch menschliche Aktivitäten verursacht wird und dessen Ausmaß weit über das natürliche Aussterben hinausgeht. Die Erörterung dient als Grundlage für die anschließende Auseinandersetzung mit der moralischen Bewertung von Aussterbeprozessen.
2 Schlecht an sich: Dieses Kapitel befasst sich mit dem philosophischen Konzept von "an sich schlecht". Es wird argumentiert, dass die Beurteilung von etwas als "an sich schlecht" eng mit dem Wertbegriff verknüpft ist und insbesondere mit intrinsischen Werten. Die Grundlage für die spätere argumentative Klärung der Frage nach der Schlechtigkeit des Aussterbens wird hier gelegt, indem ein Verständnis von Werten und deren Relevanz für moralische Urteile entwickelt wird. Der Fokus liegt darauf, ein solides werttheoretisches Fundament zu schaffen, um die moralische Beurteilung von Aussterbeprozessen fundiert angehen zu können.
3 Isolation der Arten in der Biodiversitätsdebatte: Kapitel 3 analysiert gängige Argumente für den Wert der Biodiversität. Der Text untersucht kritisch Positionen, die den Wert der Biodiversität primär instrumentell begründen. Durch die Analyse dieser Positionen wird der Grundstein für die nachfolgende Diskussion über den intrinsischen Wert von Arten gelegt. Es wird der Versuch unternommen, das Phänomen des Aussterbens unabhängig von den Instrumentalisierungsdebatten um die Biodiversität zu verorten und zu analysieren, um eine objektivere Bewertung des intrinsischen Wertes der Arten zu ermöglichen.
4 Speziesindividuation und das Verhältnis von Kollektiv und Individuum: Dieses Kapitel befasst sich mit der biologischen Speziesindividuation und den Eigenschaften biologischer Arten. Es betont, dass Arten als unstrukturierte Kollektive verstanden werden können und untersucht den wichtigen Zusammenhang zwischen Individuum und Gruppe im Kontext des Aussterbens. Diese Analyse der Ontologie von Arten soll als Grundlage für die Diskussion in den folgenden Kapiteln dienen, um die ethische Bewertung von Aussterbeprozessen in Bezug auf die Komplexität der Arten als Kollektive zu betrachten. Die spezifischen Eigenschaften der Arten werden untersucht, um einen soliden Rahmen für die folgende ethische Argumentation zu schaffen.
5 Die Verortung intrinsischer Werte und das Schlechte am Aussterben: Kapitel 5 verwendet den zuvor erarbeiteten Rahmen, um die Ausgangsfrage zu beantworten, ob Aussterben an sich schlecht ist. Es werden Probleme adressiert und Lösungsvorschläge präsentiert. Die Unterkapitel befassen sich mit der Reduzierbarkeit von Arten und der Frage, ob Aussterben für alle Lebewesen schlecht ist. Das Kapitel synthetisiert die bisherigen Ergebnisse und leitet über zum abschließenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Massenaussterben, Aussterben, Biodiversität, intrinsischer Wert, Spezies, Anthropozän, moralische Bewertung, Kollektiv, Individuum, Biodiversitätsverlust.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Sterben, Aussterben und Massenaussterben im Anthropozän
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Frage, ob das anthropogen verursachte Massenaussterben an sich schlecht ist und welche Begründungen hierfür angeführt werden können. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit dem intrinsischen Wert von Arten und deren Rolle in der Biodiversitätsdebatte, unabhängig von der Größe des Aussterbeereignisses.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 unterscheidet verschiedene Arten des Sterbens und fokussiert auf das anthropogene Massenaussterben im Anthropozän. Kapitel 2 behandelt das philosophische Konzept von "an sich schlecht" im Zusammenhang mit intrinsischen Werten. Kapitel 3 analysiert instrumentelle und intrinsische Wertbegründungen der Biodiversität. Kapitel 4 befasst sich mit der Speziesindividuation und dem Verhältnis von Kollektiv und Individuum. Kapitel 5 beantwortet die zentrale Frage nach der Schlechtigkeit des Aussterbens, unter Berücksichtigung der Reduzierbarkeit von Arten. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Ziele verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die moralische Bewertung von Aussterbeprozessen zu untersuchen und zu begründen, ob Aussterben an sich schlecht ist. Er analysiert den intrinsischen Wert von Arten und deren Bedeutung in der Biodiversitätsdebatte. Die Speziesindividuation und das Verhältnis von Kollektiv und Individuum werden ebenso beleuchtet wie das anthropogene Massenaussterben im Kontext des Anthropozäns.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind der intrinsische Wert von Arten, die Rolle des Aussterbens in der Biodiversitätsdebatte, die Speziesindividuation, die moralische Beurteilung von Aussterbeprozessen und das anthropogene Massenaussterben im Anthropozän. Der Text untersucht, ob Aussterben unabhängig von der Größe des Ereignisses moralisch verwerflich ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Massenaussterben, Aussterben, Biodiversität, intrinsischer Wert, Spezies, Anthropozän, moralische Bewertung, Kollektiv, Individuum und Biodiversitätsverlust.
Wie wird die Frage nach der Schlechtigkeit des Aussterbens beantwortet?
Die Frage, ob Aussterben an sich schlecht ist, wird im fünften Kapitel anhand der zuvor entwickelten Argumentationslinie und des erarbeiteten werttheoretischen Fundaments beantwortet. Es werden Probleme adressiert und Lösungsvorschläge präsentiert, wobei auch die Reduzierbarkeit von Arten und die Frage, ob Aussterben für alle Lebewesen schlecht ist, thematisiert werden.
Welche Rolle spielt der intrinsische Wert von Arten?
Der intrinsische Wert von Arten ist ein zentrales Thema des Textes. Die Analyse konzentriert sich auf diesen Wert und seine Bedeutung für die moralische Beurteilung von Aussterbeprozessen. Der Text untersucht, ob Arten einen Wert an sich besitzen, unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen.
Wie wird das Anthropozän in den Text eingebunden?
Das Anthropozän bildet den Kontext des anthropogenen Massenaussterbens. Der Text vergleicht das anthropogen verursachte Massenaussterben mit dem natürlichen Aussterben und betont die drastisch erhöhte Aussterberate im Anthropozän als Folge des menschlichen Einflusses auf die Umwelt.
- Citar trabajo
- Fabian Fischbach (Autor), 2022, Über die Schlechtigkeit des Aussterbens. Wann bewerten wir etwas als "schlecht"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309646