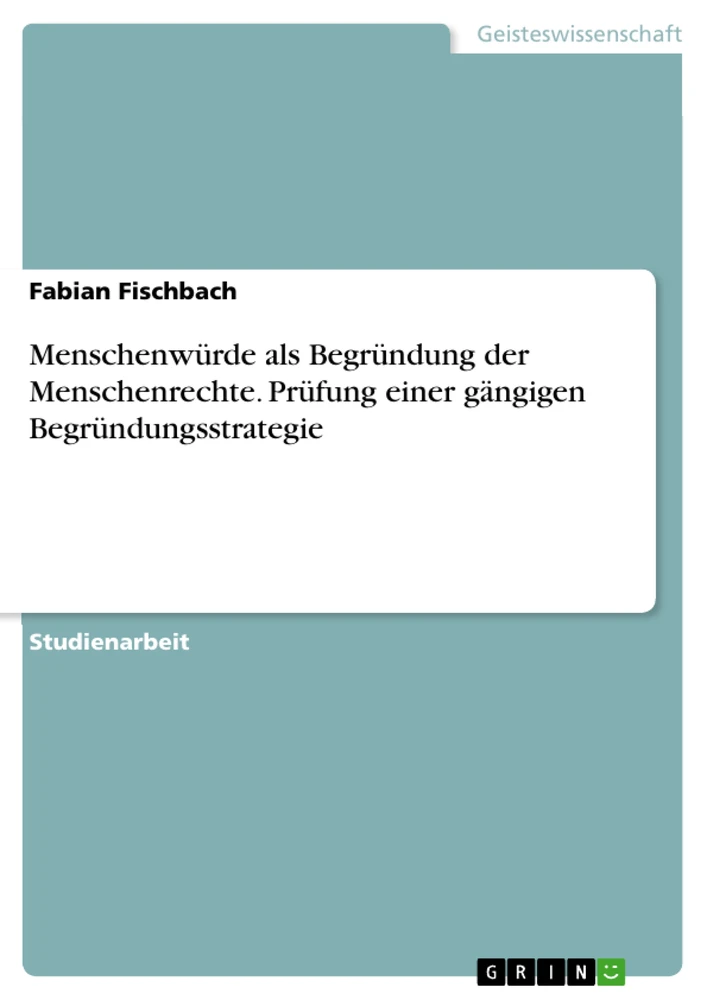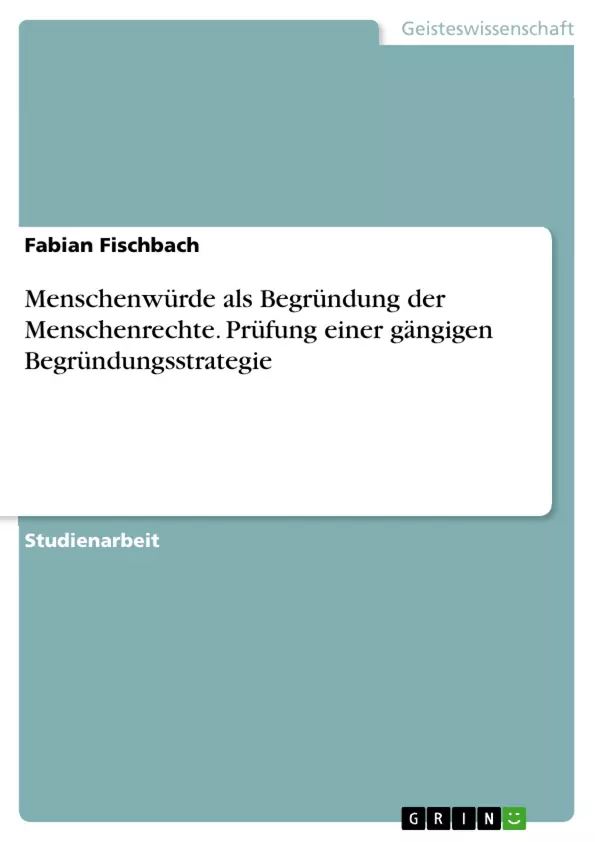Die Arbeit widmet sich der Eignung des Begriffs der Menschenwürde zur Begründung von Menschenrechten. Unter Bezugnahme auf Positionen des Würderealismus und Würdekonstruktivismus sowie gemessen an dem Selbstanspruch der Menschenrechte wird überprüft, ob notwendige Bedingungen erfüllt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Menschenwürde als leere Norm?
- Menschenwürde als formal bedingungsreicher Wert
- Würderealismus und Würdekonstruktivismus
- Theoriespezifische Zusatzbedingungen
- Kritik am Würderealismus und Würdekonstruktivismus
- Entwürdigung der Debatte und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gängige Begründungsstrategie von Menschenrechten aus der Menschenwürde. Sie analysiert die unterschiedlichen Ansätze und Konflikte innerhalb der Debatte um den Begriff der Menschenwürde und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Ableitung universeller Menschenrechte aus diesem Wert.
- Die Frage nach dem Inhalt und der Universalität des Menschenwürde-Begriffs
- Die Debatte um die Adressaten der Menschenwürde
- Die Schwierigkeiten bei der Ableitung von Menschenrechten aus dem Menschenwürde-Konzept
- Die Notwendigkeit von Kriterien zur Überprüfung verschiedener Ansätze zur Definition von Menschenwürde
- Die Auseinandersetzung mit Werterealismus und Wertekonstruktivismus im Zusammenhang mit der Menschenwürde
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik der Menschenwürde als Begründungsgrundlage für Menschenrechte. Es wird gezeigt, dass der Begriff der Menschenwürde in der Praxis oft unklar und uneinheitlich verwendet wird, was zu verschiedenen und teilweise gegensätzlichen Ergebnissen führt. Das zweite Kapitel analysiert die verschiedenen Ansätze zur Definition von Menschenwürde und ihre Auswirkungen auf die Ableitung von Menschenrechten. Es werden die wesentlichen Konfliktlinien der Debatte, wie beispielsweise die Frage nach der Universalität und den Adressaten der Menschenwürde, beleuchtet und es werden Kriterien für eine gültige Definition von Menschenwürde aufgestellt. Das dritte Kapitel stellt die beiden Haupttheorien zum Menschenwürde-Begriff vor, den Würderealismus und den Würdekonstruktivismus, und diskutiert die jeweiligen spezifischen Zusatzbedingungen, die sich aus den theorieeigenen Spezifika ergeben. Die beiden Positionen werden anhand der erarbeiteten Bedingungen auf ihre Gültigkeit hin überprüft.
Schlüsselwörter
Menschenwürde, Menschenrechte, Begründung, Wert, Norm, Würderealismus, Würdekonstruktivismus, Universalität, Adressaten, bioethische Debatte, Präimplantationsdiagnostik, Deduktion, Menschenwürde als Grundbegriff, Rechtssubjekte, Ethos des Bewahrens, pränatale Menschenoptimierung
Häufig gestellte Fragen
Kann die Menschenwürde als alleinige Begründung für Menschenrechte dienen?
Die Arbeit prüft kritisch, ob der oft unklare Begriff der Menschenwürde ausreicht, um universelle Menschenrechte logisch abzuleiten.
Was unterscheidet Würderealismus und Würdekonstruktivismus?
Der Würderealismus geht von einem objektiv existierenden Wert aus, während der Würdekonstruktivismus Würde als ein durch Übereinkunft geschaffenes Konzept betrachtet.
Warum wird die Menschenwürde oft als "leere Norm" bezeichnet?
Weil der Begriff in der Praxis oft uneinheitlich verwendet wird und ohne klare Kriterien für unterschiedliche, teils gegensätzliche politische oder ethische Ziele instrumentalisiert werden kann.
Welche Rolle spielt die bioethische Debatte in dieser Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf Themen wie Präimplantationsdiagnostik und pränatale Optimierung, um die Grenzen des Würdebegriffs aufzuzeigen.
Wer sind die Adressaten der Menschenwürde?
Die Klärung, wer Träger von Würde ist (z. B. auch ungeborenes Leben), ist eine der zentralen Konfliktlinien, die in der Arbeit untersucht werden.
- Quote paper
- Fabian Fischbach (Author), 2020, Menschenwürde als Begründung der Menschenrechte. Prüfung einer gängigen Begründungsstrategie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309653