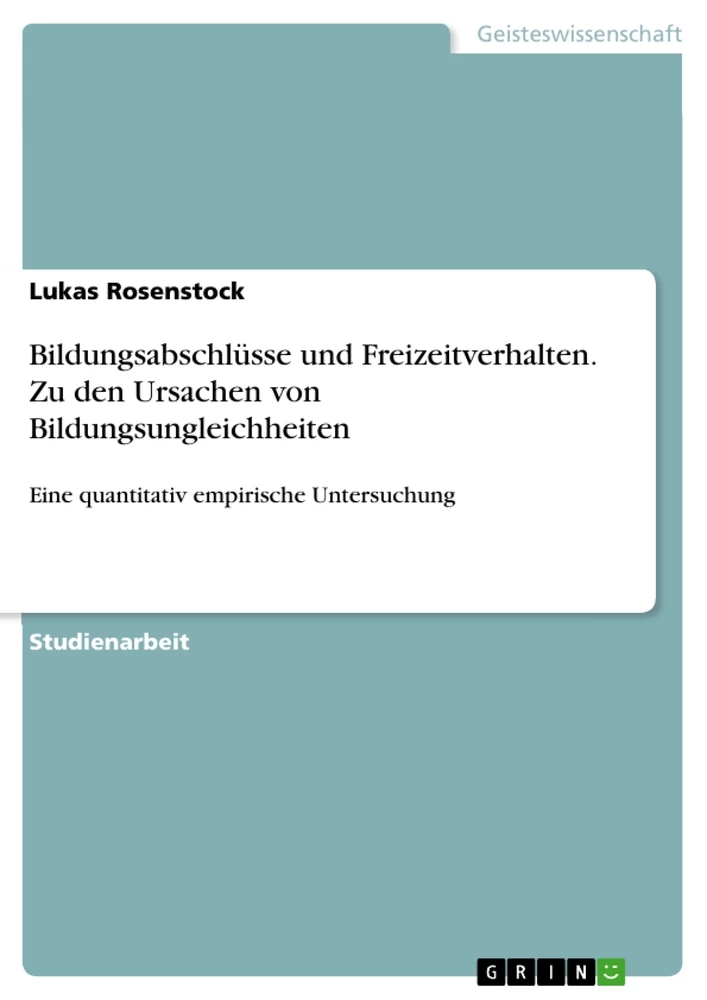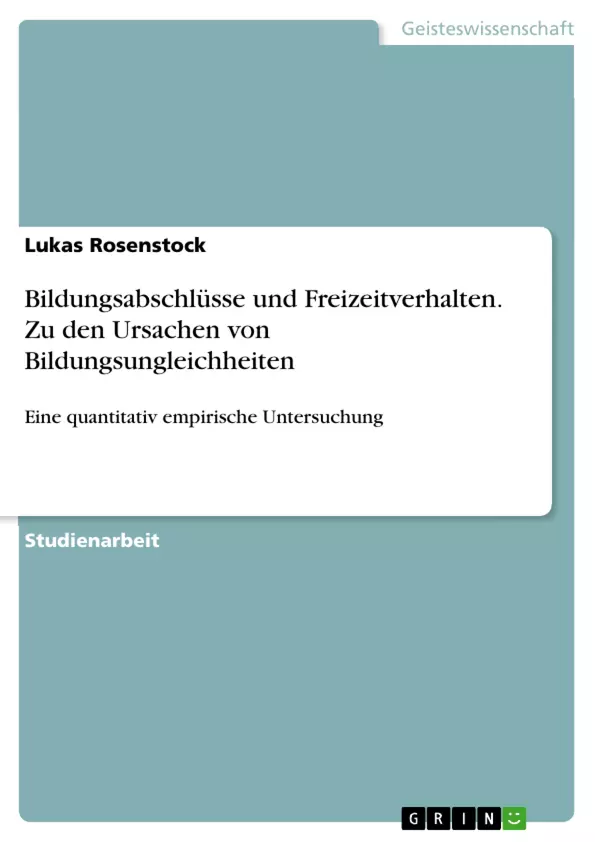Die Arbeit stellt den aktuellen Forschungsstand zum Thema Bildungsungleichheiten vor, um das Verhältnis von Bildungsabschlüssen und Freizeitverhalten zu untersuchen. Anschließend erfolgt eine theoretische Einbettung in die Arbeiten von Boudon und Bourdieu, auf deren Grundlage die Variablen ausgewählt und Hypothesen formuliert werden. Darauf folgt die Beschreibung der Variablen und ihre Operationalisierung sowie eine Beschreibung der Methoden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der quantitativen Analysen dargestellt, welche wiederum im Fazit interpretiert werden.
Soziale Mobilität wird zwar nicht aktiv durch die Gesellschaft verhindert, sehr wohl wird sie jedoch durch ihre starren Mechanismen gehemmt. Soziale Aufsteiger, wie sie in Narrativen wie dem des Tellerwäschers zum Millionär propagiert werden, existieren zwar, sind aber keineswegs Beweise gegen diese Mechanismen, viel mehr untermauern sie diese. Denn betrachtet man biografische Etappen, wie den Wechsel zu einem Gymnasium, das Abitur, ein Studium, eine Promotion, den Berufseinstieg und eventuelle Karrierewechsel, so fällt auf, dass der Anteil der Personen aus sozial schwachen Verhältnissen mit jedem geschafften sozialen Aufstieg, abnimmt.
Dies gipfelt bei Betrachtung derer, die sich an der Spitze dieses Aufstiegs befinden. So haben 82 % der Abgeordneten des Bundestags von 2021 einen Akademischen Bildungsgrad, während es bei den Wählern, lediglich 18,5 % sind und während von den Repräsentanten jeder Fünfte promoviert ist, ist es bei den Repräsentierten lediglich jeder hundertste. Nun ist es noch keine Ungerechtigkeit, geschweige denn ein Problem, dass die Politik von den Gelehrtesten und mutmaßlich Klügeren, des Landes dominiert wird. Ungerecht wird es jedoch, wenn die Teilhabe denen verwehrt wird, welche nicht von Geburt an prädestiniert sind, eine akademische Laufbahn absolvieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie und Forschungsstand
- 2.1 Primäre und sekundäre Herkunftseffekte
- 2.2 Der Habitus und die Kapitalsorten
- 2.3 Hypothesen
- 3. Daten und Methoden
- 3.1 Datensätze
- 3.2 Methoden
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Hypothese 1
- 4.2 Hypothese 2
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Ursachen von Bildungsungleichheiten. Dabei werden die direkten Einflüsse der Familie auf das Bildungsniveau und das Freizeitverhalten des Einzelnen untersucht. Im Fokus stehen die Zusammenhänge zwischen dem Habitus und den Kapitalsorten der Eltern und den Bildungsaspirationen ihrer Kinder. Die Analyse basiert auf quantitativen Daten der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage für Sozialwissenschaftler“ (ALLBUS), der Jahre 2014 und 2018.
- Die Rolle der sozialen Herkunft im Bildungssystem
- Die Auswirkungen des familiären Habitus auf Bildungsaspirationen
- Der Einfluss des Bildungsniveaus auf das Freizeitverhalten
- Die Beständigkeit von Bildungsungleichheiten trotz massiver Bildungsreformen
- Die Bedeutung des Themas für die soziale Mobilität und Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Relevanz des Themas Bildungsungleichheiten dar und skizziert die Problematik des Kreislaufs von Bildungs- und Lebensbenachteiligung. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit. Dabei werden die Konzepte der Primär- und Sekundäreffekte sowie der Habitus und die Kapitalsorten nach Bourdieu erläutert. Es werden zudem die Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden. Im dritten Kapitel werden die Daten und Methoden vorgestellt, die für die Untersuchung verwendet werden. Hierbei werden die Datensätze der ALLBUS-Befragung und die eingesetzten quantitativen Methoden erläutert. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der quantitativen Analysen. Es wird der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und dem Bildungsniveau ihrer Kinder, sowie der Einfluss des Bildungsniveaus auf das Freizeitverhalten untersucht.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Habitus, Kapitalsorten, Freizeitverhalten, Bildungsaspirationen, quantitative Methoden, ALLBUS-Daten, empirische Forschung.
- Quote paper
- Lukas Rosenstock (Author), 2022, Bildungsabschlüsse und Freizeitverhalten. Zu den Ursachen von Bildungsungleichheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309778