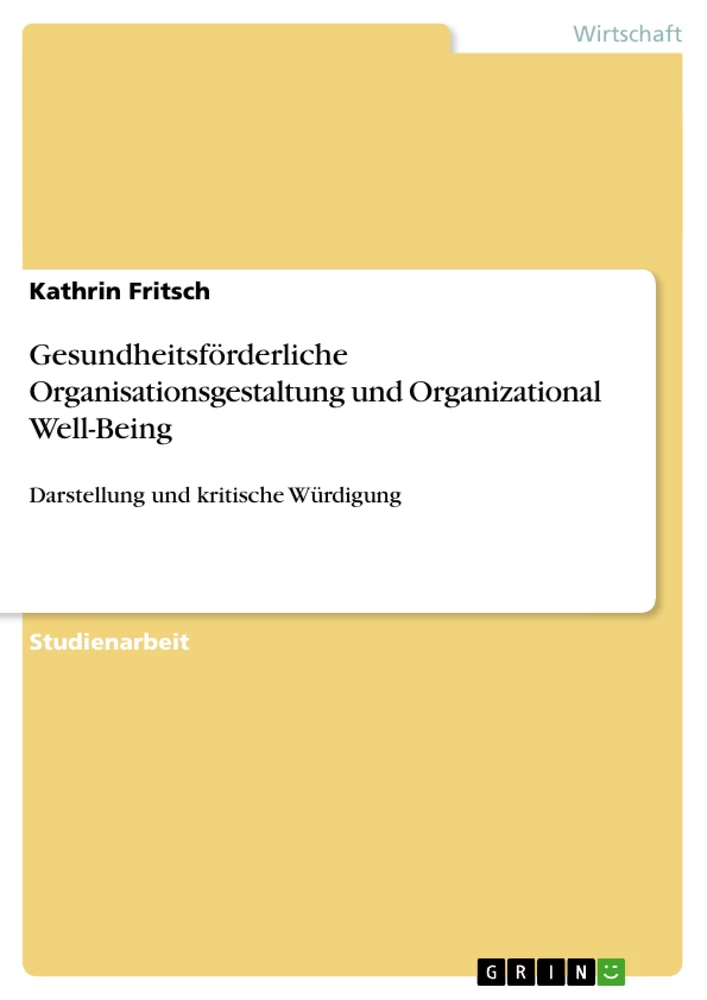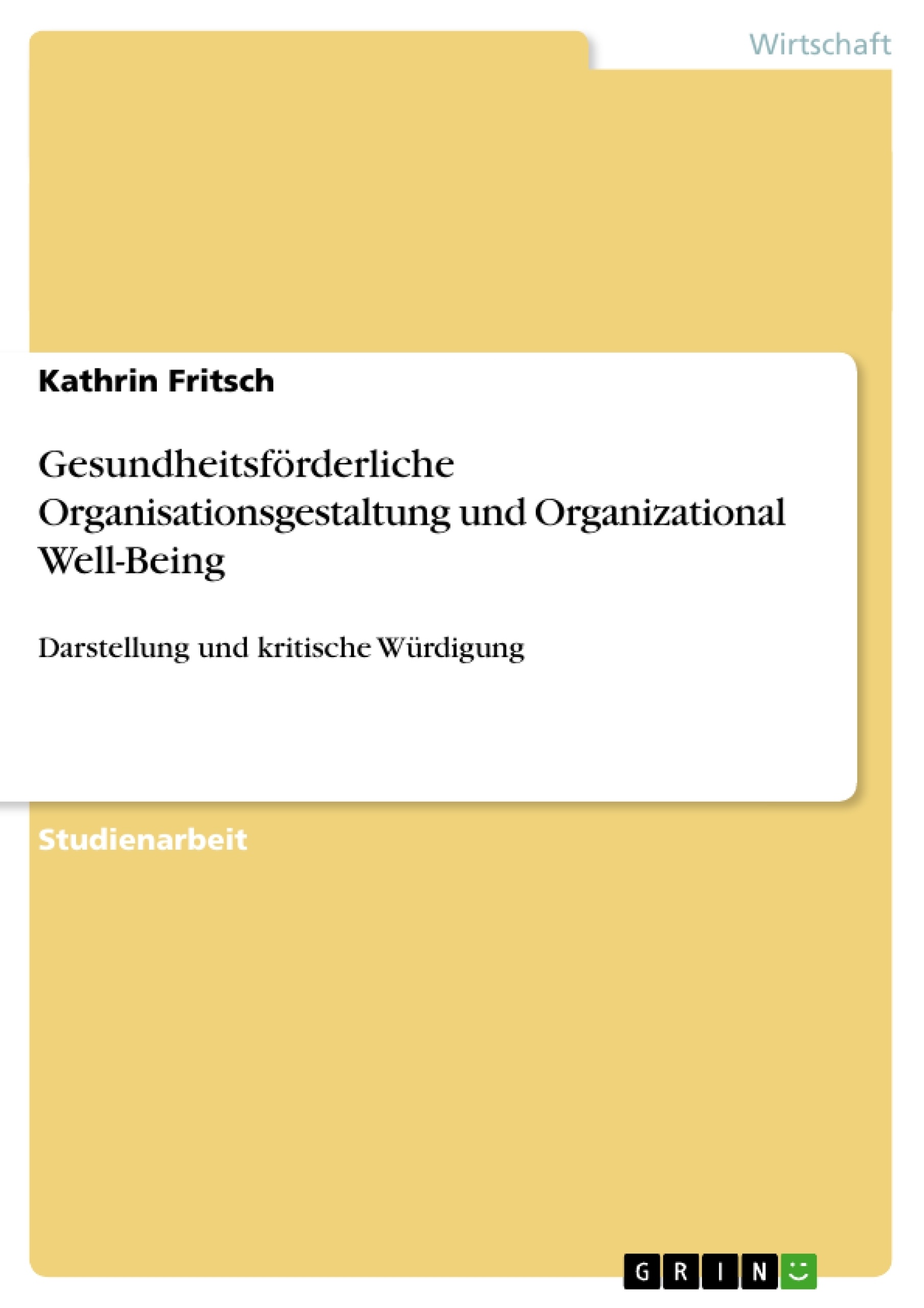1 Einleitung
Der Wandel von der Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft ist u.a. geprägt von einem steigenden Wettbewerb zwischen Unternehmen und dadurch einer höheren Leistungserwartung an die Mitarbeiter. Um die Ziele einer Organisation zu erreichen, müssen Mitarbeiter immer mehr in immer kürzerer Zeit leisten. Die Gesundheit und das Wohlbefinden des einzelnen Mitarbeiters ist dabei eine wichtige Voraussetzung, um diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und so auch die ‚Gesundheit’ der Organisation zu erhalten bzw. zu steigern. Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-förderung und der Verbesserung des individuellem Wohlbefindens können die Leistung der Mitarbeiter und so letztendlich auch die dauerhafte Existenz der Organisation sichern.
Zur Art und Weise der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens lassen sich in der Literatur zwei unterschiedliche Traditionen bzw. Sichtweisen erkennen: zum Einen die europäische und zum Anderen die angloamerikanische Tradition. Bei der europäische Tradition der gesundheitsförderlichen Organisationsgestaltung wird der Blick hauptsächlich auf die gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung und somit auf die rein körperliche Gesundheit des Mitarbeiter gerichtet. Bei der angloamerikanische Sichtweise des ‚Organizational Well-Being’ rückt dagegen das innere Wohlbefinden des Mitarbeiters in den Fokus der Betrachtungen.
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die beiden unterschiedlichen Traditionen der Gesundheitsförderung darzustellen, sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel zunächst die Begriffe Gesundheit und ‚Well-Being’ definiert und anschließend Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention voneinander abgegrenzt. Im dritten Kapitel wird dann die europäische Sicht der betrieblichen Gesundheitsförderung dargestellt. Dabei wird auch auf Konzepte der Verhaltens- und Verhältnisprävention eingegangen und das Instrument des Gesundheitszirkels zur praktischen Umsetzung vorgestellt. Im vierten Kapitel wird analog zum dritten Kapitel die angloamerikanische Tradition des Gesundheitsmanagements erklärt. Eine kritische Analyse beider Traditionen erfolgt im fünften Kapitel. Dabei werden auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Sichtweisen dargestellt und auf eine ganzheitlichen Betrachtung in Form eines integralen Modells verwiesen. Im sechsten Kapitel folgt schließlich eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen
- 2.1 Salutogenese
- 2.2 Gesundheit und 'Well-Being'
- 2.3 Arbeitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention
- 3 Die europäische Tradition: Gesundheitsförderliche Organisationsgestaltung
- 3.1 Grundlagen
- 3.1.1 Organisationsgestaltung und Gesundheitsförderung
- 3.1.2 Ziele und Nutzen von Gesundheitsförderung
- 3.2 Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung
- 3.2.1 Maßnahmen der Verhaltensprävention
- 3.2.2 Maßnahmen der Verhältnisprävention
- 3.3 Gesundheitszirkel als praktische Gestaltungsmöglichkeit
- 4 Die angloamerikanische Tradition: Organizational Well-Being
- 4.1 Grundlagen
- 4.1.1 Merkmale einer 'gesunden' Organisation
- 4.1.2 Determinanten des Wohlbefindens
- 4.2 Arbeitszufriedenheit
- 4.2.1 Modell der Arbeitszufriedenheit
- 4.2.2 Auswirkungen von Arbeitsunzufriedenheit
- 4.3 'Empowerment' als organisatorische Gestaltungsmöglichkeit
- 5 Kritische Würdigung
- 6 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der organisationalen Entwicklungspfade und -richtungen, insbesondere im Kontext von Gesundheitsförderung und Organizational Well-Being. Ziel ist es, die Konzepte der Salutogenese und des Organizational Well-Being zu erläutern und deren Bedeutung für die Gestaltung gesundheitsförderlicher Organisationen zu beleuchten. Dabei werden sowohl die europäische als auch die angloamerikanische Tradition der Gesundheitsförderung im Unternehmenskontext betrachtet.
- Salutogenese und Organizational Well-Being als Konzepte für die Gestaltung gesundheitsförderlicher Organisationen
- Die Bedeutung von Arbeitsschutz, Betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
- Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung und deren praktische Umsetzung
- Determinanten des Wohlbefindens und deren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit
- Kritische Würdigung der Konzepte und deren Implikationen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der organisationalen Entwicklungspfade und -richtungen ein und stellt die Relevanz von Gesundheitsförderung und Organizational Well-Being im Unternehmenskontext dar. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe Salutogenese, Gesundheit und 'Well-Being' sowie Arbeitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention. Kapitel 3 beleuchtet die europäische Tradition der Gesundheitsförderung in Organisationen, wobei die Grundlagen, Instrumente und praktische Gestaltungsmöglichkeiten im Fokus stehen. Kapitel 4 widmet sich der angloamerikanischen Tradition des Organizational Well-Being, indem es die Merkmale einer 'gesunden' Organisation, die Determinanten des Wohlbefindens und die Bedeutung der Arbeitszufriedenheit beleuchtet. Kapitel 5 bietet eine kritische Würdigung der vorgestellten Konzepte und deren Implikationen für die Praxis. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Salutogenese, Organizational Well-Being, Gesundheitsförderung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz, Prävention, Organisationsgestaltung, Arbeitszufriedenheit, 'Empowerment', Determinanten des Wohlbefindens, kritische Würdigung und Implikationen für die Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen der europäischen und angloamerikanischen Tradition der Gesundheitsförderung?
Die europäische Tradition fokussiert auf die Arbeitsgestaltung (Verhältnisprävention), während die angloamerikanische Sicht das innere Wohlbefinden (Organizational Well-Being) betont.
Was versteht man unter „Salutogenese“?
Salutogenese ist ein Konzept, das sich mit der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit beschäftigt, anstatt sich nur auf Krankheiten zu konzentrieren.
Was sind Maßnahmen der Verhältnisprävention?
Dazu gehört die gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsumgebung, der Organisation und der Arbeitsabläufe selbst.
Welche Rolle spielt „Empowerment“ im Organizational Well-Being?
Empowerment dient als organisatorische Gestaltungsmöglichkeit, um Mitarbeitern mehr Handlungsspielraum und Eigenverantwortung zu geben, was das Wohlbefinden steigert.
Was ist ein Gesundheitszirkel?
Ein Instrument zur praktischen Umsetzung, bei dem Mitarbeiter gemeinsam Belastungen analysieren und Verbesserungsvorschläge für ihren Arbeitsplatz erarbeiten.
- Quote paper
- Kathrin Fritsch (Author), 2008, Gesundheitsförderliche Organisationsgestaltung und Organizational Well-Being, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130980