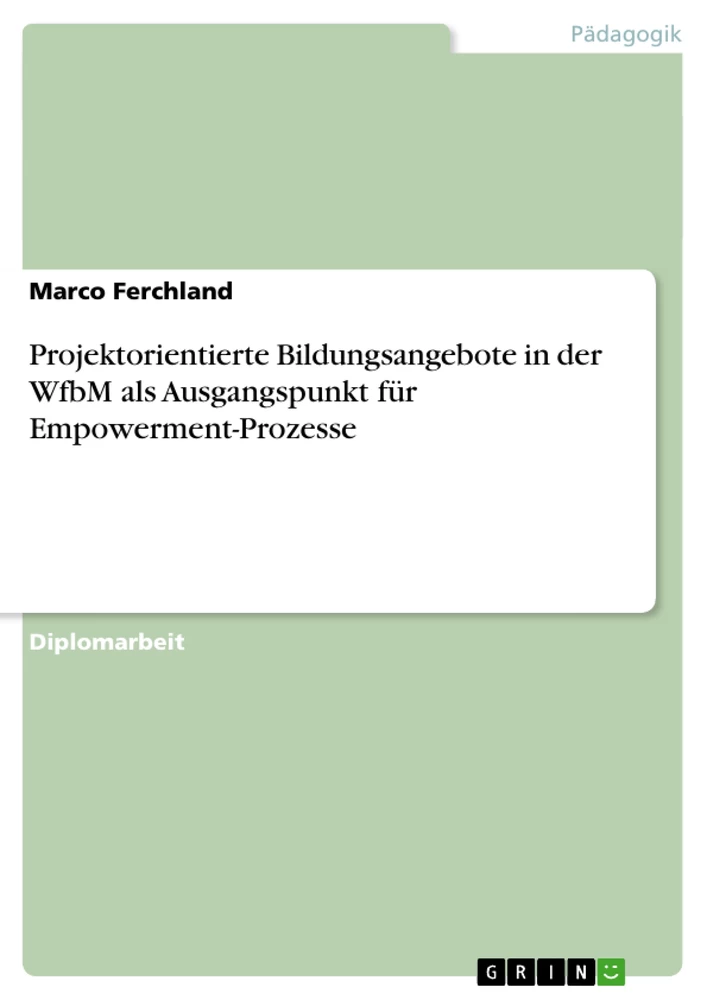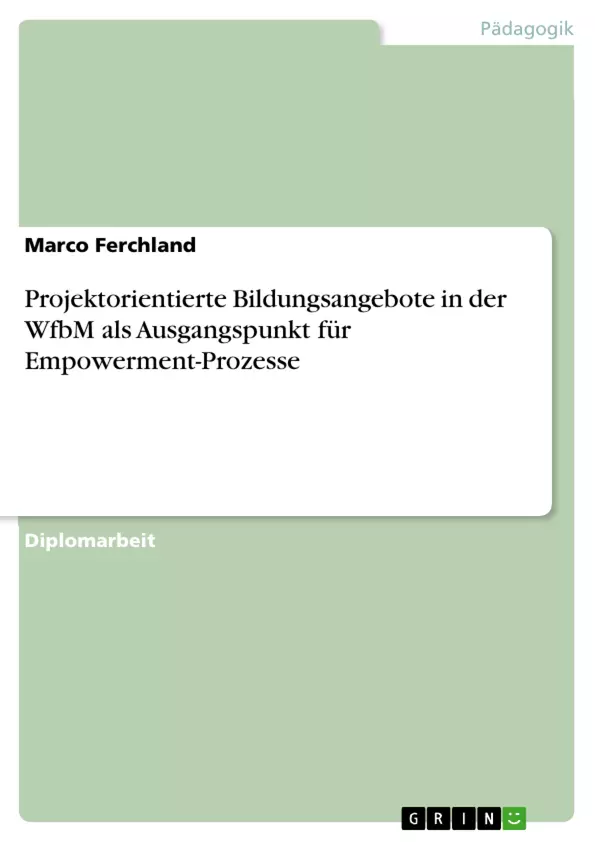Vor dem Hintergrund der heilpädagogischen Paradigmendiskussion werden in dieser Arbeit Fragen nach theoretischen und praxisrelevanten Erträgen des Empowerment-Konzepts für die WfbM untersucht.
Das Empowerment-Konzept wird im Kontext einer kritischer Bildungstheorie erörtert, die den emanzipativen Gehalt von Bildung hervorhebt und eine gesellschaftskritische sowie sozialpolitische Perspektive einnimmt. In diesem Zusammenhang wird die Frage nach dem Potential von Bildungsangeboten für die Initiierung von Empowerment-Prozessen im Umfeld der WfbM diskutiert: Die WfbM hat die Aufgabe, Menschen mit Behinderungen „angemessene berufliche Bildung“ (§ 136 Abs. 1 SGB IX; vgl. auch § 4 WVO) anzubieten und ihnen zu ermöglichen, „ihre Persönlichkeit weiter zu entwickeln“ (§ 136 Abs. 1 SGB IX; vgl. auch § 5 WVO), es wird daher untersucht, in welcher Form entsprechende Bildungsangebote in der WfbM ‚Kristallisationskeime‘ für Empowerment-Prozesse sein können.
Diese Arbeit versteht sich als ein praxisbezogener Beitrag zur heilpädagogischen Paradigmendiskussion im Umfeld der WfbM: Indem das grundlegende Bildungsverständnis der WfbM, das berufsqualifikations- und arbeitsmarktbezogene Aspekte betont und auf die Ausbildung funktionaler beruflicher Qualifikationen zielt (vgl. BA/BAG:WfbM 2002, 10ff), in Anschluss an die Bildungstheorie der kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft um den emanzipativen Gehalt von Bildung erweitert wird, eröffnen sich in Hinblick auf die Paradigmendiskussion Ansätze zur Weiterentwicklung der WfbM. Im Rahmen einer Empowerment-Praxis können Bildungsangebote als „lebensweltkritische Kategorie“ (Theunissen/Plaute 1995, 168) den behinderten Beschäftigten Erfahrungsräume für Selbstwirksamkeit und Gestaltungskraft i. S. v. Emanzipation, Selbstbestimmung und Mitbestimmung eröffnen und damit ‚Kristallisationskeime‘ für Empowerment-Prozesse sein, auch in einem weitgehend fremdbestimmten Umfeld wie der WfbM.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemaufriss
- Fragestellung, Thesen, Vorgehensweise, Zielsetzung
- Das Empowerment-Konzept
- Erste Annäherung
- Theoretische Verortung
- Empowerment im Sinne von Selbstbemächtigung
- Empowerment als professionelles Unterstützungskonzept
- Empowerment: Grundüberzeugungen/Menschenbild
- Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen
- Subjektzentrierte Ebene
- Gruppenbezogene Ebene
- Institutionelle Ebene
- Politische/Gesellschaftliche Ebene
- Empowerment und Bildung
- Zur Bedeutung des Bildungsbegriffs
- Bildung von Menschen mit Behinderung
- Empowerment-Konzept und Bildungstheorie
- Perspektiven für die Erwachsenenbildung
- Kritische Anmerkungen
- Konzeptionelle und begri iche Unschärfen
- Überforderung des Subjekts
- Fehleinschätzung von Fähigkeiten und Bedürfnissen
- Praktische Umsetzung unpräzisiert
- Unzureichende Re exion gesellschaftlicher Bedingungen
- Gesellschaftliche und politische Instrumentalisierung
- Zusammenfassung: Einschätzung und Bewertung
- Theoretische Verortung
- Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
- Historische Entwicklungslinien
- Das System der Behindertenhilfe in Deutschland
- Zur Entwicklung der WfbM
- Zur Bedeutung der WfbM
- WfbM und Bildung
- Überblick
- Beru iche Bildung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit
- Organisation von Bildung in WfbM
- Die WfbM als Ort von Empowerment
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Wunsch- und Wahlrecht
- Persönliches Budget
- Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)/Werkstattrat
- Zusammenfassung
- Historische Entwicklungslinien
- Das Projekt WerkstattZeitung
- Grundlagen
- Lebensweltbezug
- Projektorientierung
- Konzeption
- Beteiligte Institutionen
- Situationsbeschreibung
- Zielgruppe
- Ziele
- Die WerkstattZeitung: Empowerment-Prozesse
- Subjektzentrierte Ebene
- Gruppenbezogene Ebene
- Institutionelle Ebene und politische/gesellschaftliche Ebene
- Fazit
- Zur praktischen Umsetzung
- Perspektiven
- Grundlagen
- Schlussbetrachtungen
- Literaturverzeichnis
- Anhang WerkstattZeitung Nr. 1
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten von projektorientierten Bildungsangeboten in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) als Ausgangspunkt für Empowerment-Prozesse. Die Arbeit analysiert das Empowerment-Konzept und dessen Relevanz für die Bildung von Menschen mit Behinderung im Kontext der WfbM. Dabei werden die verschiedenen Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen sowie die Bedeutung von Bildung für die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung beleuchtet. Die Arbeit untersucht das Projekt "WerkstattZeitung" als Beispiel für ein projektorientiertes Bildungsangebot in einer WfbM und analysiert dessen Potenzial für Empowerment-Prozesse auf verschiedenen Ebenen.
- Empowerment-Konzept und dessen Relevanz für die Bildung von Menschen mit Behinderung
- Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen
- Die Rolle der WfbM als Ort von Empowerment
- Projektorientierte Bildungsangebote in der WfbM
- Das Projekt "WerkstattZeitung" als Beispiel für ein Empowerment-förderndes Bildungsangebot
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Diplomarbeit vor und erläutert die Problematik von Empowerment-Prozessen in der WfbM. Die Fragestellung, die Thesen, die Vorgehensweise und die Zielsetzung der Arbeit werden dargelegt. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Empowerment-Konzept. Es werden die theoretischen Grundlagen des Konzepts, die verschiedenen Ebenen und Elemente von Empowerment-Prozessen sowie die Bedeutung von Bildung für Empowerment-Prozesse erläutert. Das Kapitel beleuchtet auch kritische Anmerkungen zum Empowerment-Konzept und bietet eine Zusammenfassung und Bewertung des Konzepts. Das dritte Kapitel widmet sich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Es werden die historischen Entwicklungslinien der WfbM, die Bedeutung der WfbM für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Rolle der WfbM als Ort von Bildung und Empowerment beleuchtet. Das vierte Kapitel analysiert das Projekt "WerkstattZeitung" als Beispiel für ein projektorientiertes Bildungsangebot in einer WfbM. Es werden die Grundlagen des Projekts, die Konzeption und die Zielgruppe des Projekts sowie die Auswirkungen des Projekts auf Empowerment-Prozesse auf verschiedenen Ebenen dargestellt. Das Kapitel schließt mit einem Fazit zur praktischen Umsetzung des Projekts und den Perspektiven für die Zukunft. Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Empowerment, Bildung, Menschen mit Behinderung, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), projektorientierte Bildungsangebote, Selbstbestimmung, Teilhabe, Inklusion, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Werkstattrat, Persönliches Budget, Wunsch- und Wahlrecht, WerkstattZeitung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment im Kontext einer WfbM?
Empowerment bedeutet die Förderung von Selbstbemächtigung und Selbstbestimmung behinderter Menschen, damit sie ihre eigenen Angelegenheiten eigenmächtig gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Wie kann eine „WerkstattZeitung“ Empowerment-Prozesse fördern?
Das Projekt bietet einen Erfahrungsraum für Selbstwirksamkeit. Die Beschäftigten lernen, ihre Meinung zu artikulieren, Themen selbst zu wählen und Verantwortung für ein gemeinsames Produkt zu übernehmen.
Welche Aufgaben hat die WfbM laut SGB IX bezüglich Bildung?
Die Werkstatt muss eine angemessene berufliche Bildung anbieten und die Persönlichkeit der Beschäftigten weiterentwickeln, um deren Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder die Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern.
Was ist die Kritik am klassischen Bildungsverständnis der Werkstätten?
Es wird oft kritisiert, dass Bildung in Werkstätten zu stark auf rein funktionale berufliche Qualifikationen (Arbeitsleistung) reduziert wird und der emanzipative Gehalt der Persönlichkeitsentwicklung zu kurz kommt.
Welche Rolle spielt der Werkstattrat?
Der Werkstattrat ist das gesetzlich verankerte Mitwirkungsorgan der Beschäftigten. Er ist ein wichtiges Instrument des institutionellen Empowerments, um Mitbestimmung innerhalb der oft fremdbestimmten Werkstattstrukturen zu ermöglichen.
- Erste Annäherung
- Quote paper
- Marco Ferchland (Author), 2008, Projektorientierte Bildungsangebote in der WfbM als Ausgangspunkt für Empowerment-Prozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131065