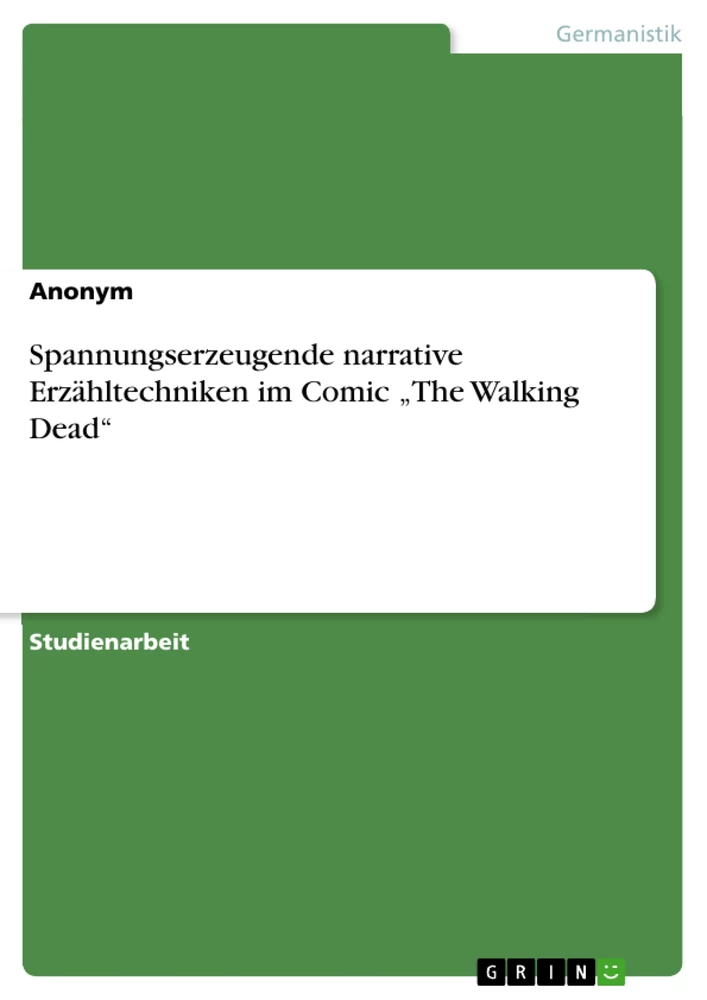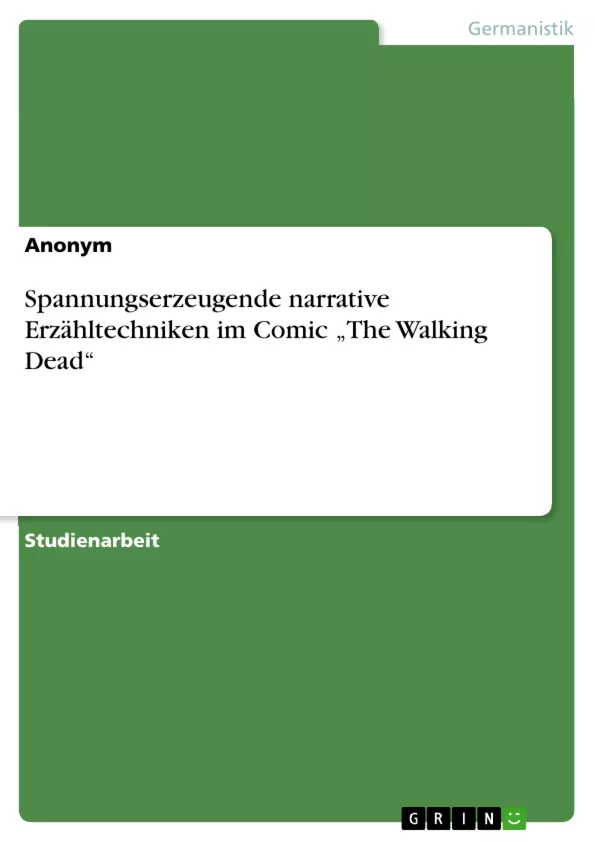Die Arbeit thematisiert die erzähltechnischen Mittel der Comicserie „The Walking Dead“, die für die Leserbindung und große Adaption der Serie mitverantwortlich sind. Analysiert werden textimmanente Elemente, die Spannung erzeugen. Bei der formalen Analyse der Comicserie richtet sich die Arbeit im Besonderen nach den Forschungserkenntnissen und Begriffsdefinitionen Vincent Fröhlichs, die er in seiner Monografie „Der Cliffhänger und die serielle Narration“ erarbeitet hat.
Die Arbeit konzentriert sich auf den ersten Band (#Issue 1-6) und damit auf den Anfang der Erzählung, da sich daran gut erkennen lässt, wie Kirkman seinen Comic konstruiert und Erzählunterbrechungen einsetzt, um den Rezipienten erstmalig in die Diegese einzuführen. Eine Besonderheit, die es zu analysieren gilt, ergibt sich aus der wandelnden Erzähltechnik, die sich aus der Anzahl an Handlungsträgern ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mikroanalyse.
- 3 Fazit.
- 2.1 Einordnung der Comicserie „The Walking Dead“.
- 2.2 Aufbau, Struktur.
- 2.3 Stil und Farbe
- 2.4 Medienspezifische Mikroanalyse der seriellen Narration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die erzähltechnischen Mittel der Comicserie „The Walking Dead", die für die Leserbindung und große Adaption der Serie mitverantwortlich sind. Das Ziel ist es, die Spannungserzeugung durch verschiedene Techniken der seriellen Narration, wie Komposition, Ansicht und Perspektive, zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf den ersten Band (#Issue 1-6) und den Anfang der Erzählung.
- Analyse der Spannungserzeugung durch erzähltechnische Mittel
- Untersuchung der seriellen Narration in „The Walking Dead“
- Einordnung der Comicserie in den Kontext der Horrorcomics
- Bedeutung des Cliffhangers als Erzähltechnik
- Die Rolle der wandelnden Erzähltechnik durch die Anzahl der Handlungsträger
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Comicserie „The Walking Dead“ und ihre Bedeutung in der Populärkultur vor. Sie skizziert das Thema der Arbeit und erläutert den theoretischen Ansatz, der sich auf die Forschungserkenntnisse von Vincent Fröhlich und Jakob F. Dittmar stützt.
Das Kapitel „Mikroanalyse“ beschäftigt sich mit der Einordnung der Comicserie „The Walking Dead“ in die Fortsetzungsnarration. Es werden die Merkmale der episodischen Wiederholung und der Fortsetzung erläutert und die Serie anhand dieser Kriterien eingeordnet.
Das Kapitel „Aufbau, Struktur“ analysiert die Struktur und den Aufbau der einzelnen Ausgaben von „The Walking Dead“. Es werden die verschiedenen Formen der Veröffentlichung beschrieben und die Gleichförmigkeit der Struktur der Ausgaben hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Comicserie, „The Walking Dead“, Spannungserzeugung, serielle Narration, Cliffhanger, Horrorcomic, Fortsetzungsnarration, Mikroanalyse, Erzähltechnik, Komposition, Ansicht, Perspektive.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Spannungserzeugende narrative Erzähltechniken im Comic „The Walking Dead“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311198