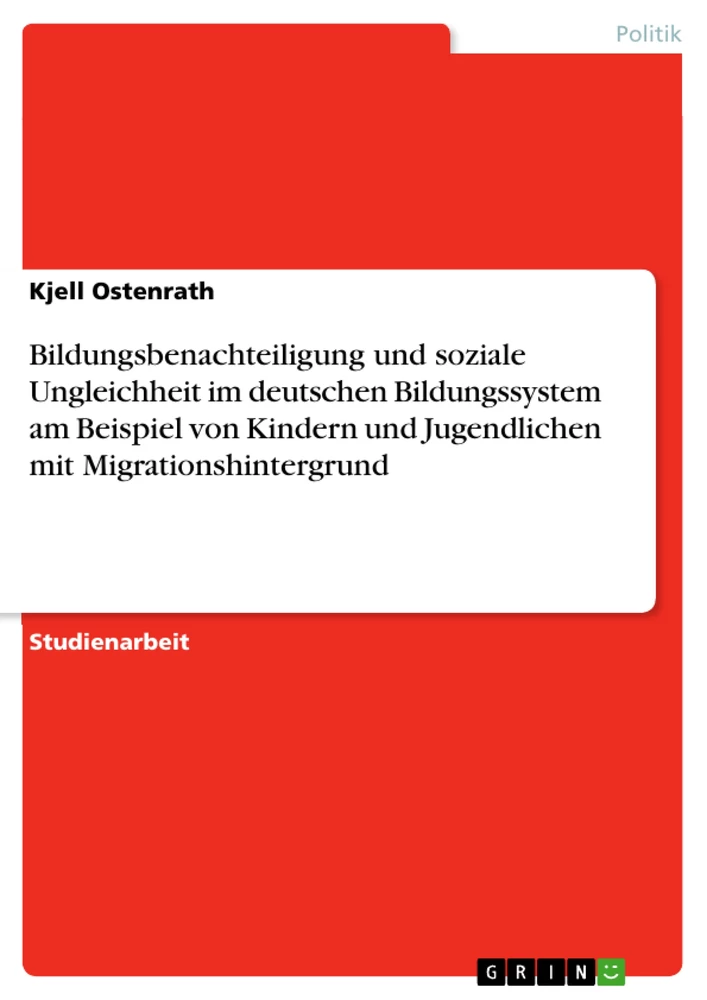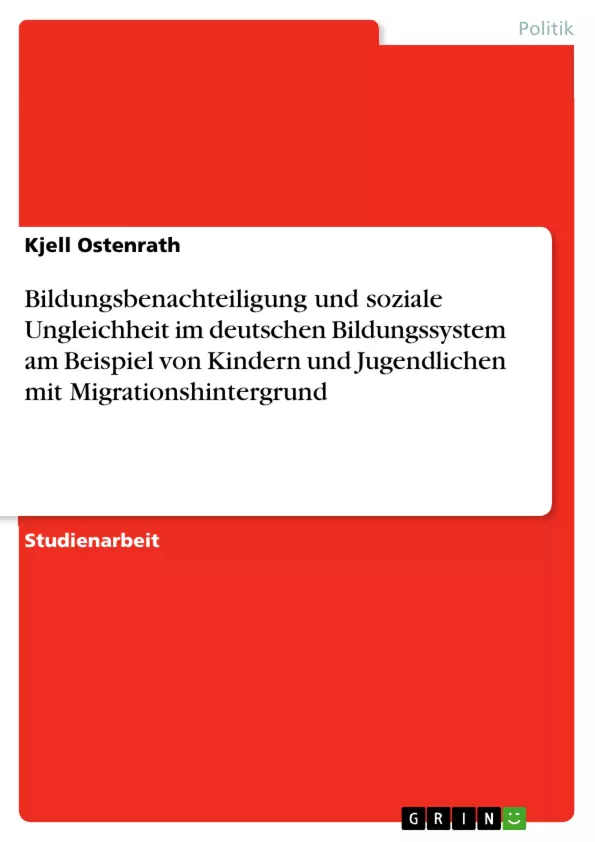In der vorliegenden Hausarbeit wird der Versuch unternommen, die Problematik der Bildungsgerechtigkeit bzw. der darin enthaltenen Termini von Bildungsbenachteiligung und sozialer Ungleichheiten - die es de facto im deutschen Bildungssystem gibt - an einem ausgewählten aktuellen Beispiel von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufzuzeigen. Dazu muss man zuerst die Begriffe von Bildungsbenachteiligung und sozialer Ungleichheit näher erläutern und definieren, und deren Zustandekommen hinterfragen.
Hierzu ist eine nähere Betrachtung der Begabungsunterschiede, der schichtspezifischen sozialen Einbettung und der ungerechtigkeitsfördernden Institutionen von Nöten, die diese ungleichheitsfördernden Effekte im Bildungswesen der BRD bei Migrantenkinder begünstigen. Im Anschluss daran werden für die Bearbeitung des Themas Zahlen und Daten herangezogen sowie die Stationen der sozialen Ungleichheit auf dem Bildungsweg der Migrantenkinder untersucht. Den Schluss der Hausarbeit bildet ein abschließendes Fazit mit einem Ausblick auf etwaige zukünftige Handlungsoptionen und Reformvorschläge, die dieser Bildungsbenachteiligung von Kinder mit Migrationshintergrund erfolgreich entgegenwirken können. Um der Hausarbeit ein wissenschaftliches Fundament zu geben, wird dazu auf Literatur des neueren Forschungsstandes zurückgegriffen. Den Leitfaden der Arbeit bildet das 2012 erschienene Werk von Anna Brake und Peter Büchner, die in ihrer Arbeit das deutsche Bildungswesen zu Bildung und sozialer Ungleichheit untersuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildung und soziale Ungleichheit
- 2.1 Begriffliche Klärungen
- 2.2 Bildungsungerechtigkeit und Bildungsungleichheit
- 2.3 Aspekte der bildungsbezogenen sozialen Benachteiligung
- 3. Erklärungsmodelle für das Zustandekommen von Bildungsungleichheiten
- 3.1 Schichtspezifische Sozialisation innerhalb der Gesellschaft
- 3.2 Institutionelle Diskriminierung
- 3.3 Ungleichheitsverstärkende Effekte innerhalb des Bildungssystems
- 4. Bildungsbenachteiligung am Beispiel von Migrantenkindern
- 4.1 Zur Bedeutung des Migrationshintergrunds
- 4.2 Zahlen und Daten zum Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund innerhalb des deutschen Bildungssystems
- 5. Stationen der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern
- 5.1 Vorschulische Bildung
- 5.2 Sitzenbleiber und Klassenwiederholer
- 5.3 Ursachen für migrationsspezifische Bildungsbenachteiligung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Problematik der Bildungsgerechtigkeit, der Bildungsbenachteiligung und der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem am Beispiel von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen dieser Ungleichheiten, analysiert die Rolle von institutionellen Faktoren und betrachtet die verschiedenen Stationen der Bildungsbenachteiligung im Lebenslauf von Migrantenkindern.
- Begriffliche Abgrenzung und Definition von Bildungsungerechtigkeit und Bildungsungleichheit
- Analyse der Erklärungsmodelle für das Zustandekommen von Bildungsungleichheiten im deutschen Bildungssystem
- Bewertung des Einflusses des Migrationshintergrunds auf die Bildungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen
- Untersuchung der Stationen der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem
- Zusammenfassende Betrachtung der Ursachen für migrationsspezifische Bildungsbenachteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsgerechtigkeit und der sozialen Ungleichheit ein und beleuchtet die historische Entwicklung und Relevanz dieser Themenbereiche.
- Kapitel 2: Bildung und soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel widmet sich der begrifflichen Klärung der zentralen Begriffe Bildungsungerechtigkeit, Bildungsungleichheit und soziale Benachteiligung. Es untersucht die verschiedenen Formen und Dimensionen dieser Ungleichheiten und beleuchtet die Verbindung zwischen Bildung und sozialem Kapital.
- Kapitel 3: Erklärungsmodelle für das Zustandekommen von Bildungsungleichheiten: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Erklärungsmodelle, die das Zustandekommen von Bildungsungleichheiten im deutschen Bildungssystem beleuchten. Es betrachtet die Rolle der schichtspezifischen Sozialisation, der institutionellen Diskriminierung und der ungleichheitsverstärkenden Effekte innerhalb des Bildungssystems.
- Kapitel 4: Bildungsbenachteiligung am Beispiel von Migrantenkindern: Dieses Kapitel betrachtet das Problem der Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es beleuchtet die Bedeutung des Migrationshintergrunds im Kontext der Bildungsungleichheit und analysiert die Daten zum Anteil von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem.
- Kapitel 5: Stationen der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Stationen der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem. Es betrachtet die Situation in der vorschulischen Bildung, die Problematik von Sitzenbleiben und Klassenwiederholungen sowie die Ursachen für migrationsspezifische Bildungsbenachteiligung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Hausarbeit sind Bildungsbenachteiligung, soziale Ungleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Migrationshintergrund, deutsche Bildungssystem, Schichtspezifische Sozialisation, institutionelle Diskriminierung, und Ursachenanalyse.
- Citation du texte
- Kjell Ostenrath (Auteur), 2013, Bildungsbenachteiligung und soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem am Beispiel von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311590