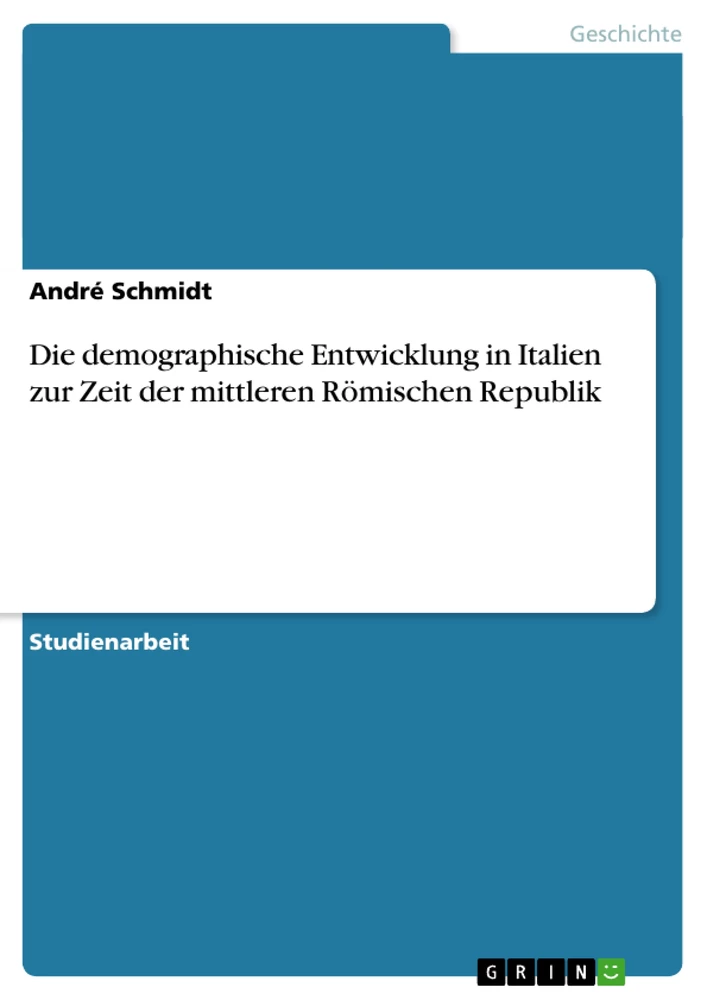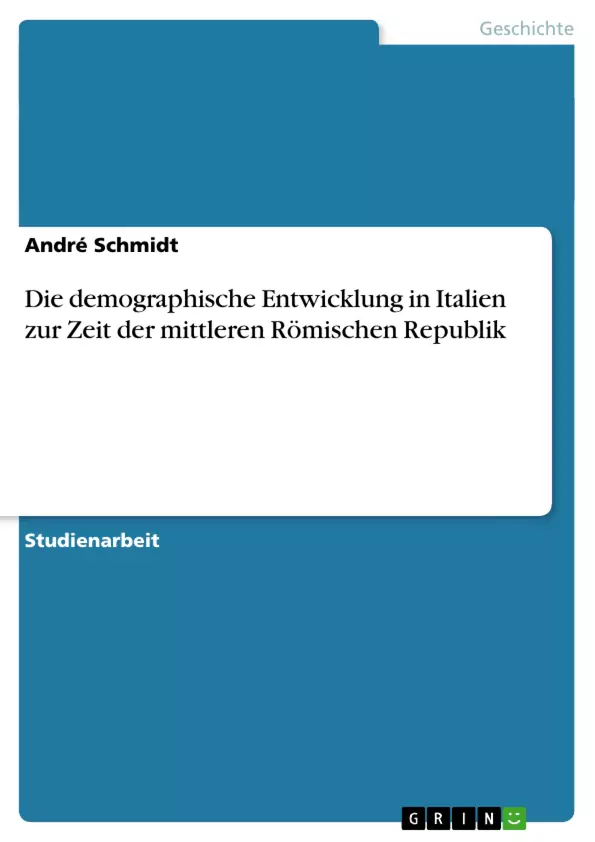In dieser Seminararbeit soll anhand von ausgewählten Quellen von POLYBIOS und LIVIUS sowie Monographien verschiedener Autoren wie CHRIST, BLEICKEN sowie DE MARTINO und LO CASCIO die demographische Entwicklung in Italien zur Zeit der mittleren Römischen Republik näher betrachtet werden. Dabei wird anfangs für ein besseres Verständnis die Thematik auch in einen kurzen sozioökonomischen Kontext eingegliedert. Des Weiteren soll ein Schwerpunkt dieser Arbeit auf eine überblicksartige Darlegung der römischen Expansion im 3. u. 2. Jh. v. Chr. sowie deren ökonomische Nachwirkungen gelegt werden. Ein Hauptaugenmerk wird dabei der Fragestellung gewidmet sein, welche gesellschaftlichen Rückwirkungen sich aus der römischen Expansion besonders in Italien entwickelt haben. Im Speziellen soll dabei die umfassende Veränderung der römischen Wirtschaftsstruktur herausgearbeitet werden, indem auch der Frage nach den inneren Problemen, die dem römischen Staat aus seiner Expansion erwachsen sollten, nachgegangen werden soll. Es wird versucht einige Antworten für die Fragen nach der Begründung und dem Untergang der Römischen Republik, der Veränderung der Besitzverhältnisse, dem Stand und den Möglichkeiten der Ernährung, der Entwicklung des Lebensstandards sowie der sozialen Bedeutung der Armen und der an die Randzonen der römischen Gesellschaft Gedrängten zu finden.
Als wissenschaftliche Grundlagen zur Klärung dieser Fragen dienen als primäre Quellen unter anderem die schriftlichen Überlieferungen der antiken Historiker POLYBIOS und LIVIUS sowie des Autors PLUTARCH. Neben Aufsätzen wie „Tiberius und Gaius Gracchus – und Cornelia: Die res publica zwischen Aristokratie, Demokratie und Tyrannis“ von Kai BRODERSEN wird aber auch Sekundärliteratur, wie die Monographien Karl CHRISTs, „Krise und Untergang der Römischen Republik“, „Die Verfassung der Römischen Republik“ des Autors Jochen BLEICKEN sowie die Abhandlung „Wirtschaftsgeschichte des alten Rom“ von Francesco DE MARTINO hierfür herangezogen, um die Untersuchungen anderer Fachleute sowie den Forschungsstand mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangssituation in der frühen Republik
- Die Gliederung der römischen Gesellschaft
- Die Wirtschaftssituation vor den Punischen Kriegen
- Exkurs: Die römische Expansion im 3. u. 2. Jh. v. Chr.
- Rom und Karthago
- Rom und die hellenistische Welt
- Der Strom materieller Werte nach Italien
- Die gesellschaftliche Rückwirkung der Expansion
- Die Veränderung der Wirtschaftsstruktur
- Latifundia - der landwirtschaftliche Großbetrieb
- Das schwere Los der italischen Bauern
- Das Ende des inneren Friedens
- Die Proletarisierung der römischen Bevölkerung
- Die Verelendung der Stadtbevölkerung
- Der Reformversuch der Gracchen
- Schlussbemerkung
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der demographischen Entwicklung in Italien während der mittleren Römischen Republik. Sie analysiert die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der römischen Expansion auf die Gesellschaft, insbesondere auf die Wirtschaftsstruktur und die Lebensbedingungen der Bevölkerung. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen der Proletarisierung und Verelendung der römischen Bevölkerung sowie die Reformversuche der Gracchen.
- Die demographische Entwicklung in Italien während der mittleren Römischen Republik
- Die Auswirkungen der römischen Expansion auf die Gesellschaft
- Die Veränderung der Wirtschaftsstruktur und die Entstehung von Latifundien
- Die Proletarisierung und Verelendung der römischen Bevölkerung
- Die Reformversuche der Gracchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die verwendeten Quellen und Forschungsliteratur. Das zweite Kapitel beschreibt die Ausgangssituation in der frühen Republik, einschließlich der Gliederung der römischen Gesellschaft und der Wirtschaftssituation vor den Punischen Kriegen. Der Exkurs im dritten Kapitel beleuchtet die römische Expansion im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr., insbesondere die Konflikte mit Karthago und die Beziehungen zur hellenistischen Welt. Das vierte Kapitel analysiert den Einfluss der Expansion auf den Strom materieller Werte nach Italien. Das fünfte Kapitel untersucht die gesellschaftlichen Rückwirkungen der Expansion, insbesondere die Veränderung der Wirtschaftsstruktur, die Entstehung von Latifundien und die Folgen für die italischen Bauern. Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Ende des inneren Friedens, der Proletarisierung der römischen Bevölkerung, der Verelendung der Stadtbevölkerung und den Reformversuchen der Gracchen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die demographische Entwicklung, die römische Expansion, die Wirtschaftsstruktur, die Latifundien, die Proletarisierung, die Verelendung, die Reformversuche der Gracchen, die römische Gesellschaft, die soziale Ungleichheit und die politische Instabilität in der mittleren Römischen Republik.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte die römische Expansion die Wirtschaft Italiens?
Die Expansion im 3. und 2. Jh. v. Chr. führte zu einem massiven Zustrom von Sklaven und Reichtümern, was die Entstehung von landwirtschaftlichen Großbetrieben (Latifundien) begünstigte.
Warum litten die italischen Bauern unter der Expansion?
Kleine Bauern konnten nicht mit den billigen, von Sklaven produzierten Waren der Latifundien konkurrieren und wurden oft durch lange Militärdienste von ihren Höfen entfremdet.
Was war das Ziel der Reformen der Gracchen?
Tiberius und Gaius Gracchus versuchten, durch Landreformen den besitzlosen Bürgern (Proletariern) wieder Ackerland zuzuweisen und so die soziale Krise zu entschärfen.
Was versteht man unter der Proletarisierung der Bevölkerung?
Es beschreibt den Prozess, bei dem freie Bauern ihr Land verloren und in die Städte (vor allem Rom) abwanderten, wo sie als besitzlose Klasse unter prekären Bedingungen lebten.
Welche antiken Quellen sind für die Erforschung dieser Zeit wichtig?
Die Schriften der Historiker Polybios, Livius und Plutarch bieten zentrale Einblicke in die demographischen und politischen Entwicklungen der mittleren Republik.
- Quote paper
- André Schmidt (Author), 2006, Die demographische Entwicklung in Italien zur Zeit der mittleren Römischen Republik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131231