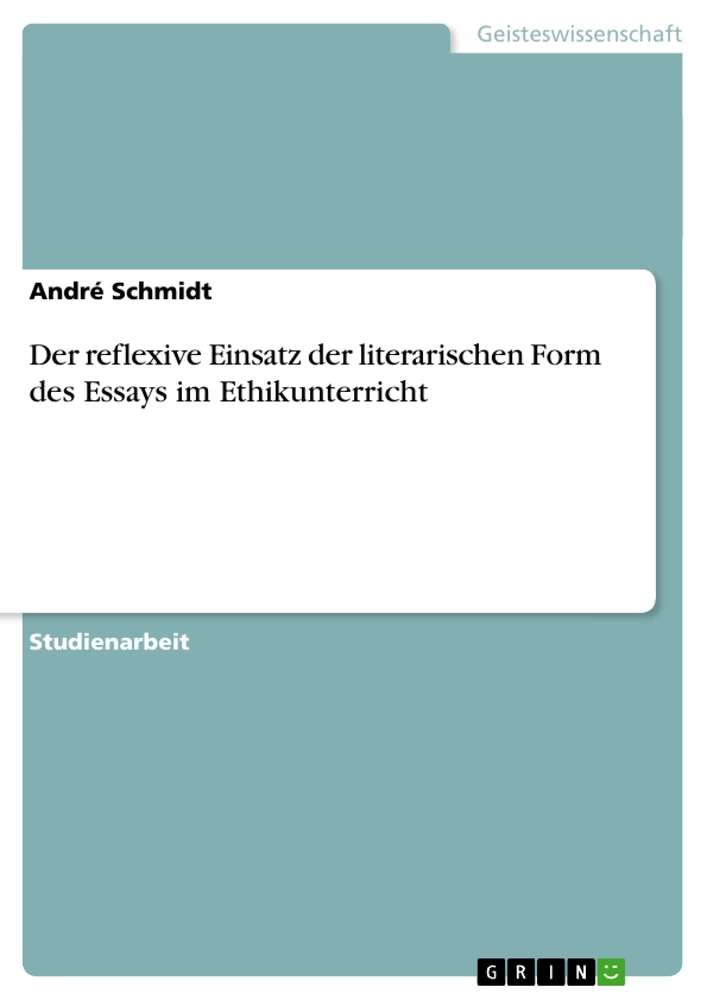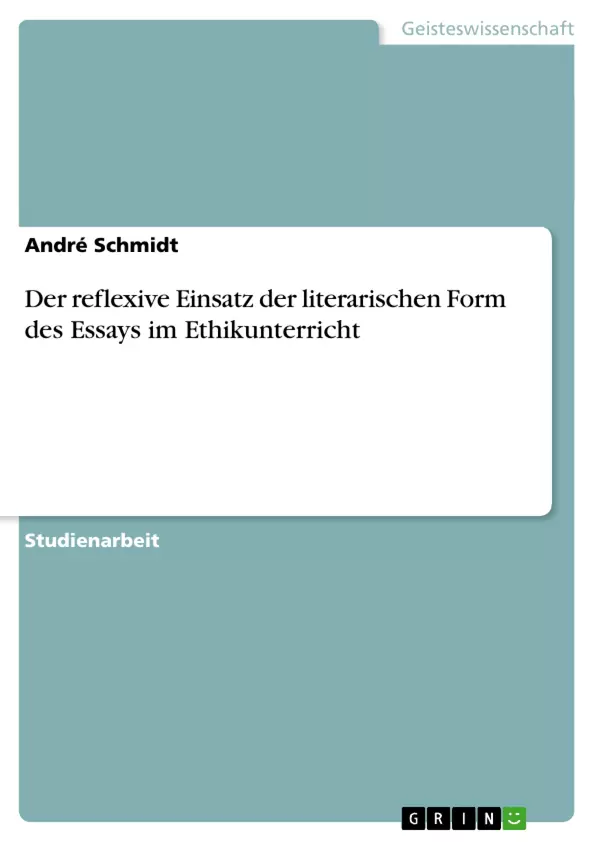In dieser Seminararbeit sollen anhand von ausgewählten Texten verschiedener Autoren, wie BELKE, MARTINICH und MÜLLER-FUNK die unterschiedlichen Vorstellungen und Konzeptionen von der wichtigen literarischen Form des Essays im Hinblick auf ihre praktische Funktion in der Anwendung näher betrachtet werden. Dabei werden neben einer Klassifizierung und Beschreibung der etablierten Gebrauchsform nach ihrer dominanten wertenden und prüfenden Funktion auch die untergründige argumentative und methodische Wirkung verdeutlicht. Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll auf der Herausarbeitung der Multifunktionalität dieses literarischen Elements im pragmatischen Gebrauch nach seinen Inhalten, Anwendungen und Zielstellungen gelegt werden. Das Hauptaugenmerk wird dabei der Fragestellung gewidmet sein, inwiefern die Arbeit mit dem Essay im Philosophie- und Ethikunterricht fruchtbar sein kann und welche didaktischen Potentiale dieser literarischen Form entnommen werden können. Im Speziellen soll eine Untersuchung in Bezug auf das eigenständige schriftliche Philosophieren unternommen werden, indem auch der Frage nach der Analyse sowie der Bewertung der sprachlichen, stilistischen und formalen Bedingungen nachgegangen werden soll.
Als wissenschaftliche Grundlagen zur Klärung dieser Fragen dienen unter anderem die statistischen Erhebungen aus dem Werk “Erfahrung und Experiment. Studien zu Theorie und Geschichte des Essayismus“ des Autors Wolfgang MÜLLER-FUNK. Aber auch Sekundärliteratur, wie die Monographien Horst BELKEs, „Literarische Gebrauchsformen“, „Der deutsche Essay – Materialien zur Geschichte und Ästhetik einer literarischen Gattung“ von Ludwig ROHNER sowie die englische Abhandlung „Philosophical writing – an introduction“ von Aloysius P. MARTINICH werden hierfür herangezogen, um die Untersuchungen anderer Fachleute sowie den Forschungsstand mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literarische Formen philosophischer Texte
- Philosophie in der Literatur
- Literatur in der Philosophie
- Marginale Gattungen
- Die Literarische Form des Essays
- Die gesellschaftliche Funktion
- Der subjektive Prozess des Urteilens
- Erfahrung und Experiment
- Eine kritische Kategorie des eigenen Geistes
- Das didaktische Potential des Essays
- Die doppelt kodierte Bewertung eines Essays
- Sprachliche und stilistische Anforderungen
- Formale und strukturelle Anforderungen
- Schlussbemerkung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der literarischen Form des Essays und untersucht dessen praktische Funktion im Ethikunterricht. Sie analysiert die unterschiedlichen Vorstellungen und Konzeptionen des Essays, wobei der Schwerpunkt auf der Herausarbeitung der Multifunktionalität dieses literarischen Elements im pragmatischen Gebrauch liegt. Die Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern der Essay im Philosophie- und Ethikunterricht fruchtbar sein kann und welche didaktischen Potentiale er bietet. Insbesondere wird die Analyse und Bewertung der sprachlichen, stilistischen und formalen Bedingungen des Essays im Kontext des eigenständigen schriftlichen Philosophierens untersucht.
- Klassifizierung und Beschreibung der etablierten Gebrauchsform des Essays
- Verdeutlichung der argumentativen und methodischen Wirkung des Essays
- Didaktisches Potential des Essays im Philosophie- und Ethikunterricht
- Analyse und Bewertung der sprachlichen, stilistischen und formalen Bedingungen des Essays
- Eigenständiges schriftliches Philosophieren im Kontext des Essays
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der praktischen Funktion des Essays im Ethikunterricht. Sie erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit sowie die verwendeten wissenschaftlichen Grundlagen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit literarischen Formen philosophischer Texte. Es werden verschiedene Gattungen wie Monologe, Dialoge, Briefe, Fabeln und Erzählungen vorgestellt und deren didaktische Vorteile im Unterricht erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der philosophischen Intension der jeweiligen Literatur und deren Verknüpfung mit der Lebenswelt der Schüler.
Das dritte Kapitel widmet sich der literarischen Form des Essays. Es werden die gesellschaftliche Funktion, der subjektive Prozess des Urteilens, die Rolle von Erfahrung und Experiment sowie die kritische Kategorie des eigenen Geistes im Kontext des Essays beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht das didaktische Potential des Essays im Ethikunterricht. Es werden die Möglichkeiten des Essays zur Förderung des eigenständigen schriftlichen Philosophierens und zur Vermittlung philosophischer Inhalte diskutiert.
Das fünfte Kapitel analysiert die Bewertung eines Essays anhand sprachlicher, stilistischer und formaler Anforderungen. Es werden Kriterien für die Beurteilung von Essays im Unterricht vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Essay, die literarische Form, den Ethikunterricht, die Philosophie, die Didaktik, die argumentative und methodische Funktion, das didaktische Potential, die sprachlichen, stilistischen und formalen Anforderungen, das eigenständige schriftliche Philosophieren.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die literarische Form des Essays aus?
Der Essay ist eine prüfende und wertende Form des Schreibens, die durch einen subjektiven Prozess des Urteilens, Experimentierfreude und eine kritische Auseinandersetzung mit einem Thema gekennzeichnet ist.
Warum ist der Essay für den Ethikunterricht geeignet?
Er fördert das eigenständige schriftliche Philosophieren, ermöglicht Schülern ihre eigene Meinung methodisch zu begründen und schlägt eine Brücke zwischen Literatur und Philosophie.
Welche didaktischen Potenziale bietet das Essay-Schreiben?
Es schult die Argumentationsfähigkeit, fördert die Reflexion über den eigenen Geist und hilft Schülern, komplexe ethische Probleme in Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt zu setzen.
Nach welchen Kriterien wird ein philosophischer Essay bewertet?
Die Bewertung erfolgt doppelt kodiert: Einerseits werden sprachliche und stilistische Anforderungen geprüft, andererseits die formalen und strukturellen Bedingungen sowie die Tiefe der Argumentation.
Welche anderen literarischen Formen sind im Philosophieunterricht relevant?
Neben dem Essay werden auch Dialoge, Monologe, Briefe, Fabeln und Erzählungen genutzt, um philosophische Inhalte anschaulich zu vermitteln.
- Quote paper
- André Schmidt (Author), 2006, Der reflexive Einsatz der literarischen Form des Essays im Ethikunterricht , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131235