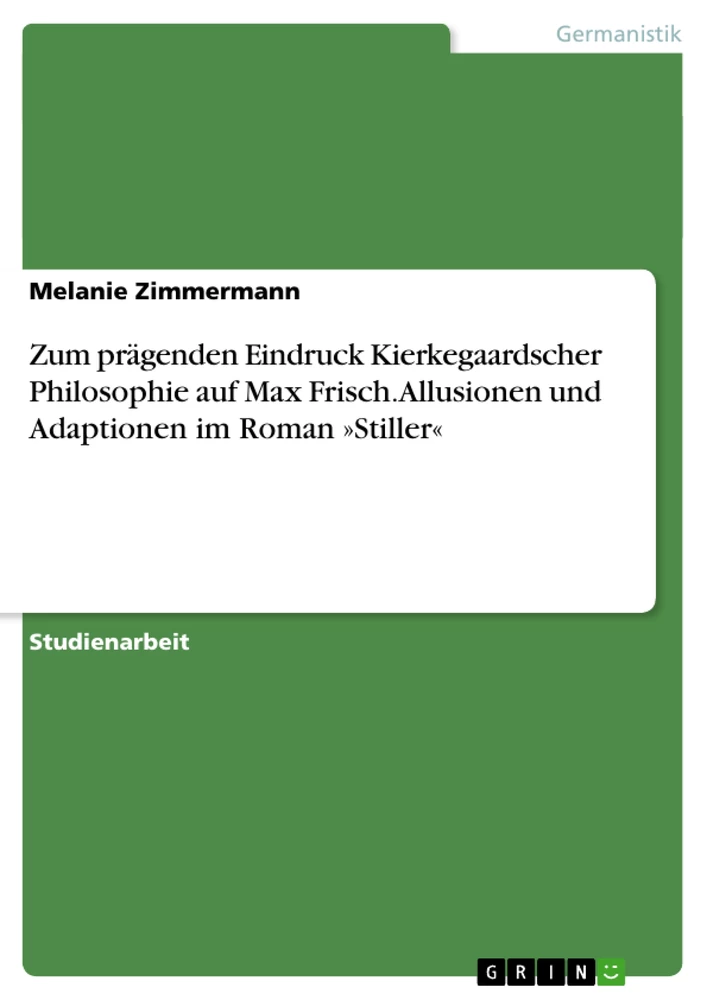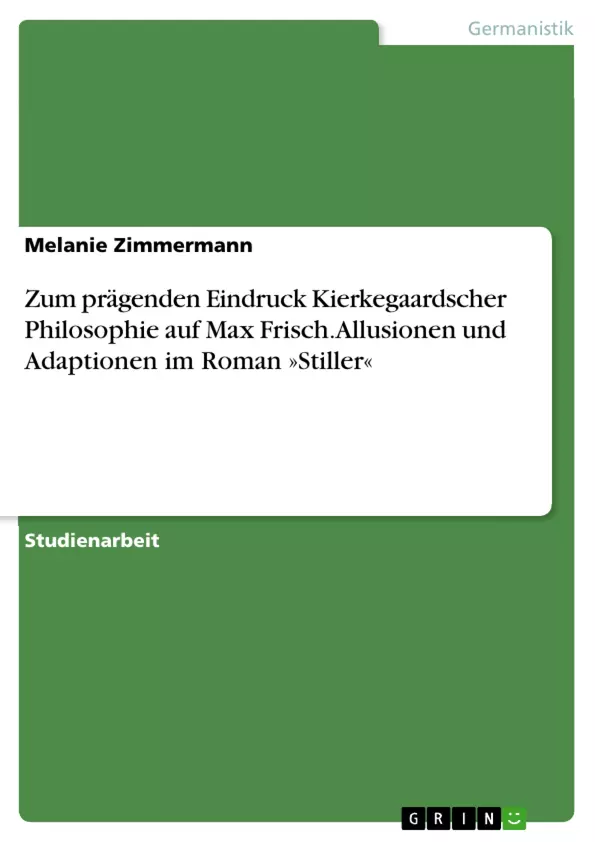»Geist beginnt mit Fragen: Fragen ist vorerst eine Verweigerung gegenüber dem Bestehenden, das sich für die Antwort hält«1, notiert Max Frisch (1911–1991), und in seinem Tagebuch findet sich der Ausspruch Hendrik Ibsens: »Zu fragen bin ich da, nicht zu antworten.«2 Eine zentrale Frage, die sein Schreiben begleitet und seinen Werken innewohnt, scheint die Frage Wer bin ich? zu sein. Vor allem im Roman Stiller (1954), in dem der Bildhauer gleichen Namens aus seiner Identität auszubrechen – Ich bin nicht Stiller! – versucht, wird diese Thematik deutlich, aber auch in Frischs anderen Werken: So setzt beispielsweise Gantenbein (1964) sich, sein Leben, in den Konjunktiv, versucht sich neu zu erfinden, probiert Geschichten an wie Kleider und stellt sich vor, wie seine Geschichte anders hätte ablaufen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dispositionen: Frisch und Kierkegaard
- Allusionen und Adaptionen Kierkegaardscher Kategorien im Stiller
- Das Gefängnis ist nur in mir
- Das Selbst und das Andere
- Die Frage nach der Therapie
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Philosophie Søren Kierkegaards auf das Werk Max Frischs, insbesondere auf dessen Roman „Stiller“. Ziel ist es, die Parallelen im Denken beider Autoren aufzuzeigen und die expliziten und impliziten Adaptionen kierkegaardscher Kategorien in „Stiller“ zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet, wie Frisch Kierkegaards existenzphilosophische Konzepte in seiner Erzählweise verarbeitet.
- Die Frage nach der Identität in Frischs Werk
- Parallelen zwischen dem Denken Frischs und Kierkegaards
- Adaption kierkegaardscher Kategorien in „Stiller“
- Die Entwicklung der Figur Stiller im Kontext der Kierkegaard'schen Philosophie
- Theologische und philosophische Aspekte in „Stiller“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die zentrale Frage nach der Identität in Max Frischs Werk, besonders in "Stiller". Sie stellt die bisherigen Forschungsansätze zur Rolle Kierkegaards in Frischs Roman vor und hebt die Diskrepanzen in den Interpretationen hervor. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Stiller-Kierkegaard und skizziert den methodischen Ansatz.
Dispositionen: Frisch und Kierkegaard: Dieses Kapitel vergleicht die Gedankenwelten von Max Frisch und Søren Kierkegaard, indem es anhand verschiedener Aufzeichnungen beider Autoren Gemeinsamkeiten in ihren Ansichten zu Identität und Lebensweise aufzeigt. Es legt die Basis für die Argumentation, dass eine Affinität Frischs zur Philosophie Kierkegaards existiert, welche die Adaptionen in "Stiller" erklärt. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung von parallelen Denkweisen, welche die spätere Analyse der Einflüsse auf "Stiller" fundieren.
Allusionen und Adaptionen Kierkegaardscher Kategorien im Stiller: Dieses Kapitel analysiert die konkrete Umsetzung kierkegaardscher Kategorien im Roman "Stiller". Es untersucht, wie Frisch Kierkegaards Ideen in die Erzählstruktur und die Charakterentwicklung integriert. Die Unterkapitel betrachten spezifische Aspekte wie Stillers "Gefängnis", das Verhältnis von Selbst und Anderem und die Frage nach therapeutischen Ansätzen. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Interpretationsebenen und zeigt auf, wie die philosophischen Konzepte in narrative Elemente übersetzt wurden.
Schlüsselwörter
Max Frisch, Søren Kierkegaard, Stiller, Identität, Existenzphilosophie, Selbstfindung, Identitätskrise, Allusion, Adaption, Theologie, Philosophie, Romananalyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Einfluss von Kierkegaard auf Max Frischs "Stiller"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Philosophie Søren Kierkegaards auf Max Frischs Roman „Stiller“. Sie analysiert Parallelen im Denken beider Autoren und die expliziten und impliziten Adaptionen kierkegaardscher Kategorien in „Stiller“. Ein Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung, wie Frisch Kierkegaards existenzphilosophische Konzepte in seine Erzählweise integriert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Frage nach der Identität in Frischs Werk, Parallelen zwischen dem Denken Frischs und Kierkegaards, die Adaption kierkegaardscher Kategorien in „Stiller“, die Entwicklung der Figur Stiller im Kontext der Kierkegaard'schen Philosophie und theologische sowie philosophische Aspekte in „Stiller“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich der Dispositionen von Frisch und Kierkegaard, ein Kapitel zur Analyse der Allusionen und Adaptionen kierkegaardscher Kategorien in "Stiller" (mit Unterkapiteln zu Stillers "Gefängnis", dem Verhältnis von Selbst und Anderem und der Frage nach therapeutischen Ansätzen) und ein Resümee.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die zentrale Frage nach der Identität in "Stiller", stellt bisherige Forschungsansätze vor, hebt Diskrepanzen in den Interpretationen hervor und begründet die Notwendigkeit einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Stiller-Kierkegaard. Sie skizziert auch den methodischen Ansatz der Arbeit.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Dispositionen: Frisch und Kierkegaard"?
Dieses Kapitel vergleicht die Gedankenwelten von Frisch und Kierkegaard anhand verschiedener Aufzeichnungen, um Gemeinsamkeiten in ihren Ansichten zu Identität und Lebensweise aufzuzeigen. Es legt die Basis für die Argumentation einer Affinität Frischs zur Philosophie Kierkegaards, die die Adaptionen in "Stiller" erklärt. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung paralleler Denkweisen.
Was wird im Kapitel "Allusionen und Adaptionen Kierkegaardscher Kategorien im Stiller" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die konkrete Umsetzung kierkegaardscher Kategorien in "Stiller". Es untersucht die Integration von Kierkegaards Ideen in die Erzählstruktur und die Charakterentwicklung. Die Unterkapitel betrachten spezifische Aspekte wie Stillers "Gefängnis", das Verhältnis von Selbst und Anderem und die Frage nach therapeutischen Ansätzen. Es beleuchtet verschiedene Interpretationsebenen und die Übersetzung philosophischer Konzepte in narrative Elemente.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Max Frisch, Søren Kierkegaard, Stiller, Identität, Existenzphilosophie, Selbstfindung, Identitätskrise, Allusion, Adaption, Theologie, Philosophie, Romananalyse.
- Citation du texte
- Melanie Zimmermann (Auteur), 2009, Zum prägenden Eindruck Kierkegaardscher Philosophie auf Max Frisch. Allusionen und Adaptionen im Roman »Stiller«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131288