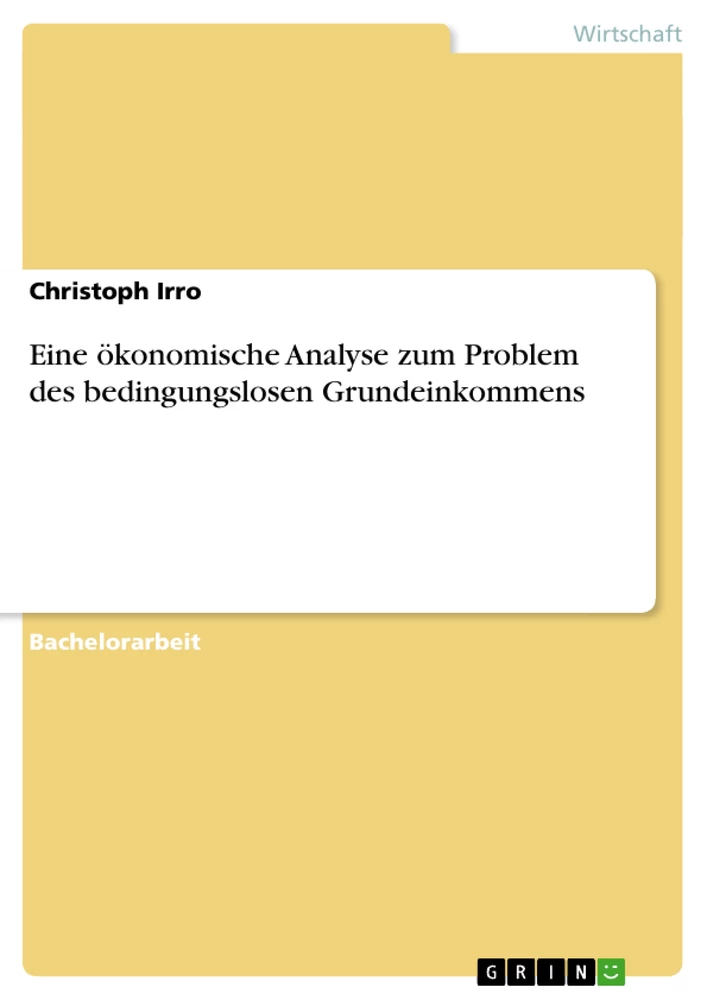Ein Grundeinkommen: für alle, bedingungslos und weit über dem Subsistenzminimum - auf den ersten Blick klingt das unrealistisch und unbezahlbar. Ein Wort beschreibt diesen Zustand aber zutreffender: utopisch. Die Entstehung dieses Wortes geht auf den Roman 'Utopia' von Thomas Morus zurück, in dem ein Volk beschrieben wird, das keinen Geiz und keinen Neid kennt - und das aus einfachem Grund: es gibt dort kein Eigentum.
In den letzten Jahren nahm die Diskussion um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu. Ein Grund für das Aufflammen der Diskussion war nicht zuletzt die steigende Arbeitslosigkeit und der damit verbundene gesellschaftliche Abstieg. Gerade in den neuen Bundesländern, in denen seit der Wiedervereinigung ein Drittel aller Arbeitsplätze verloren gingen, ist genau dies das Hauptproblem.
Der Hauptgrund in der gestiegenen Arbeitslosigkeit ist auf die erhöhte Produktivität in Deutschland zurückzuführen. Insgesamt ist jedoch der Wohlstand gestiegen. Entscheidend ist nun, wie genau dieser Wohlstand verteilt werden soll. Das bedingungslose Grundeinkommen ist davon nur eine von vielen Möglichkeiten.
Ziel der Arbeit ist es, zuerst den historischen Hintergrund zu vermitteln und aufzuzeigen, woher die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens kommt. Anschließend wird auf einige verschiedene Modelle des Grundeinkommens näher eingegangen. Der Focus liegt auf Umsetzungsmöglichkeiten, die zurzeit in Politik und der Öffentlichkeit Anklang finden. Danach werden einige Beispiele aus der Praxis vorgestellt, die veranschaulichen sollen, wie Realisierungen des Konzeptes eines bedingungslosen Grundeinkommens aussehen könnten. Dabei wird explizit auch auf die aktuelle Diskussion in der Europapolitik eingegangen. Danach ist das Konzept von Götz Werner Gegenstand der Betrachtung. Es soll in einem volkswirtschaftlichen Modell analysiert werden, um die Einflüsse auf die Bürger offenzulegen. Dem schließt sich eine kritische Würdigung an, in der Vor- und Nachteile des bedingungslosen Grundeinkommens gegenübergestellt werden sollen. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Zielstellung der Arbeit
- Historische Betrachtung
- Gerechtigkeit
- Gedanke der Grundsicherung (Antike bis Renaissance)
- Vorläufer des Grundeinkommens
- Thomas Morus
- Juan Luis Vives
- Marquis de Condorcet
- Vordenker des Grundeinkommens
- Thomas Paine
- Thomas Spence
- Charles Fourier
- Joseph Charlier
- John Stuart Mill
- Ansätze im 20. Jahrhundert
- Kritische Würdigung der ersten Denker
- Neue Ideen staatlicher Grundsicherung
- Bedingungsloses Grundeinkommen
- Negative Einkommensteuer
- Solidarisches Bürgergeld
- Lohnauffüllung / Kombilohn
- Participation Income
- Zusammenfassung
- Umsetzungen eines Grundeinkommens
- Alaska
- Brasilien
- Aktuelle Diskussion in der Europapolitik
- Modell
- Kritische Würdigung
- Das Grundeinkommen als Armenhilfe
- Bedeutung für das Steuersystem
- Einfluss auf die Bildung
- Veränderung des Arbeitslebens
- Einfluss auf die freie Entfaltung
- Politische Umsetzbarkeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Modellierung der Formeln aus Kapitel 5
- Modellrechnung mit veränderter Wohlfahrtsfunktion
- Internetquellen
- Alaska Permanent Fund
- Präsentation des solidarischen Bürgergeldes
- Entbürokratisierungseffekt des soldidarischen Bürgergeldes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit einer ökonomischen Analyse des bedingungslosen Grundeinkommens. Ziel der Arbeit ist es, die ökonomischen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens zu untersuchen und zu bewerten. Dabei werden verschiedene Modelle und Ansätze zur Umsetzung eines Grundeinkommens betrachtet und kritisch analysiert.
- Die historische Entwicklung des Gedankens der Grundsicherung
- Die ökonomischen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens
- Die politische Umsetzbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens
- Die ethischen und sozialen Aspekte eines bedingungslosen Grundeinkommens
- Die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf das Arbeitsleben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung und Zielstellung, die den Leser in die Thematik des bedingungslosen Grundeinkommens einführt und die Forschungsfrage der Arbeit definiert. Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des Gedankens der Grundsicherung beleuchtet, wobei verschiedene Denker und ihre Ideen zur staatlichen Unterstützung der Bevölkerung vorgestellt werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit neuen Ideen staatlicher Grundsicherung, darunter das bedingungslose Grundeinkommen, die negative Einkommensteuer, das solidarische Bürgergeld, die Lohnauffüllung und das Participation Income. Im vierten Kapitel werden verschiedene Umsetzungen eines Grundeinkommens in Alaska und Brasilien sowie die aktuelle Diskussion in der Europapolitik vorgestellt. Das fünfte Kapitel präsentiert ein Modell zur ökonomischen Analyse des bedingungslosen Grundeinkommens. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse kritisch gewürdigt, wobei die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Armenhilfe, das Steuersystem, die Bildung, das Arbeitsleben, die freie Entfaltung und die politische Umsetzbarkeit beleuchtet werden. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gibt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das bedingungslose Grundeinkommen, die ökonomische Analyse, die historische Entwicklung, die staatliche Grundsicherung, die politische Umsetzbarkeit, die Auswirkungen auf das Arbeitsleben, die Bildung und die freie Entfaltung. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle und Ansätze zur Umsetzung eines Grundeinkommens und analysiert deren ökonomische Folgen. Darüber hinaus werden die ethischen und sozialen Aspekte des bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundidee des bedingungslosen Grundeinkommens?
Es handelt sich um ein Einkommen, das jedem Bürger ohne Bedingungen und unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage gezahlt wird, um die Existenz zu sichern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Welche historischen Vorläufer gibt es für diese Idee?
Die Arbeit nennt Denker wie Thomas Morus (Utopia), Juan Luis Vives, Thomas Paine und im 20. Jahrhundert Konzepte wie die negative Einkommensteuer.
Welche Modelle werden neben dem bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert?
Dazu gehören das solidarische Bürgergeld, die negative Einkommensteuer, Kombilöhne und das sogenannte Participation Income.
Gibt es bereits praktische Beispiele für ein Grundeinkommen?
Ja, die Arbeit führt Beispiele aus Alaska (Permanent Fund) und Brasilien an und diskutiert aktuelle Ansätze in der Europapolitik.
Welche Auswirkungen hat ein Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt?
Die Arbeit analysiert kritisch, wie sich die Arbeitsmotivation, das Lohngefüge und die freie Entfaltung des Individuums durch die finanzielle Absicherung verändern könnten.
Wer ist Götz Werner und welche Rolle spielt sein Modell?
Götz Werner ist ein prominenter Befürworter; sein Modell wird in der Arbeit volkswirtschaftlich analysiert, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung durch Konsumsteuern.
- Arbeit zitieren
- Christoph Irro (Autor:in), 2008, Eine ökonomische Analyse zum Problem des bedingungslosen Grundeinkommens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131292