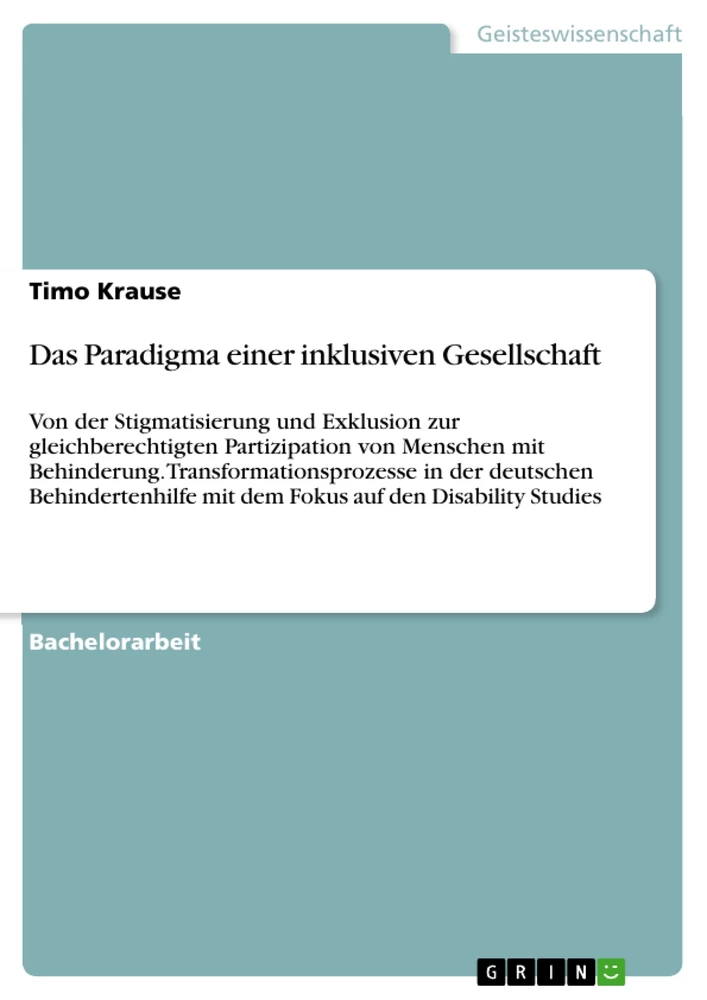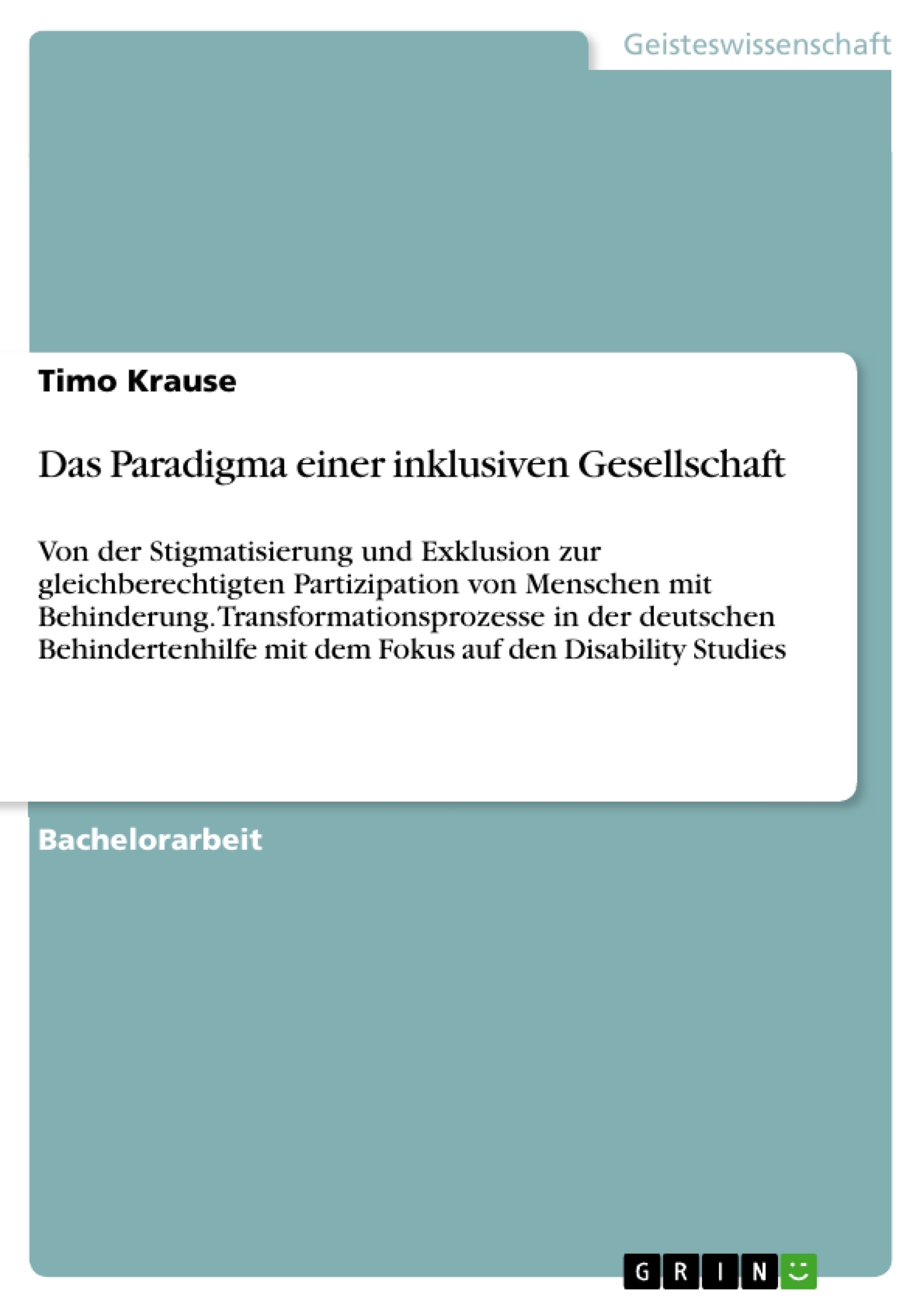Diese Bachelorarbeit wird sich mit dem Thema Behinderung innerhalb der deutschen Gesellschaftsordnung befassen, wobei in diesem Zusammenhang die Historie des Nationalsozialismus und die darin enthaltenen, durch die wissenschaftliche Perspektive der Eugenik begründeten, menschenverachtenden Maßnahmen ein Schwerpunkt sein werden.
Kontrastierend dazu konnte schon vor der Phase des Nationalsozialismus eine Etablierung erster Interessenvertretungen dieses Personenkreises verortet werden, die sich für eine Veränderung der Lebensverhältnisse dieser Menschen aussprachen. Diesbezüglich kann dargelegt werden, dass sich diese ersten Entwicklungen deutscher Behindertenbewegungen aufgrund des Nationalsozialismus nicht weiter in der deutschen Gesellschaftsordnung festigten können, aber sich nach dieser Phase erneut Formen dieser interessenvertretenden Strömungen konstituieren, die oftmals auf durch Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung hervorgebrachten Initiativen beruhen.
Außerdem kann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein Aufbau exkludierender Versorgungsstrukturen für Menschen mit Beeinträchtigung verortet werden, der in seiner Legitimation von den zu diesem Zeitpunkt etablierten Interessenvertretungen vorwiegend unterstützt wurde.
Der weitere Entwicklungsprozess dieser sogenannten Behindertenbewegungen lässt ab den 1970er Jahren eine Etablierung neuer Formen an interessenvertretenden Organisationen verorten, die sich nun gegen die exkludierenden und fremdbestimmten Lebensverhältnisse dieser Menschen aussprechen. In Verbindung mit diesen Interessenvertretungen kann eine sich in den 1980er Jahren etablierende Wissenschaft verortet werden, die den historisch gewachsenen und in Bezug auf das Behinderungsphänomen dominierenden wissenschaftlichen Ansätzen gegenüber kritisch gesinnt ist. Diese sogenannten Disability Studies, und an dieser Stelle im deutschen Wortlaut exemplarisch wiedergegebenen „Studien über Behinderung“, stehen in einem gewissen kooperativen Ansatz zu den internationalen Behindertenbewegungen, indem deren Ursprünge in diesen zu finden sind.
In Bezug auf die deutsche Gesellschaftsordnung kann deren einsetzende Etablierung aber erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts verortet werden, indem zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Diskussionsprozess über die Disability Studies und deren Verankerung in den deutschen wissenschaftlichen Strukturen beginnt und ein dadurch initiierter sich schrittweise entwickelnder Prozess.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung innerhalb der deutschen Gesellschaftsordnung
- 1.1 Der Nationalsozialismus und die Perspektive der Eugenik
- 1.2 Die Entwicklung der Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2 Die Disability Studies – Ein Perspektivenwechsel auf Behinderung innerhalb Deutschlands?
- 2.1 Die Wissenschaft der Disability Studies und die Behindertenbewegungen
- 2.2 Die Etablierung der Disability Studies innerhalb Deutschlands
- 2.3 Die Macht der Normen und die Disability Studies – mit Ansätzen Foucaults
- 2.4 Das individuelle Modell von Behinderung und die Kritik der Disability Studies an diesem traditionellen Denkmuster
- 2.5 Das soziale Modell von Behinderung und dessen veränderte Denkweise
- 2.6 Die kritische Reflexion des sozialen Modells von Behinderung
- 2.7 Das kulturelle Modell von Behinderung und dessen vertieftes Verständnis
- 2.8 Die Disability Studies, das kulturelle Modell von Behinderung und deren kritische Reflexion der traditionellen Wissenschaftsansätze
- 2.9 Der Prozess der Kategorisierung und Differenzierung
- 2.10 Die Disability Studies und deren multidimensionale Perspektive
- 3 Das Potenzial der Disability Studies für die Transformation der deutschen Gesellschaftsordnung im Sinne des Paradigmas der Inklusion
- 3.1 Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK)
- 3.2 Die Bundesrepublik Deutschland und deren Verpflichtungen als Teil der ratifizierenden Vertragsstaaten der UN-BRK
- 3.3 Die UN-BRK und das Paradigma der Inklusion innerhalb Deutschlands
- 3.4 Das Paradigma eines inklusiven Deutschlands und die Disability Studies
- 3.4.1 Die Disability Studies und deren Verständnis von Behinderung
- 3.4.2 Die Disability Studies und deren Forschungsparadigma
- 4 Abschluss der Arbeit
- 4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung
- 4.2 Das sozialarbeiterische Handlungsfeld der deutschen Behindertenhilfe
- 4.3 Ausblick – Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft
- 4.3.1 Das Stigma der Behinderung
- 4.3.2 Die Utopie einer guten Gesellschaft
- 4.3.3 Abschlusszitat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Paradigma einer inklusiven Gesellschaft und analysiert, wie die Transformationsprozesse in der deutschen Behindertenhilfe unter dem Fokus der Disability Studies vorangetrieben werden können. Die Arbeit strebt danach, ein tieferes Verständnis für die Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland zu entwickeln und das Potential der Disability Studies als transformative Kraft zu beleuchten. Die Arbeit thematisiert dabei folgende Schwerpunkte: * **Die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland**: Von der Stigmatisierung und Exklusion im Nationalsozialismus hin zur Entwicklung von Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg. * **Die Disability Studies als Perspektivenwechsel**: Die Arbeit stellt die Disability Studies und deren Kritik an traditionellen Denkmustern von Behinderung vor, insbesondere an dem individuellen Modell und dem sozialen Modell. * **Das kulturelle Modell von Behinderung**: Die Arbeit beleuchtet das kulturelle Modell von Behinderung als alternative Denkweise und untersucht dessen Einfluss auf die Disability Studies. * **Das Potenzial der Disability Studies für die Inklusion**: Die Arbeit untersucht, wie die Disability Studies zur Umsetzung des Paradigmas der Inklusion in Deutschland beitragen können, mit besonderem Fokus auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK). * **Das Stigma der Behinderung**: Die Arbeit betrachtet die anhaltenden Herausforderungen und das Stigma, das Menschen mit Behinderung in der heutigen Gesellschaft weiterhin erleben.Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und legt die Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Behindertenhilfe dar. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland, beginnend mit der NS-Zeit und der Eugenik bis hin zur Entwicklung von Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Kapitel 2 stellt die Disability Studies vor, fokussiert auf ihre Entstehung, ihre Kritik an traditionellen Modellen von Behinderung und das Konzept des kulturellen Modells von Behinderung. Kapitel 3 untersucht das Potenzial der Disability Studies für die Transformation der deutschen Gesellschaftsordnung im Sinne des Paradigmas der Inklusion, beleuchtet die UN-BRK und deren Bedeutung für die Umsetzung von Inklusion in Deutschland.Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Inklusion, Disability Studies, Behinderung, Stigmatisierung, Exklusion, gesellschaftliche Transformation, Interessenvertretung, UN-BRK, Deutschland, soziales Modell, kulturelles Modell, individuelles Modell. Die Arbeit befasst sich mit der kritischen Analyse des Umgangs mit Menschen mit Behinderung und strebt danach, den Wandel hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu fördern.- Quote paper
- Timo Krause (Author), 2022, Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313268