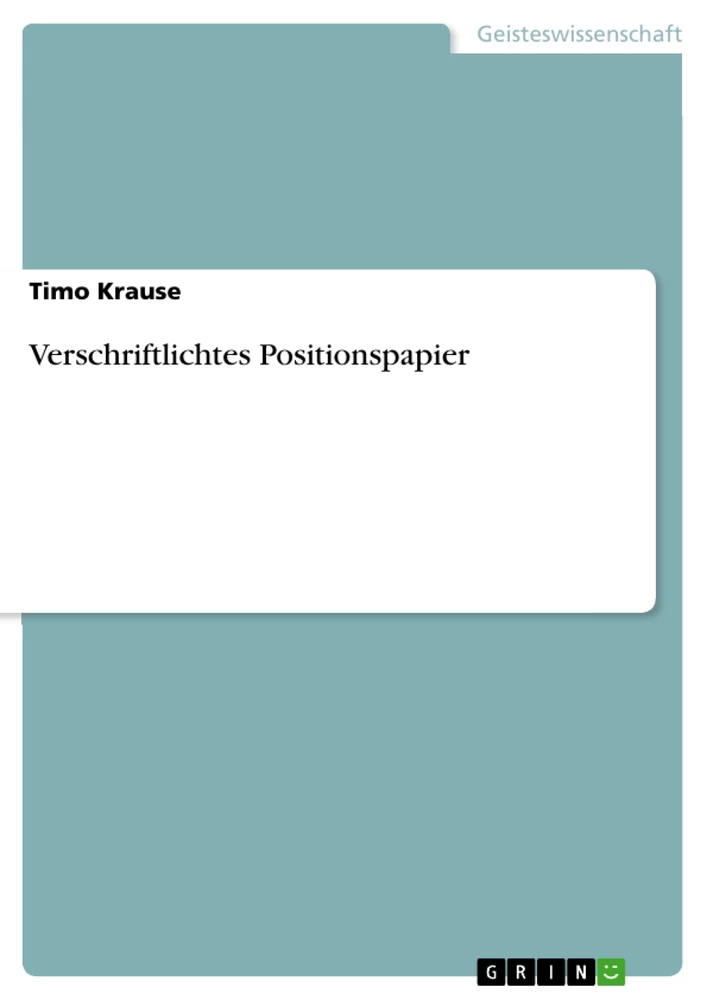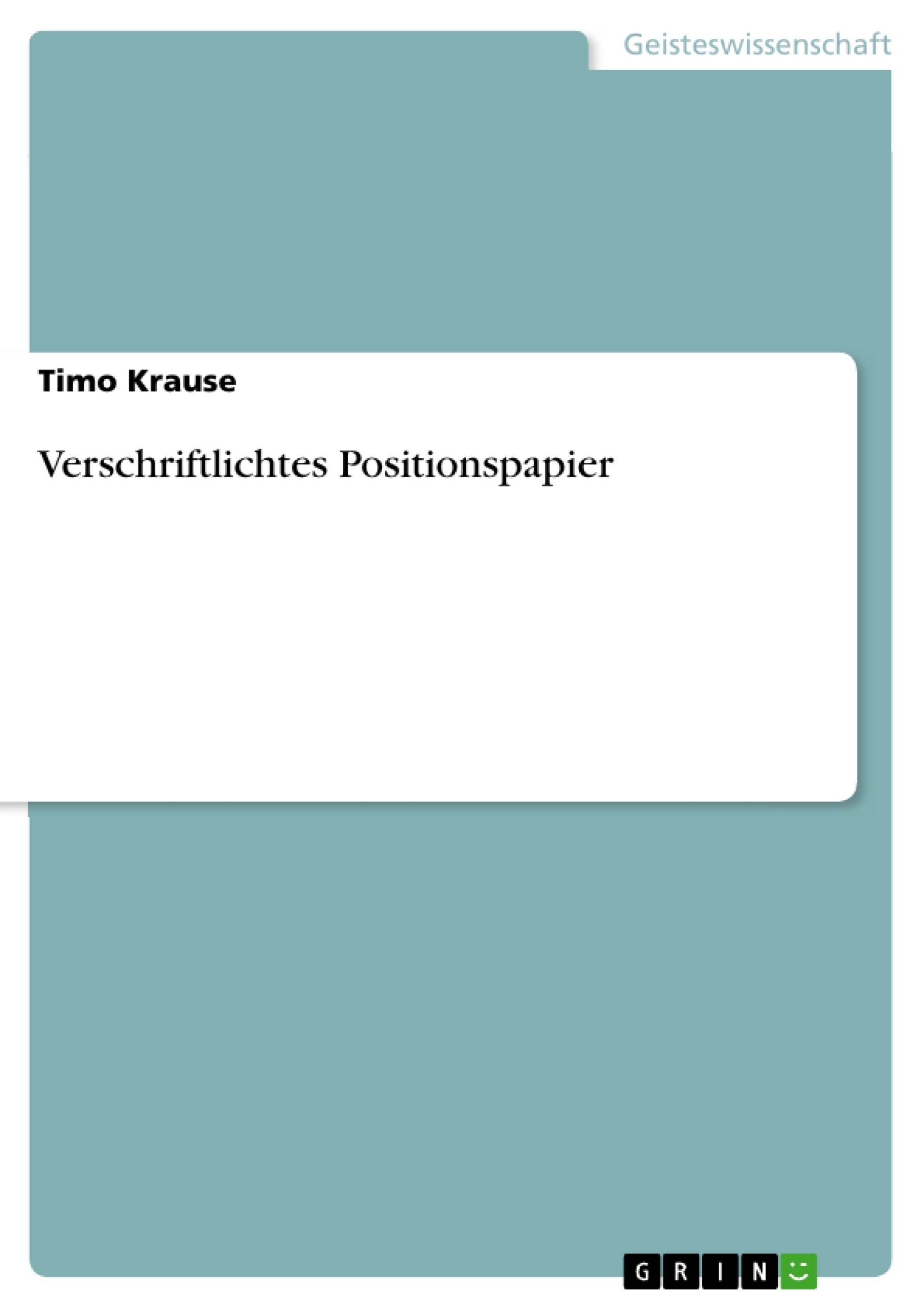Diese Arbeit stellt sich folgende Frage: Welche Maßnahmen in der Sozialen Arbeit sind notwendig, um den Klientinnen und Klienten ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen?
In diesem Positionspapier wird auf das Schriftstück "Das gute Leben" von Dagmar Fenner eingegangen. Diesbezüglich werden verschiedene Positionen aus den Kapiteln über "hedonistische Theorien" und der "Wunsch- und Zieltheorie" erörtert. Der nächste stattfindende Prozess ist die Umwandlung dieser Positionen in Thesen für die Soziale Arbeit, welche ich daraufhin aus der Sicht dieses Berufsfeldes erläutern und darlegen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vergleich der verschiedenen Positionen
- 2.1. Hedonistische Theorie
- 2.2. Wunschtheorie und Zieltheorie
- 2.3. Vergleich von Hedonismus und der Wunsch- und Zieltheorie
- 3 Thesen zum Transfer in die Soziale Arbeit
- 3.1. Handlungen in der Sozialen Arbeit sollen auf alle beteiligten Personen positive Auswirkungen haben
- 3.2. Die Entfaltung psychischer Interessen beruht auf der Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse
- 3.3. Die individuellen Wünsche einer Person sollten in realisierbare Teilziele und konkrete Pläne umgewandelt werden
- 3.4. Das gute Leben und die damit verbundene Selbstverwirklichung beruht auf der Förderung der individuellen Kompetenzen
- 4 Abschluss
- 5 Literaturverzeichnis
- 5.1. Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Positionspapier befasst sich mit der Frage nach dem guten Leben im Kontext der Sozialen Arbeit und analysiert verschiedene ethische Positionen, insbesondere den Hedonismus und die Wunsch- und Zieltheorie. Es untersucht, wie diese Theorien in die Praxis der Sozialen Arbeit transferiert werden können und welche Maßnahmen notwendig sind, um Klientinnen und Klienten ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen.
- Ethische Grundlagen des guten Lebens in der Sozialen Arbeit
- Vergleich verschiedener ethischer Positionen (Hedonismus, Wunsch- und Zieltheorie)
- Entwicklung von Thesen für die Anwendung ethischer Prinzipien in der Sozialen Arbeit
- Analyse der Bedeutung von Bedürfnissen, Wünschen und Zielen für ein gelingendes Leben
- Herausforderungen und Chancen der Selbstverwirklichung im Kontext sozialer Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Dieses Positionspapier verwendet Dagmar Fennas Schriftstück „Das gute Leben“ als Grundlage für die Analyse verschiedener ethischer Positionen. Es zielt darauf ab, diese Positionen in Thesen für die Soziale Arbeit zu überführen und deren Relevanz für die Förderung eines guten Lebens von Klientinnen und Klienten zu beleuchten.
2 Vergleich der verschiedenen Positionen
2.1 Hedonistische Theorie
Der Text beleuchtet den psychologischen und ethischen Hedonismus der Antike, insbesondere den Epikureismus, der auf einen egoistischen Glücksgewinn durch die Maximierung von Lustgewinn setzt. Der Epikureismus sieht die Kompensation von Schmerzen durch Lustempfindungen in anderen Bereichen und betrachtet nur natürliche/physiologische Bedürfnisse als notwendig. Im Gegensatz dazu steht der Utilitarismus, der sich für eine Aufhebung des egoistischen Denkens und die Förderung eines gemeinschaftlichen guten Lebens einsetzt. Dabei steht nicht mehr das individuelle Interesse im Vordergrund, sondern das Wohlergehen aller Betroffenen.
2.2 Wunschtheorie und Zieltheorie
Die Wunsch- und Zieltheorie betrachtet ein gutes Leben als die Realisierung möglichst vieler Wünsche oder Ziele des Einzelnen. Die Wunschtheorie beinhaltet eine egoistische Komponente, während die Zieltheorie konkretere Präferenzen entwickelt, die auf ihre Realisierbarkeit und das persönliche Anspruchsniveau geprüft werden. Diese Theorie betont die Bedeutung von geprüften und informierten Wünschen, die in einen sinnvollen Ordnungszusammenhang integriert werden. Eine dauerhafte Anpassung an die Umweltzustände und die Festlegung von Zielen in ferner Zukunft sind für ein gutes und glückliches Leben unerlässlich.
2.3 Vergleich von Hedonismus und der Wunsch- und Zieltheorie
Der Vergleich zeigt Übereinstimmungen zwischen dem Hedonismus der Antike und der Wunsch- und Zieltheorie in Bezug auf den subjektiven Bezugspunkt des Glücksgewinns. Beide sehen das gute Leben in der Maximierung des individuellen Lustgewinns. Der Utilitarismus hingegen fordert die Aufhebung des egoistischen Denkens und plädiert für einen gemeinschaftlichen Lustgewinn durch die Bedürfnisbefriedigung. Der Text betont, dass die Zieltheorie in Bezug auf die Umsetzung praktikable Aspekte bietet. Die Erstellung eines konkreten Lebensplanes, der den aktuellen Bedingungen und dem Anspruchsniveau der Person entspricht, ist entscheidend für den Gewinn eines Lebenssinnes (guten Lebens) durch die Generierung konkreter Ziele.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Positionspapiers sind: ethische Positionen, Hedonismus, Wunschtheorie, Zieltheorie, gutes Leben, Soziale Arbeit, Bedürfnisbefriedigung, Selbstverwirklichung, Inklusion, Teilhabe, Handlungsethik.
- Citar trabajo
- Timo Krause (Autor), 2020, Verschriftlichtes Positionspapier, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313291