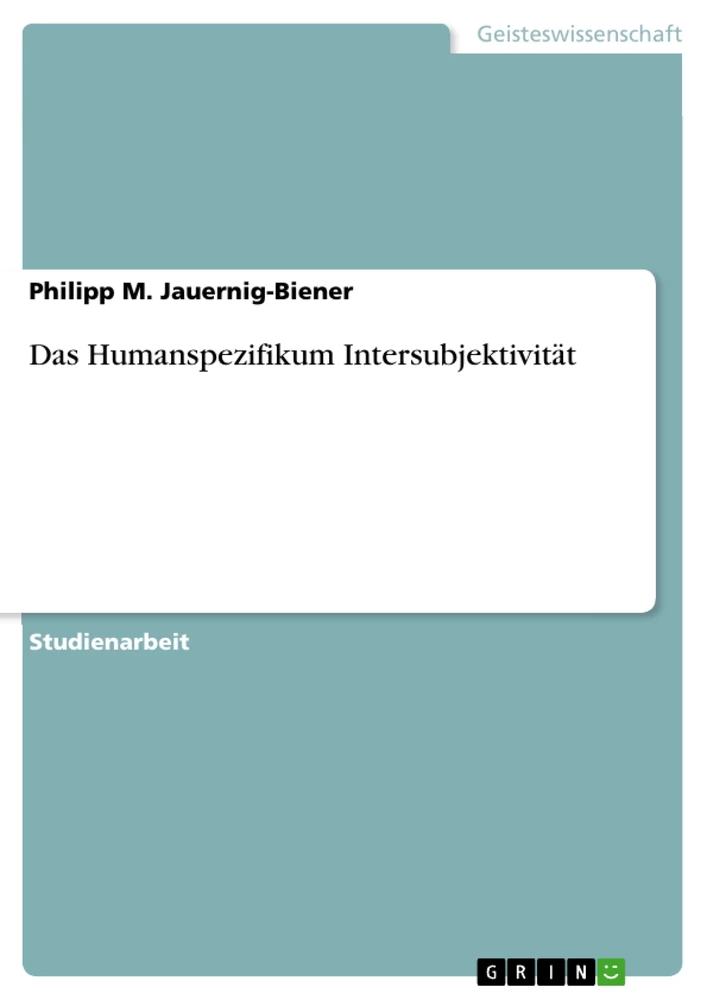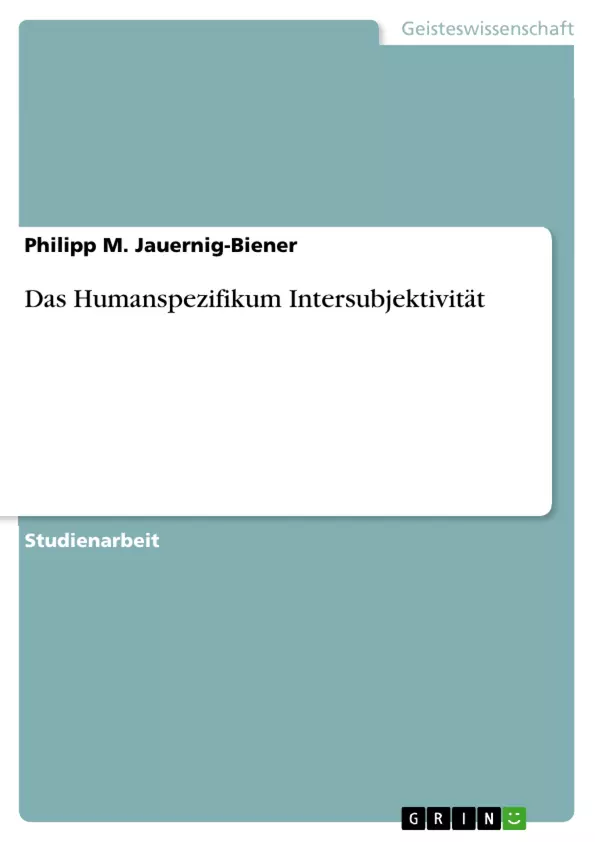Die Frage nach der Vernunft soll in der folgenden Arbeit aufgegriffen und genauer gestellt werden. Worin zeichnet sich die Rationalität aus, welche dem Menschen allein zugesprochen wird, ihn vom Tier trennt und zu dem befähigt, was er tut und tun könnte? Denn nicht ausnahmslos alle Fähigkeiten und Handlungsweisen, von denen behauptet werden könnte, ihr Ursprung liege in der Vernunft, bleiben tatsächlich dem Menschen vorenthalten. So zeigen etwa Hunde eine ähnliche Kommunikationsbereitschaft wie Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren, indem sie nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf die Blicke und Gesten von Menschen reagieren . Schimpansen wiederum sind in der Lage, ihre Umgebung mit Hilfe von Werkzeugen zu manipulieren und so vor allem ihre Nahrungsbeschaffung zu erleichtern. Was also bleibt dem Menschen noch, das ihn einzigartig macht und von der breiten Masse der Tiere abhebt?
Der Aufsatz von Michael Tomasello et al. Intentionen teilen und verstehen. Die Ursprünge menschlicher Kognition bietet hierfür einen ansprechenden Ansatzpunkt. Als höchste Stelle der menschlichen Entwicklung beschreiben sie den „kulturellen Schöpfungsprozess“ , der in seiner Allgegenwärtigkeit als ein Merkmal gesehen werden sollte, welches den Menschen auszeichnet. Damit aber Schöpfungen wie Wissenschaften, Traditionen oder Sprachen entstehen können, bestehen die Voraussetzungen dafür in „den einzigartigen Fähigkeiten des Menschen (…), Intentionen zu verstehen und mit anderen zu teilen“.
In der folgenden Arbeit soll mit Hilfe des genannten Textes versucht werden, die von Aristoteles den Menschen auszeichnende Vernunft genauer zu spezifizieren. Unterstützend dazu sollen die Thesen zur von Varela, Thompson und Rosch 1991 eingeführte Bezeichnung enaktiver Ansatz genutzt werden, um die bei Tomasello et al. auftauchenden Grundlagen des kulturellen Schöpfungsprozesses noch genauer zu untersuchen und um so eine noch grundlegender Eigenschaft des Menschen zu finden, welche als das Humanspezifikum akzeptiert werden könnte.
Am Ende der Arbeit soll sich nicht nur die Frage gestellt werden, ob und wie annehmbar die Reduzierung der Vernunft als Humanspezifikum auf das gefundene Merkmal ist. Es soll auch gefragt werden, welche Folgen die getroffene Spezifizierung des Humanspezifikums für die Entscheidung haben würde, welches Lebewesen ein Mensch sei und welches nicht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Intersubjektive Handlung als Humanspezifikum
- 2.1. Das Verstehen von Intentionen
- 2.2. Das Teilen von Intentionen
- 3. Der enaktive Ansatz zur grundlegenderen Suche nach dem Humanspezifikum
- 4. Emotionen als Träger von Intentionen
- 5. Das Wahrnehmen, Verstehen und Teilen von Emotionen bei Autisten und Säuglingen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Humanspezifikum, also das Merkmal, das den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Ausgehend von Aristoteles' Konzept der Rationalität hinterfragt der Text diese Definition und sucht nach einer präziseren Charakterisierung. Dabei werden die Thesen von Tomasello et al. zum Verständnis und Teilen von Intentionen sowie der enaktive Ansatz herangezogen.
- Spezifizierung des Humanspezifikums jenseits der bloßen Rationalität
- Intersubjektivität als mögliches Humanspezifikum
- Rolle von Intentionen und Emotionen im intersubjektiven Handeln
- Vergleichende Betrachtung von Menschen, Menschenaffen und Säuglingen
- Folgen der Spezifizierung des Humanspezifikums für die Definition des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach dem Humanspezifikum, dem Merkmal, das den Menschen von anderen Tieren unterscheidet. Sie kritisiert die traditionelle Definition als bloße Rationalität und verweist auf die komplexen Herausforderungen, die mit der Bestimmung dieses Merkmals verbunden sind. Der Text kündigt die Untersuchung des Verständnisses und Teilens von Intentionen als möglichen Kandidaten für das Humanspezifikum an, wobei der enaktive Ansatz unterstützend genutzt werden soll. Die Einleitung skizziert die Struktur der Arbeit und die zu erwartenden Schlussfolgerungen.
2. Intersubjektive Handlung als Humanspezifikum: Dieses Kapitel untersucht die Intersubjektivität, also die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln und zur Kooperation mit anderen, als potenzielles Humanspezifikum. Basierend auf Tomasello et al. wird argumentiert, dass das Verständnis und das Teilen von Intentionen die Grundlage für intersubjektive Handlungen bilden. Der Fokus liegt auf der Beschreibung dieser Fähigkeiten und ihrer Bedeutung für die Entwicklung menschlicher Kultur und Gesellschaft. Der Autor legt dar, dass diese Fähigkeit, obwohl auch in Ansätzen bei anderen Primaten vorhanden, im Umfang und der Komplexität beim Menschen einzigartig ausgeprägt ist.
2.1. Das Verstehen von Intentionen: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit der Entwicklung des Verständnisses von Intentionen beim Menschen. Es wird beschrieben, wie Kinder im Laufe ihrer Entwicklung lernen, das Verhalten anderer als zielgerichtetes Handeln zu interpretieren und dies mit bereits bestehendem Wissen zu verknüpfen. Der Autor differenziert zwischen dem einfachen Erkennen von Handlungen und dem Verstehen der dahinterliegenden Gründe. Es wird herausgestellt, dass auch Menschenaffen ein gewisses Verständnis von Intentionen besitzen, dies aber im Vergleich zum Menschen deutlich weniger komplex ist.
2.2. Das Teilen von Intentionen: Dieser Unterabschnitt konzentriert sich auf die Fähigkeit, eigene Intentionen mit anderen zu teilen und gemeinsam an Zielen zu arbeiten. Es wird gezeigt, wie diese Fähigkeit die Grundlage für komplexere Formen der Kooperation und des sozialen Zusammenlebens bildet. Die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln und das Verständnis von Perspektiven anderer sind hier zentrale Aspekte. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Verhalten von Menschenaffen und Säuglingen werden im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Humanspezifikum, Intersubjektivität, Intentionen, Emotionen, Enaktiver Ansatz, Tomasello, Vernunft, Kulturelle Schöpfungsprozess, Menschenaffen, Säuglinge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung des Humanspezifikums
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Humanspezifikum, also das Merkmal, das den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Sie hinterfragt die traditionelle Definition als bloße Rationalität und sucht nach einer präziseren Charakterisierung.
Welche Konzepte werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Thesen von Tomasello et al. zum Verständnis und Teilen von Intentionen sowie auf den enaktiven Ansatz. Intersubjektivität, also die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln und zur Kooperation, spielt eine zentrale Rolle.
Welche Aspekte der Intersubjektivität werden behandelt?
Die Arbeit analysiert das Verstehen und Teilen von Intentionen als Grundlage intersubjektiven Handelns. Es wird untersucht, wie Kinder und Menschenaffen Intentionen verstehen und wie sich diese Fähigkeit beim Menschen in Umfang und Komplexität ausprägt. Die Rolle von Emotionen im intersubjektiven Handeln wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird das Humanspezifikum spezifiziert?
Die Arbeit versucht, das Humanspezifikum jenseits der bloßen Rationalität zu spezifizieren, indem sie die Intersubjektivität als mögliches Kriterium vorschlägt. Der Vergleich zwischen Menschen, Menschenaffen und Säuglingen hilft dabei, die Einzigartigkeit der menschlichen Fähigkeiten herauszuarbeiten.
Welche Rolle spielen Emotionen?
Emotionen werden als Träger von Intentionen betrachtet und ihre Bedeutung für das Wahrnehmen, Verstehen und Teilen von Intentionen, insbesondere im Vergleich zwischen Menschen, Autisten und Säuglingen, wird untersucht.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Intersubjektivität als Humanspezifikum (mit Unterkapiteln zum Verstehen und Teilen von Intentionen), ein Kapitel zum enaktiven Ansatz, ein Kapitel zu Emotionen als Träger von Intentionen, ein Kapitel zum Vergleich von Menschen, Autisten und Säuglingen und ein Fazit. Jedes Kapitel vertieft spezifische Aspekte des Themas Humanspezifikum.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden in der Einleitung angedeutet und im Fazit detailliert dargelegt. Sie befassen sich mit den Folgen der Spezifizierung des Humanspezifikums für die Definition des Menschen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Humanspezifikum, Intersubjektivität, Intentionen, Emotionen, Enaktiver Ansatz, Tomasello, Vernunft, Kulturelle Schöpfungsprozess, Menschenaffen, Säuglinge.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit dem Thema Humanspezifikum, intersubjektivem Handeln und der kognitiven Entwicklung auseinandersetzt.
- Citation du texte
- 1. Staatsexamen Philipp M. Jauernig-Biener (Auteur), 2013, Das Humanspezifikum Intersubjektivität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313458