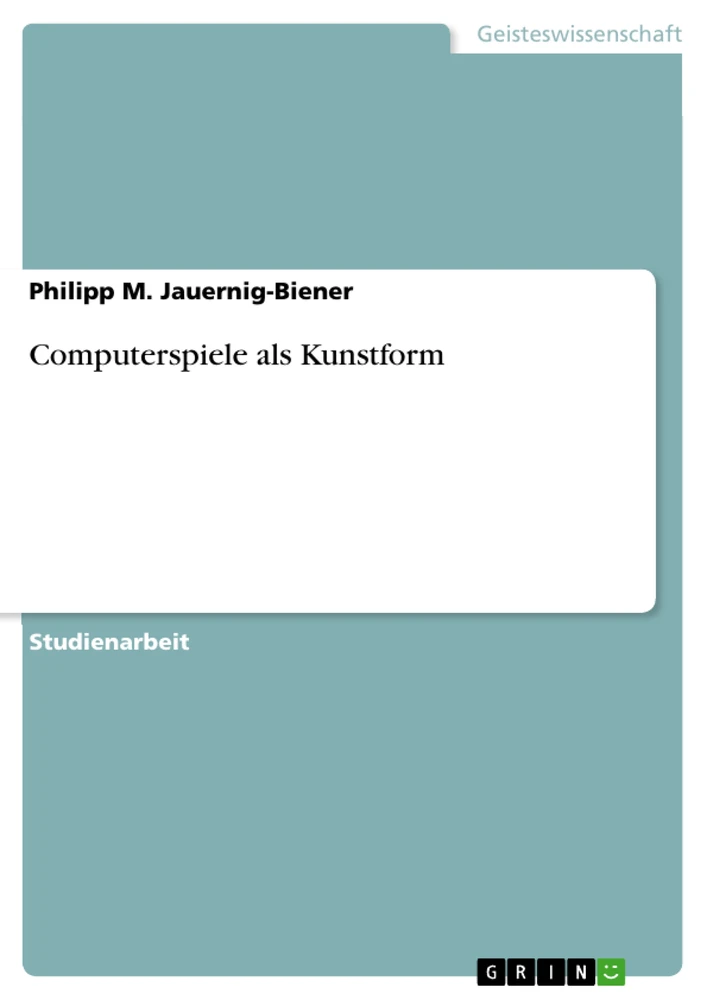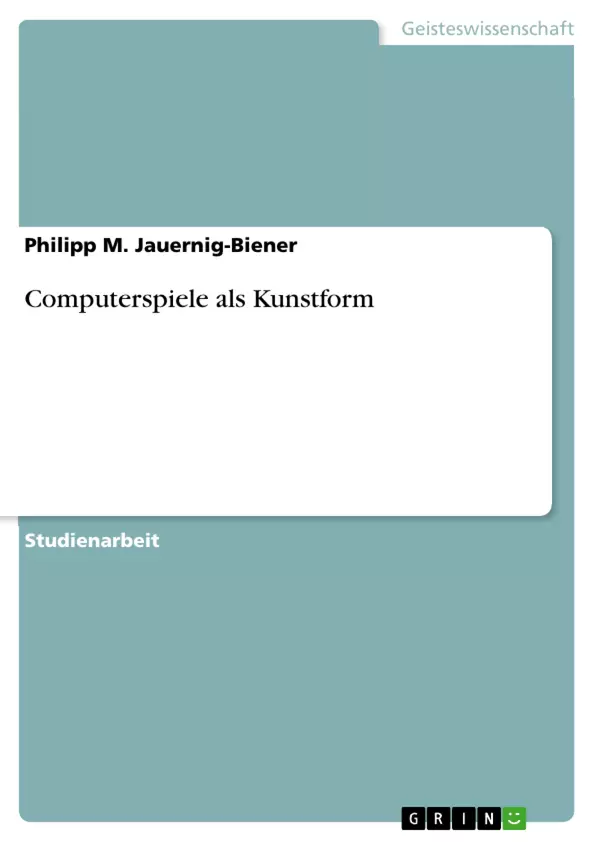Auf Grundlage der Werke „Ästhetische Theorie“ von Theodor W. Adorno und „Die Kunst der Gesellschaft“ von Niklas Luhmann soll untersucht werden, ob Computerspiele als eigenständige Kunstform angesehen werden können und sollten. Sollte dies der Fall sein, wird zudem darauf eingegangen, inwieweit Computerspiele als Beispiel für die von Adorno abgewertete Kulturindustrie zu verstehen ist und welche Folgen daraus resultieren.
Computerspiele scheinen als mögliche Kunstform aus zwei Teilen zu bestehen, welche bereits etablierte Kunstformen in sich vereinen. Zum einen lässt sich allein die grafische Darstellung auf Bildschirmen mit der bildenden Kunst und, als bewegte Bilder, auch mit der darstellenden Kunst vergleichen. Der andere Teil dagegen besteht aus der Handlung und wäre, würde man auf die Darstellung verzichten können, durchaus mit der Literatur vergleichbar. Diese beiden Teile sollen demnach ebenfalls genauer untersucht und auf ihre Relevanz und ihr Verhältnis zueinander überprüft werden. Insbesondere der zweite Teil, die inhaltliche Relevanz von Computerspielen, soll auch auf die Möglichkeit hin überprüft werden, ob neben der Handlung auch eine übertragene Botschaft an den Spieler übermittelt werden kann.
Abschließend, um die entstandenen Vermutungen zu überprüfen, soll als Beispiel für inhaltliche, aber auch grafische Relevanz ein im August 2013 erschienenes Computerspiel als Beispiel aufgeführt und untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Computerspiele als Kunstform
- 3. Grafische Darstellung als Form
- 4. Handlung als Inhalt
- 5. Das Verhältnis zwischen Form und Inhalt
- 6. Zugang zur Kunst: Der Spieler als Protagonist
- 7. Untersuchung des Computerspiels „Papers, Please“
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Computerspiele als eigenständige Kunstform betrachtet werden können. Sie analysiert die Werke von Theodor W. Adorno und Niklas Luhmann, um zu untersuchen, ob Computerspiele den Kriterien einer Kunstform genügen und inwieweit sie als Beispiel für die von Adorno kritisierte Kulturindustrie zu verstehen sind.
- Untersuchung der Kriterien einer Kunstform im Kontext von Computerspielen
- Analyse der grafischen Darstellung und Handlungsinhalte in Computerspielen
- Beurteilung des Verhältnisses von Form und Inhalt in Computerspielen
- Bewertung des Einflusses der Kulturindustrie auf Computerspiele
- Analyse des Computerspiels „Papers, Please“ als Beispiel für eine Kunstform
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach der Kunstform Computerspiele und führt die relevanten Theorien von Adorno und Luhmann ein.
- Kapitel 2: Computerspiele als Kunstform: Dieses Kapitel untersucht die Definition von Kunst bei Adorno und stellt die Frage, ob Computerspiele als Produkte der Kulturindustrie betrachtet werden können.
- Kapitel 3: Grafische Darstellung als Form: Dieses Kapitel analysiert die grafische Darstellung in Computerspielen und vergleicht sie mit etablierten Kunstformen.
- Kapitel 4: Handlung als Inhalt: Dieses Kapitel betrachtet die narrative Struktur von Computerspielen und untersucht deren Vergleichbarkeit mit literarischen Werken.
- Kapitel 5: Das Verhältnis zwischen Form und Inhalt: Dieses Kapitel analysiert die Interaktion zwischen grafischer Darstellung und Handlung in Computerspielen.
- Kapitel 6: Zugang zur Kunst: Der Spieler als Protagonist: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Spielers als Interpret der Kunstform Computerspiel.
- Kapitel 7: Untersuchung des Computerspiels „Papers, Please“: Dieses Kapitel analysiert das Spiel „Papers, Please“ als Beispiel für die Anwendung der zuvor entwickelten Argumente.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Kunstform, Adorno, Luhmann, Kulturindustrie, grafische Darstellung, Handlung, Spieler, Kommunikation, „Papers, Please“
- Citation du texte
- Philipp M. Jauernig-Biener (Auteur), 2013, Computerspiele als Kunstform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313939