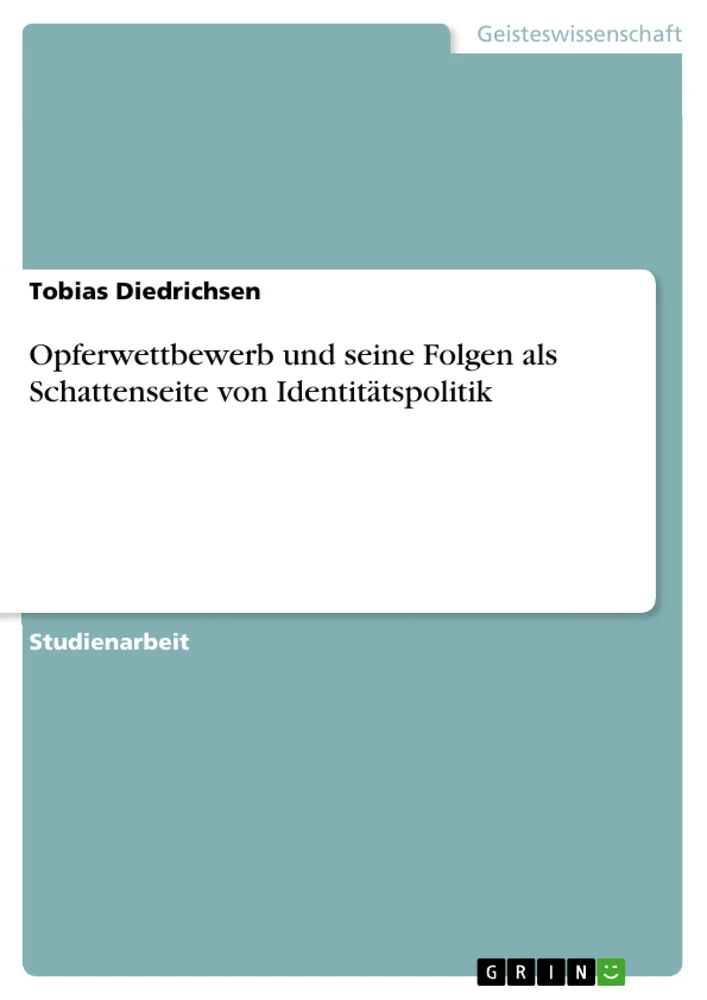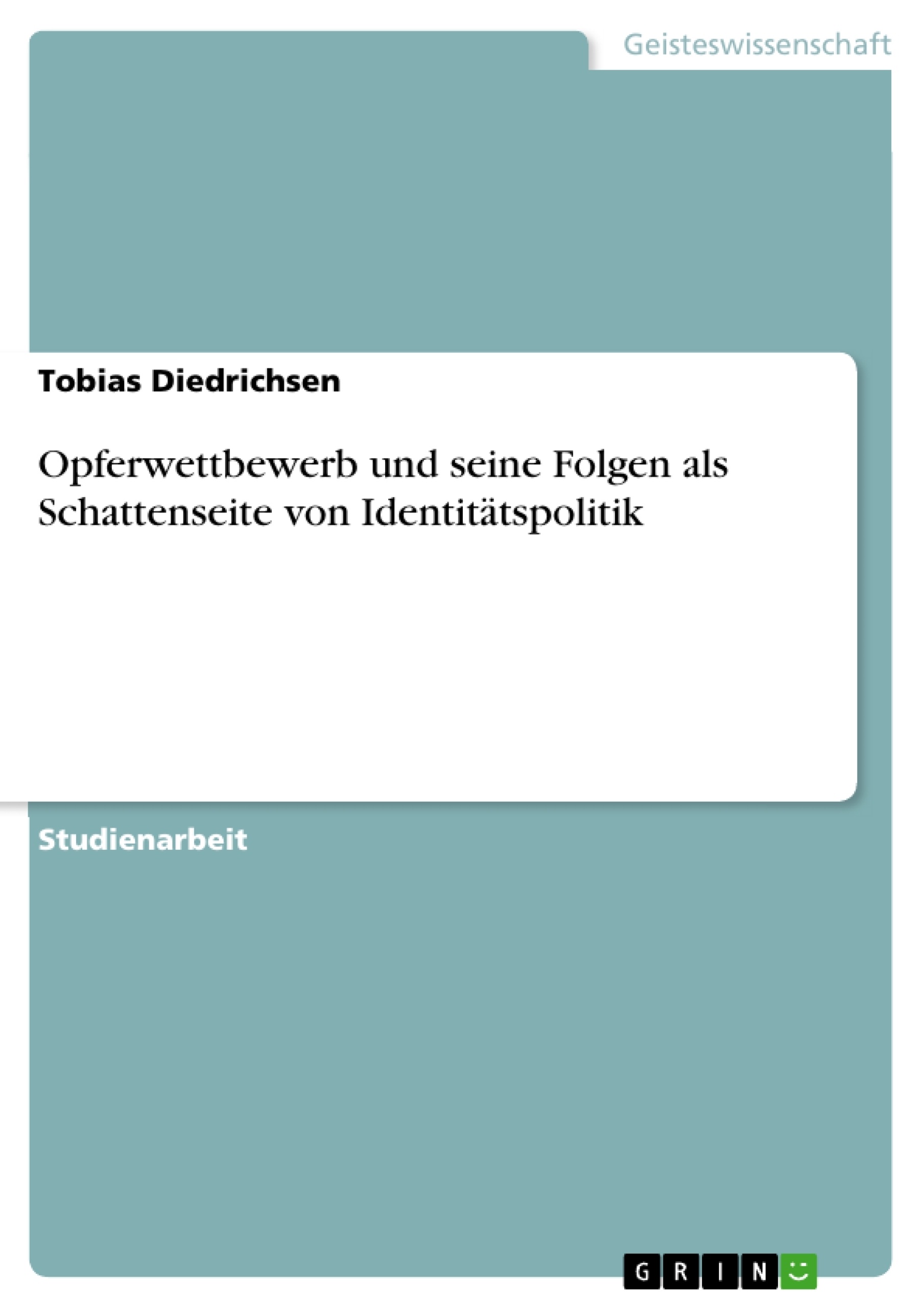Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen Opfer und Wettbewerb genauer untersucht werden. Der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass dem Opferstatus eine Attraktivität innewohnen kann, welche sich in einem Konkurrenzkampf zwischen Individuen oder Gruppen zu äußern vermag. Es soll weiter die Verbindung zwischen besagtem Wettbewerb und linker Identitätspolitik hergestellt, sowie mögliche Nachteile für Opfer und die Gesellschaft ausgemacht werden.
Die Soziologen Jason Manning und Bradley Campbell haben mit ihrem Werk „The Rise of Victimhood Culture“ die aktuelle Grundlage geschaffen, anhand welcher sich die zu untersuchenden Phänomene festmachen lassen. Schauplatz der zusammengetragenen Vorkommnisse sind meist US-amerikanische Universitäten, welche gewiss nicht als genaues Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland oder Europa zu verstehen sind, jedoch übertragbare Schlüsse und Zusammenhänge liefern.
Nachdem im Theorieteil notwendige Begrifflichkeiten geklärt werden und Campbell und Mannings Theorie der Victimhood Culture erläutert wird, greift der Hauptteil erneut die Besonderheit des Themas Opfer auf und führt über eine Gegenüberstellung verschiedener Vor- und Nachteile von gesellschaftlichen Entwicklungszügen und Strategien hin zur Klärung der Kausalität zwischen den einzelnen Teilen, um weitere Schlüsse zu ziehen. Die Erträge der Arbeit werden schließlich im Fazit zusammengefasst und die Arbeit endet in einem Ausblick möglicher Entwicklung und offener Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsklärung
- Opfer
- Mikroaggression
- Safe Space
- Identitätspolitik
- Theorie der ,,Victimhood Culture“
- Begriffsklärung
- Opfer sein - ein zweischneidiges Schwert
- Der richtige Umgang mit Opfern
- Dringlichkeit von Identitätspolitik
- Safe Space vs. Lebenswelt - Lösung oder Problem?
- Attraktivität des Opferstatus
- Diskussion
- Schluss
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Verbindung zwischen dem Opferstatus und dem Wettbewerb. Es wird angenommen, dass der Opferstatus eine gewisse Attraktivität besitzen kann, die zu einem Konkurrenzkampf zwischen Einzelpersonen oder Gruppen führt. Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen diesem Wettbewerb und linker Identitätspolitik und analysiert potenzielle Nachteile für Opfer und die Gesellschaft.
- Analyse der Beziehung zwischen Opferstatus und Wettbewerb
- Untersuchung der Attraktivität des Opferstatus
- Beziehung zwischen dem Opferwettbewerb und linker Identitätspolitik
- Mögliche Nachteile für Opfer und die Gesellschaft
- Einbettung der Thematik in die Theorie der „Victimhood Culture“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Opferwettbewerbs und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise heraus. Der theoretische Teil klärt wichtige Begrifflichkeiten wie Opfer, Mikroaggression, Safe Space und Identitätspolitik und führt in die Theorie der „Victimhood Culture“ ein. Im Hauptteil wird die Attraktivität des Opferstatus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft diskutiert. Dabei werden die Vor- und Nachteile verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungszüge und Strategien beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Opfer, Wettbewerb, Identitätspolitik, „Victimhood Culture“, Safe Space, Mikroaggression, und den Folgen dieser Phänomene für die Gesellschaft.
- Quote paper
- Tobias Diedrichsen (Author), 2022, Opferwettbewerb und seine Folgen als Schattenseite von Identitätspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1314717