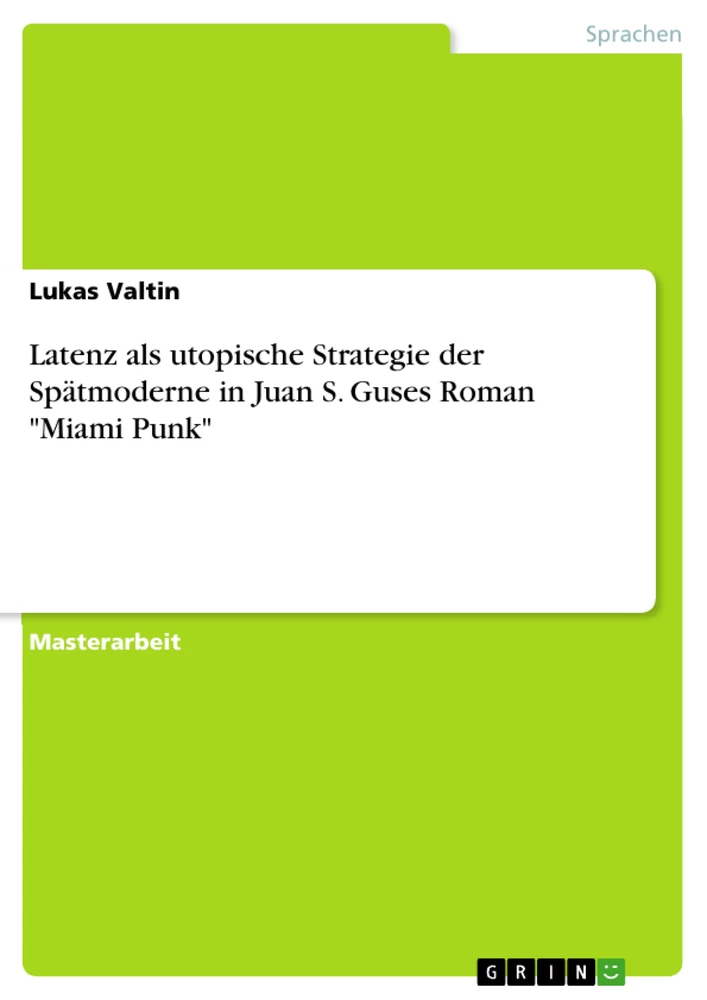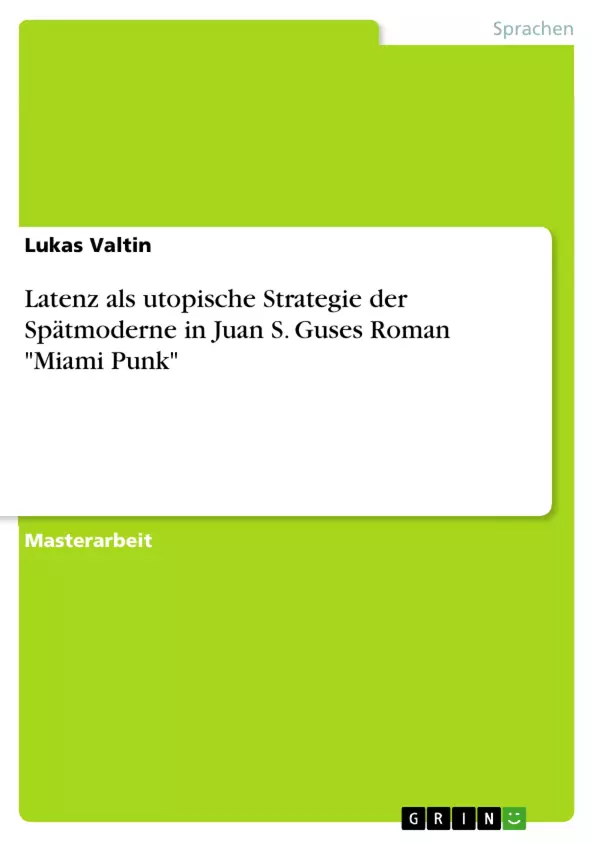Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, der Utopie eine inhaltliche und formale Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen, die sie nicht in die Bedeutungslosigkeit treibt, sondern ihr unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen bzw. diese für sich nutzend gesamtgesellschaftliche Relevanz sichert.
Den ersten Schritt hin zu diesem Ziel bildet eine Analyse der gesellschaftlichen und ästhetischen Umstände, unter denen die Utopie in der Spätmoderne entstehen, existieren und wirken/rezipiert werden muss, und wie genau diese die Utopie, ihre Inhalte und ästhetische Form, beeinflussen. Dieser Analyse zugrunde liegt eine intensive Auseinandersetzung mit Andreas Reckwitz' einschlägiger Betrachtung des spätmodernen Singularitätsparadigmas und seiner Implikationen für verschiedenste gesellschaftliche Teilbereiche. Aus ihr leite ich Probleme, aber auch Chancen, ab, welche die Omnipräsenz des Singularitätsimperativs für die Utopie birgt. Ein spezifisch akzentuiertes Utopisches, so das Ergebnis meiner Überlegungen, sollte die klassische Utopie beerben (und tut dies teilweise auch bereits).
Der zweite Teil dieser Arbeit ist dann dem Lösungsvorschlag für die im ersten Teil ausgemachten Dilemmata gewidmet, mit denen die Utopie in der Spätmoderne konfrontiert ist. Zentrales Theorem hierfür ist die Latenz. Einem Überblick über die Latenztheorie und verschiedene Latenzbegriffe folgt das Herauspräparieren meines eigenen Latenzverständnisses, welches sich von einer lediglich polemisch verstandenen Latenz abwendet und sich stattdessen dem Konzept einer instrumentellen Latenz anschließt, wie es etwa Niklas Luhmann oder Ernst Bloch verschiedentlich postuliert haben , einer Latenz als Theorie strategischen Handelns. Wie Latenz sich produktiv mit der Utopie verbinden kann, um Letzterer das Werkzeug an die Hand zu geben, adäquat auf die kulturelle, ästhetische und politische Umwelt der Spätmoderne zu reagieren und in dieser gesellschaftlich relevant zu bleiben, welche Mechanismen und Formen der Synthese dabei eine Rolle spielen und entstehen – dies soll in der zweiten Hälfte des zweiten Kapitels geklärt werden. Dabei werden, neben anderen, sowohl ästhetische bzw. formale Aspekte als auch solche der Sozialform eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. UTOPIE IN DER SPÄTMODERNE
- 1.1 Die klassische Utopie
- 1.2 Das Singularitätsparadigma
- 1.3 Das Utopische in der spätmodernen Gesellschaft der Singularitäten
- 1.3.1 Genese
- 1.3.2 Existenz und Form
- 1.3.3 Wirkung und Rezeption
- 1.3.4 Formen und Modi, Probleme und Chancen
- 2. LATENZ ALS UTOPISCHE STRATEGIE INNERHALB DES SINGULARITÄTSPARADIGMAS DER SPÄTMODERNE
- 2.1 Latenz - eine Gebrauchsdefinition
- 2.1.1 Latenz allgemein
- 2.1.2 Der polemische Latenzbegriff
- 2.1.3.1 Abgrenzung zum polemischen Latenzbegriff
- 2.1.3.2 Die Zeitstruktur der Latenz
- 2.1.3.3 Latenz als Handlungsstrategie
- 2.2 Latenz und Utopie
- 2.2.1 Latenz und Utopie bei Ernst Bloch
- 2.2.2 Latenz und das neue Selbstverständnis des Utopischen
- 2.2.3 Formen der Verbindung von Latenz und dem Utopischen
- 2.2.3.1 Die Latenz der utopischen Energie
- 2.2.3.2 Der Schwarm als Form der latenten Utopie/utopischen Latenz
- 2.3 Das Verhältnis von Latenz und Literatur
- 3. UTOPIE UND LATENZ IN JUAN S. GUSES MIAMI PUNK
- 3.1 Warum Literatur? Vom Verhältnis des Utopischen/der Latenz in der Realität zum Utopischen/der Latenz in der Literatur – Vorbemerkungen I
- 3.2 Von der Dystopie zu utopischen Oasen, von der polemischen zur strategischen Latenz – Vorbemerkungen II
- 3.3 (Utopische) Latenzen auf der Inhaltsebene von Miami Punk
- 3.3.1 Latenzen nach polemischem Begriffsverständnis
- 3.3.2 Strategische Latenzen
- 3.4 (Utopische) Latenzhandlungen auf der Formebene von Miami Punk
- 3.5 Der "Kongress" als Schwarm und Trägersozialform von utopischen Latenzhandlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Utopie in der Spätmoderne und argumentiert, dass die Utopie nicht obsolet ist, sondern ihre Gestalt ändern muss, um gesellschaftlich relevant zu bleiben. Sie analysiert die Herausforderungen, die das Singularitätsparadigma für die Utopie darstellt, und stellt die Latenz als eine mögliche utopische Strategie vor.
- Die Utopie in der Spätmoderne und ihre Herausforderungen
- Das Singularitätsparadigma und seine Auswirkungen auf die Utopie
- Latenz als Konzept und strategische Handlungsweise
- Die Verbindung von Latenz und Utopie
- Die Umsetzung von Latenz und Utopie in der Literatur, am Beispiel von Juan S. Guses Miami Punk
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Problematik der Utopie in der Spätmoderne ein und beleuchtet den Einfluss des Singularitätsparadigmas auf die klassische Utopie.
- Kapitel 1 befasst sich mit der Entstehung, Existenz und Rezeption des Utopischen in der spätmodernen Gesellschaft der Singularitäten und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Singularitätsparadigma für die Utopie ergeben.
- Kapitel 2 erläutert Latenz als eine strategische Handlungsweise und untersucht, wie Latenz als Konzept mit der Utopie verknüpft werden kann, um ihr gesellschaftliche Relevanz in der Spätmoderne zu sichern.
- Kapitel 3 analysiert Juan S. Guses Roman Miami Punk und zeigt, wie Latenz und Utopie in der literarischen Praxis umgesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Utopie, Spätmoderne, Singularitätsparadigma, Latenz, strategische Handlungsweise, Literaturanalyse und Juan S. Guses Roman Miami Punk.
- Quote paper
- Lukas Valtin (Author), 2021, Latenz als utopische Strategie der Spätmoderne in Juan S. Guses Roman "Miami Punk", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1315279