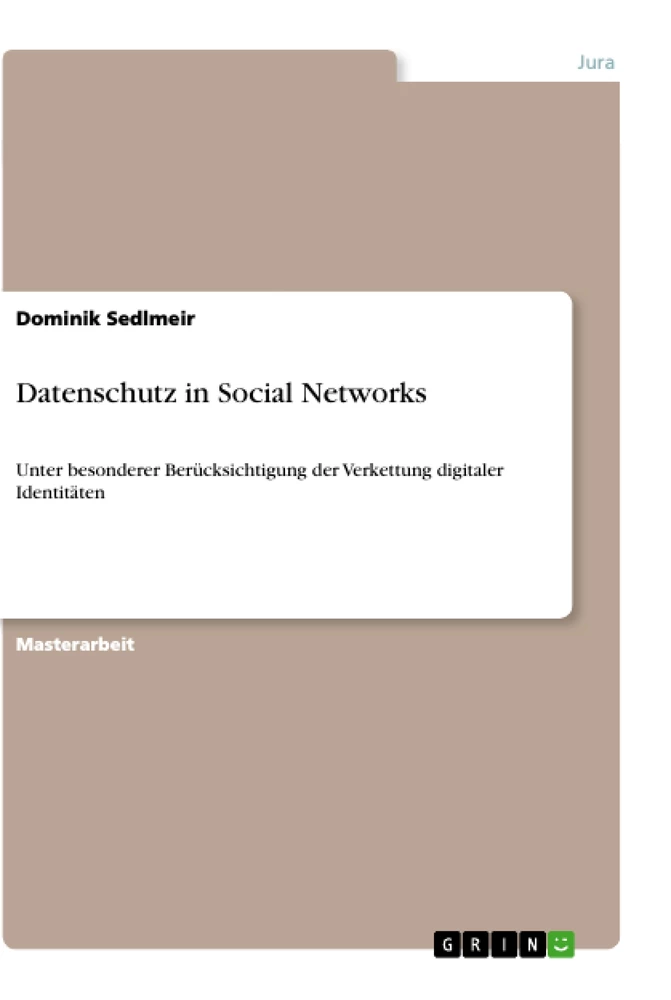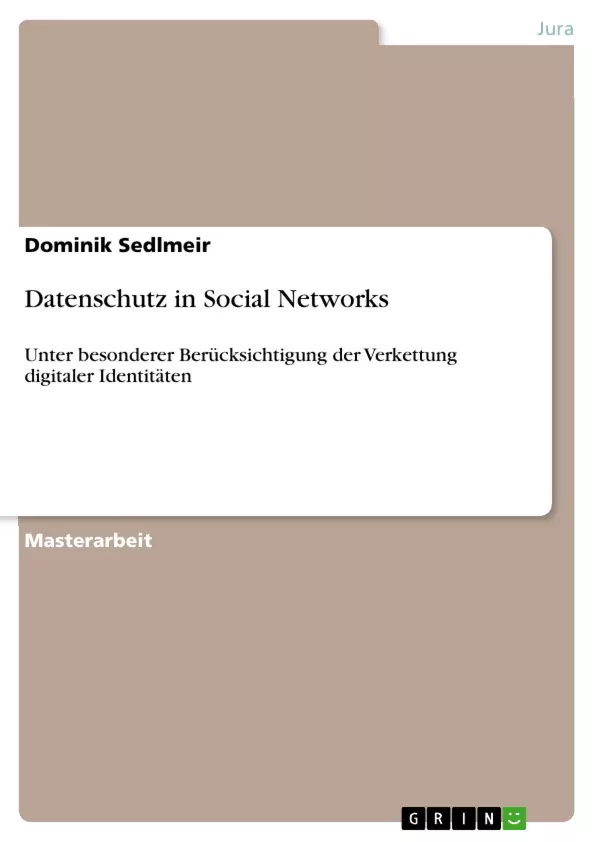Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema „Datenschutz in Social Network Sites“. Ein besonderer Fokus wird auf Profilbildung, also das Erstellen und Verketten digitaler Identitäten gelegt. Im Teil A werden die Vorraussetzungen und Grundsätze des gegenwärtigen Datenschutzrechtes vorgestellt. Denen gegenübergestellt werden kurz die wichtigsten Problemkreise und Herausforderungen an modernen Datenschutz. Digitale Identitäten, Profilbildung und die technischen Hilfen hierzu Verkettung, Datawarehouses und Datamining, Identitätsdiebstahl u.a. werden vorgestellt.
Es wird klar, dass der bisherige Datenschutz unter den gegebenen Bedingungen auf die Gefahren nicht adäquat reagieren kann.
Die SNS sind auch deshalb so interessant, weil sie in einem noch relativ überschaubaren Umfeld bereits einige der wichtigsten Fragen und Probleme aufwerfen, die das Datenschutzrecht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die unter dem Stern der allgegenwärtigen Kommunikation stehen werden, beschäftigen werden.
Im Teil B werden rechtliche Vorschläge und Konzepte vorgestellt, die helfen könnten den Datenschutz an die heutige Bedrohungslage anzupassen.
Teil C widmet sich der technischen Entwicklung. Die neuen Herausforderungen sind auf technische Entwicklungen zurückzuführen und so ist ihnen auch mit Technik zu begegnen. Dies beginnt mit einigen „banalen“ Dingen wie den Privacy-Einstellungen, und geht hin zu datenschutzfreundlicher Software (PET), die teils bereits erhältlich und teils noch in der Entwicklung ist.
Diese kann aber nur dann wirken, wenn Sie eingesetzt wird. Und eingesetzt werden muss sie – auch - von den Betreibern der Plattformen. Daher befasst sich dieses Kapitel auch noch mit möglichen Anreizen hierzu.
Der Teil D mit der Schlussfolgerung befasst sich dann noch kurz mit dem Ausgangspunkt der personenbezogenen Daten in SNS, dem User und der Notwendigkeit diesen für seine persönlichen Daten zu sensibilisieren, wie dies zu erreichen sein könnte und er selbst erfolgreiches Identitätsmanagement vornehmen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A: Datenschutz: Entwicklung und neue Gefährdungslagen.
- ,,Informationelle Selbstbestimmung“.
- Datenschutzgrundsätze.
- Entwicklung der Anforderungen an den Datenschutz..
- 1981....
- Von der Community zur Social Network Site
- Digitale Identitäten .......
- Verkettung digitaler Identitäten
- Verkettung.
- Verkettung anhand biometrischer oder gesichtserkennender Software.
- Data Warehouse und Datamining
- ,,OPEN SOCIAL" und "API"
- Facebook und spezifische SNS-Datenschutzproblematiken
- Profilbildung.....
- Profilbildung und Verkettung innerhalb der Plattform .
- Profilbildung und Verkettung über die Seite hinaus
- Profilanreicherung mit Daten Dritter
- Weitergabe der Daten an Dritte.........
- Social Ads und Partnerprogramme
- Löschen von Profilen
- Fazit
- Weitere Gefahren und datenschutzrechtliche Probleme auf SNS ..
- Auslandsbezug / „Safe Harbour“ Principles
- Datenschutzrechtliche Einwilligung und AGB.
- Private...
- Privacy-Einstellungen bei Facebook.
- Identitätsdiebstahl und Datenklau.
- Online Mobbing
- Ausblick,,Ubiquitous Computing“.
- Fazit..
- Teil B Rechtliche Ansätze zur Verbesserung des Datenschutzes in SNS.
- Einleitung
- Strukturelle Verbesserungen
- "Informationelle Selbstbestimmung“ als Teil eines „Grundrechts auf Kommunikation“ in das Grundgesetz
- Vereinheitlichung und Entbürokratisierung.
- Einheitliche Bezeichnung …………....
- BDSG als Grundregelung und wenige Ausnahmen, keine Subsidiarität .
- Trennung zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Bereich im BDSG.
- Juristische Personen als Berechtigte
- Stärkung der Betroffenen im Datenverarbetiungsprozess..
- Einwilligung.
- Schriftform
- Einwilligung als zentrales Datenschutzelement ...
- Alternativlosigkeit und Zwangssituation
- Alternativlösungen .
- ,,In Kenntnis der Sachlage".
- Verständnisproblem Geschäftsmodell und Datenverarbeitungsfluß ..
- Widerspruchsmöglichkeiten in den AGB / Datenschutzerklärung.
- Zunächst schlechte Aussichten........
- Verstoß gegen die Vertragsautonomie?
- § 305 c BGB.
- Weitere Stärkung der Betroffenenrechte..
- Auskunft.
- Pseudonymisierung.
- Pseudonyme für die Seite.
- Anonymisierung / Pseudonymisierung nach dem Benutzen der Site bzw. zur Datenverarbeitung .
- Vorteile für den Datenschutz in SNS vorhanden
- § 3 a BDSG - Gesetzgeberisches Handeln oder Selbstverpflichtung nötig
- Gefährdungshaftung für nicht-öffentliche Stellen..........
- Fazit..
- Teil C Technischer Datenschutz
- PET- Privacy Enhancing Technologies........
- Unilateral, bilateral, trilateral
- Grundproblem.....
- Grundanforderungen an PET
- Konkrete Ansätze
- PRIME.
- P3P
- Einflussnahme auf die Entwickler und Entscheider..
- Stiftung Datenschutz
- Anreize
- Beweiserleichterung.
- Datenschutzschwarzliste.
- Marketingzwecke..
- Selbstregulierung.
- Fazit..
- Sensibilisierung.
- Erhöhung der Aufmerksamkeit durch Kommerzialisierung der personenbezogenen Daten
- Identitätsmanagement.......
- Indentitätmanagement im engeren Sinne
- Anpassung der Strukturen auf Seiten der verarbeitenden Stellen.
- Privacy-Einstellungen
- Datenbaum
- Beschwerdestelle....
- Zustimmungserfordernis für Bildertagging...
- Löschung der Daten durch den Betroffenen
- Nach der Verletzung.....
- Reputationdefender & Co ……………
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Datenschutz in „Social Network Sites“ (SNS) und analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Verkettung digitaler Identitäten ergeben. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Datenschutzes, die spezifischen Datenschutzproblematiken von SNS, insbesondere Facebook, und die rechtlichen Ansätze zur Verbesserung des Datenschutzes in diesem Bereich.
- Entwicklung des Datenschutzes und neue Gefährdungslagen
- Verkettung digitaler Identitäten in SNS
- Datenschutzrechtliche Problematiken von SNS
- Rechtliche Ansätze zur Verbesserung des Datenschutzes in SNS
- Technischer Datenschutz und Privacy Enhancing Technologies (PET)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Datenschutz in „Social Network Sites“ (SNS) dar und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Teil A beleuchtet die Entwicklung des Datenschutzes und die neuen Gefährdungslagen, die sich durch die Verbreitung von SNS ergeben. Es werden die Konzepte der „informationellen Selbstbestimmung“ und der Datenschutzgrundsätze erläutert. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Anforderungen an den Datenschutz von den Anfängen bis hin zu den heutigen Herausforderungen, die durch die Vernetzung digitaler Identitäten entstehen.
Teil B untersucht die rechtlichen Ansätze zur Verbesserung des Datenschutzes in SNS. Es werden strukturelle Verbesserungen des Datenschutzrechts diskutiert, wie z.B. die Stärkung der „informationellen Selbstbestimmung“ als Grundrecht und die Vereinheitlichung des Datenschutzrechts. Die Arbeit analysiert die Stärkung der Betroffenenrechte im Datenverarbeitungsprozess, insbesondere die Bedeutung der Einwilligung und die Möglichkeiten des Widerspruchs.
Teil C befasst sich mit dem technischen Datenschutz und den Möglichkeiten von Privacy Enhancing Technologies (PET). Es werden verschiedene Ansätze zur Verbesserung des Datenschutzes durch technische Maßnahmen vorgestellt. Die Arbeit untersucht die Rolle von Stiftungen und die Bedeutung der Selbstregulierung im Bereich des Datenschutzes.
Teil D analysiert den sozialen Komplex des Themas Datenschutz in SNS und zieht Schlussfolgerungen für die Zukunft. Es werden die Bedeutung der Sensibilisierung und die Herausforderungen des Identitätsmanagements in der digitalen Welt diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Datenschutz, Social Network Sites (SNS), Facebook, digitale Identitäten, Verkettung, Profilbildung, Privacy Enhancing Technologies (PET), rechtliche Ansätze, Selbstregulierung, Identitätsmanagement, informationelle Selbstbestimmung, Grundrechte, Einwilligung, Widerspruch, Datenschutzgrundsätze, Datenverarbeitung, Datenfluß, Auslandsbezug, Safe Harbour, Online Mobbing, Ubiquitous Computing.
- Quote paper
- Dipl.Jur., LL.M., M.A. Dominik Sedlmeir (Author), 2008, Datenschutz in Social Networks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131654