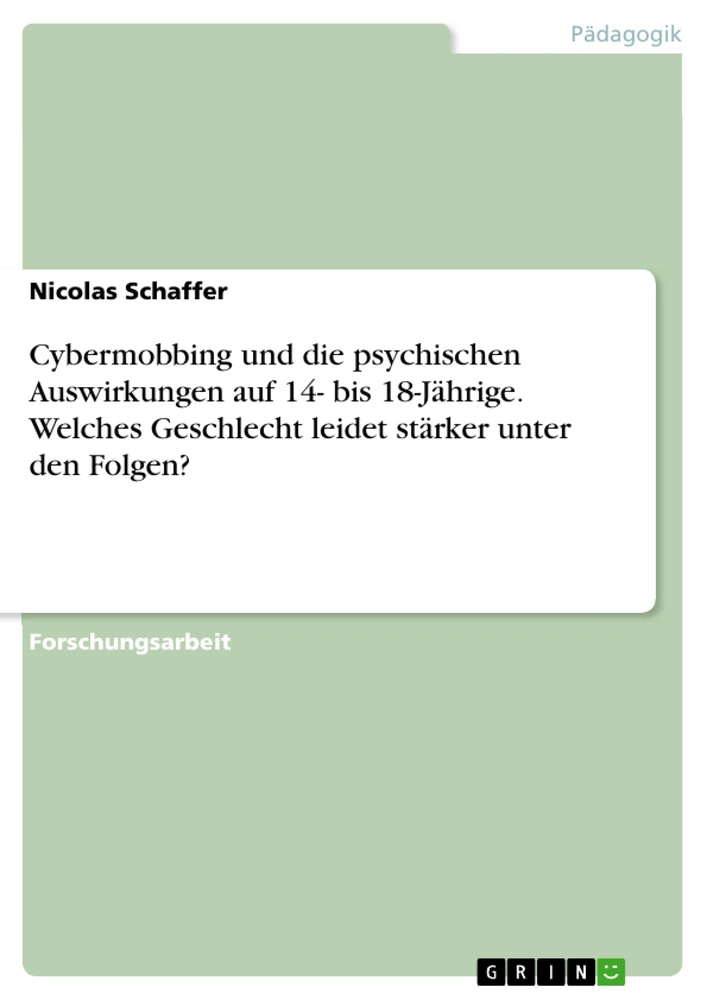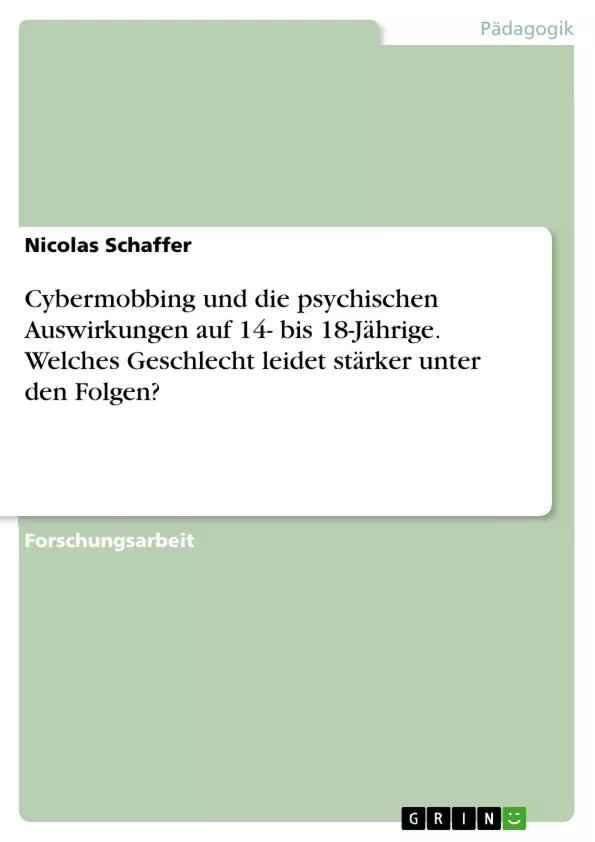In unserer Arbeit möchten wir darstellen, wie wir bei unserem Forschungsvorhaben vorgegangen sind. Zu Beginn werden wir die Begriffe Mobbing, Cybermobbing und den aktuellen Forschungsstand genauer erläutern. Danach werden wir auf die Wahl des forschungslogischen Vorgehens eingehen und die dazugehörenden theoretischen und methodologischen Grundlagen genauer erklären – was für das weitere Verständnis der Analysearbeit sehr wichtig ist. Aufgrund des Forschungsgegenstandes war es für uns von Anfang an klar, uns für eine quantitative Methode zu entscheiden. In unserem Fall war es der Online-Fragebogen. Im Anschluss daran werden wir die Analysearbeit genau erläutern und die mit der Arbeit verbundenen Vorgehensweisen nachvollziehbar aufgliedern, beginnend bei der Entwicklung der Fragestellung und der Wahl des Erhebungsinstrumentes. Danach werden wir auf den Zugang zum empirischen Feld und unsere zeitlichen Ressourcen eingehen. Am Schluss möchten wir unsere Ergebnisse und Schlussfolgerungen darlegen. Im Gesamtresümee werden wir einen kritischen Blick auf die von uns erarbeiteten Ergebnisse werfen, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen von Cybermobbing erläutern.
Vor einigen Jahren noch wurden besonders der Fernsehkonsum und das Spielen von gewaltverherrlichenden Computerspielen kritisch von Eltern und der Gesellschaft betrachtet. Heutzutage liegt der Fokus der elterlichen Sorge stärker auf der Smartphone-Nutzung der Kinder und Jugendlichen. Soziale Medien sind das Internetangebot, das Jugendliche am häufigsten nutzen und die, aufgrund der Internetverbindungen, die mittlerweile fast jedes Handy aufweist, permanent abrufbar sind. Es kann also gesagt werden, dass soziale Medien ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Lebens moderner Jugendlicher sind. Dabei dürfen jedoch die negativen Seiten der Digitalisierung nicht vernachlässigt werden. Weltweit zeigen 10 % bis 30 % der Jugendlichen ein problematisches Nutzungsverhalten bezüglich ihrer Smartphones, die unter anderem mit psychischen Schäden einhergehen. Aufgrund der bestehenden Relevanz der Thematik befasst sich diese Forschungsarbeit mit „Cybermobbing“ und dessen psychischen Auswirkungen auf 14- bis 18-Jährige.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel und Fragestellung dieses Forschungsberichts
- Theoretischer Hintergrund
- Begriffsdefinition Mobbing
- Begriffsdefinition Cybermobbing
- Psychische Auswirkungen von Cybermobbing auf die Opfer
- Motive und Auslöser von Cybermobbing
- Charakteristika von Fragebögen
- Empirisches Design: Fragebogen
- Unser Fragebogen
- Fragetypen
- Stichprobenbeschreibung und Feldzugang
- Aufbau
- Zeitplan
- Durchführung der Erhebung
- Darstellung und Interpretation
- Stichprobe
- Selbsterfahrung
- Fremderfahrung
- Darstellung und Interpretation: Hilfeleistungen
- Auswertung der 1. Frage
- Auswertung der zweiten Frage
- Auswertung der dritten Frage
- Verteilung der Befragten nach Geschlecht und Bildungstyp
- Beleidigungen im Internet über längeren Zeitraum
- Gefühle nach Beleidigungen im Internet
- Konfrontation mit Gerüchten im Internet
- Gefühle nach Gerüchteverbreitung im Internet
- Psychische Auswirkungen
- Zwischen Dunkelziffern und BeobachterInnen
- Empfundene Emotionen der Opfer von Cybermobbing
- Ein anderer Aspekt von Cybermobbing: Sexuelle Nötigung
- Resümee/Zusammenfassung
- Ausblick
- Fehlerquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Forschungsbericht beschäftigt sich mit dem Phänomen des Cybermobbings und seinen psychischen Auswirkungen auf Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die zentrale Fragestellung lautet, welche psychischen Folgen Cybermobbing bei Jugendlichen hervorruft und ob es dabei geschlechtsspezifische Unterschiede gibt.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing und Cybermobbing
- Psychische Auswirkungen von Cybermobbing auf Opfer
- Motive und Auslöser von Cybermobbing
- Empirische Untersuchung mittels Online-Fragebogen
- Interpretation der Ergebnisse und Relevanz für die Sozialpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Cybermobbing ein und erläutert die Relevanz der Forschung. Kapitel 2 definiert die Forschungsfragen und das Ziel des Projekts. Kapitel 3 liefert den theoretischen Hintergrund und beleuchtet die Begriffsdefinitionen von Mobbing und Cybermobbing sowie die psychischen Auswirkungen von Cybermobbing auf die Opfer. Kapitel 4 beschreibt das empirische Design, den Aufbau und die Durchführung des Online-Fragebogens. Die Kapitel 5 bis 7 präsentieren die Ergebnisse der Untersuchung. Dabei werden die Stichprobe, die Selbsterfahrungen und Fremderfahrungen der Jugendlichen sowie die Hilfestellungen und die Verteilung der Befragten nach Geschlecht und Bildungstyp analysiert. Kapitel 8 untersucht die psychischen Auswirkungen von Cybermobbing, inklusive der empfundenen Emotionen der Opfer und der Thematik der sexuellen Nötigung. Das Resümee in Kapitel 9 fasst die Ergebnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Mobbing, Psychische Auswirkungen, Jugendliche, Online-Fragebogen, Sozialpädagogik, Prävention, Interaktion, Digitalisierung, Mediennutzung, Soziale Medien, Internet, Empirische Forschung, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing?
Cybermobbing findet im digitalen Raum (Internet, soziale Medien) statt, ist permanent abrufbar und erreicht oft ein viel größeres Publikum als klassisches Mobbing.
Welche psychischen Folgen hat Cybermobbing für Jugendliche?
Die Folgen reichen von Angstzuständen, Depressionen und Schlafstörungen bis hin zu einem massiven Verlust des Selbstwertgefühls.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Auswirkungen?
Die Forschungsarbeit untersucht gezielt, ob Jungen oder Mädchen stärker unter den Folgen leiden, wobei oft unterschiedliche Bewältigungsstrategien und Emotionen beobachtet werden.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die Forscher nutzten eine quantitative Methode in Form eines Online-Fragebogens, der sich an 14- bis 18-jährige Jugendliche richtete.
Welche Rolle spielen soziale Medien beim Cybermobbing?
Soziale Medien sind der Hauptschauplatz für Cybermobbing, da sie eine schnelle Verbreitung von Gerüchten und Beleidigungen rund um die Uhr ermöglichen.
- Quote paper
- Nicolas Schaffer (Author), 2021, Cybermobbing und die psychischen Auswirkungen auf 14- bis 18-Jährige. Welches Geschlecht leidet stärker unter den Folgen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316615