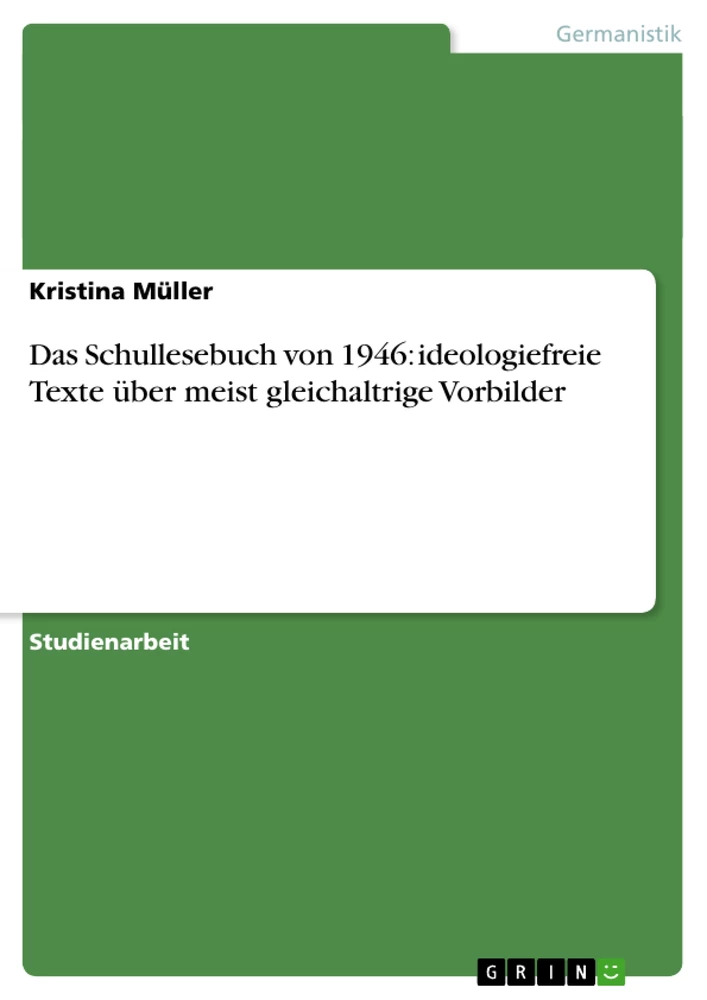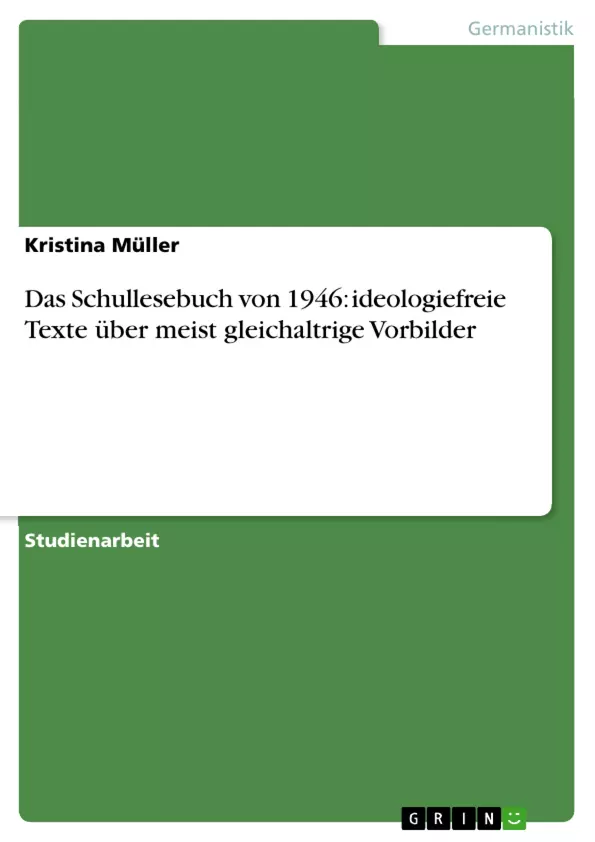Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Schullesebuch „Von Tieren und Menschen“ von 1946, das als eines der ersten in der Nachkriegszeit in der Schule Verwendung fand. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und inwieweit die im Lesebuch enthaltenen Texte bereits Anzeichen der späteren Ideologie der Deutschen Demokratischen Republik enthalten oder transportieren. Daneben soll auch geklärt werden, ob die Personen überwiegend gleichaltrige Vorbilder sind. Die für die Bildungspolitik Verantwortlichen jener Zeit mussten sehr schnell entscheiden, welche Texte sie in das neue Lesebuch aufnehmen wollten. Deshalb habe ich mich in Kapitel 2 mit den Vorstellungen und Erwartungen der Regierung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bezüglich der Aufgaben und Ziele der neu- en Schule beschäftigt. Bei dieser Untersuchung stütze ich mich auf das „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ von 1946 und die Ausführungen Joachim Hohmanns zu diesem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische und bildungspolitische Einordnung des 1946er Schullesebuches
- Allgemeine Analyse des 1946er Schullesebuches
- Quantitative Analyse
- Qualitative Analyse
- Frequenzanalyse
- Nachweis der Ideologiefreiheit an ausgewählten Texten
- „Hochwasser“ von Georg Sicker
- „Gelernt ist gelernt“ von Adolf Ryssel
- Schlussfolgerung: Transportiert das 1946er Schullesebuch Ideologie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Schullesebuch „Von Tieren und Menschen“ aus dem Jahr 1946 auf seinen ideologischen Gehalt im Kontext der frühen Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Ziel ist es, herauszufinden, ob die Texte Anzeichen der späteren DDR-Ideologie aufweisen und ob die dargestellten Personen vorwiegend gleichaltrige Vorbilder für die Schüler darstellen. Die Analyse berücksichtigt den historischen und bildungspolitischen Hintergrund der Entstehung des Lesebuchs.
- Historische Einordnung des Lesebuchs in die Nachkriegszeit und die antifaschistisch-demokratische Schulreform.
- Quantitative und qualitative Analyse der Texte im Lesebuch hinsichtlich ihrer stilistischen Merkmale und Entstehungszeit.
- Untersuchung ausgewählter Texte auf ihren ideologischen Gehalt.
- Bewertung der Auswahl der Texte im Hinblick auf die Darstellung von Vorbildern für Kinder.
- Zusammenfassende Beurteilung, ob das Lesebuch eine spezifische Ideologie transportiert.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse des Schullesebuchs „Von Tieren und Menschen“ von 1946 auf seinen möglichen ideologischen Gehalt und die Darstellung von Vorbildern. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen. Die Bedeutung von Schulbüchern als Zeugnisse kultureller Überlieferung und gesellschaftlicher Verhältnisse wird hervorgehoben.
2. Historische und bildungspolitische Einordnung des 1946er Schullesebuches: Dieses Kapitel ordnet das Schullesebuch in den historischen und bildungspolitischen Kontext der frühen Nachkriegszeit in der SBZ ein. Es beschreibt die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen, die Gründung der SMAD und die antifaschistisch-demokratische Schulreform. Das „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ von 1946 und die damit verbundenen Ziele und Erwartungen an den Deutschunterricht werden analysiert. Die Bedeutung des Deutschunterrichts als Mittel zur Erziehung und Formung der jungen Generation wird hervorgehoben, ebenso wie die Rolle des Lesebuchs in diesem Kontext.
3. Allgemeine Analyse des 1946er Schullesebuches: Kapitel 3 präsentiert eine umfassende Analyse des Schullesebuchs, unterteilt in quantitative, qualitative und Frequenzanalyse. Die quantitative Analyse untersucht die Anzahl und Art der Texte (Prosa, Lyrik, Drama), ihre Entstehungszeit und die Herkunft der Autoren. Die Ergebnisse zeigen eine Dominanz von Prosatexten, die zum Großteil vor 1945 entstanden sind und von Autoren, die nicht aus der SBZ oder der Sowjetunion stammen. Die qualitative Analyse befasst sich mit dem Stil der Texte und identifiziert verschiedene Stilformen. Die Frequenzanalyse (nicht im Auszug enthalten) würde die Häufigkeit bestimmter Wörter oder Themen untersuchen.
Schlüsselwörter
Schullesebuch, 1946, SBZ, DDR, Ideologie, Antifaschistisch-demokratische Schulreform, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Nachkriegszeit, Bildungspolitik, Deutschunterricht, Vorbilder.
Häufig gestellte Fragen zum Schullesebuch "Von Tieren und Menschen" (1946)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Schullesebuch „Von Tieren und Menschen“ aus dem Jahr 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) auf seinen ideologischen Gehalt und die Darstellung von Vorbildern für Schüler. Der Fokus liegt darauf, Anzeichen späterer DDR-Ideologie in den Texten zu identifizieren.
Welche Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse umfasst die historische und bildungspolitische Einordnung des Lesebuchs in die unmittelbare Nachkriegszeit und die antifaschistisch-demokratische Schulreform. Sie beinhaltet eine quantitative und qualitative Analyse der Texte, die Untersuchung ausgewählter Texte auf ihren ideologischen Gehalt sowie eine Bewertung der Textauswahl im Hinblick auf die Darstellung von Vorbildern.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet quantitative Methoden zur Analyse der Anzahl und Art der Texte, ihrer Entstehungszeit und der Herkunft der Autoren. Qualitative Methoden untersuchen den Stil der Texte und identifizieren verschiedene Stilformen. Eine Frequenzanalyse (im Auszug nicht detailliert dargestellt) würde die Häufigkeit bestimmter Wörter oder Themen untersuchen.
Welche konkreten Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Texte „Hochwasser“ von Georg Sicker und „Gelernt ist gelernt“ von Adolf Ryssel, um den ideologischen Gehalt zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen und bildungspolitischen Einordnung des Lesebuchs, ein Kapitel zur allgemeinen Analyse (quantitativ, qualitativ, Frequenzanalyse), ein Kapitel zum Nachweis der Ideologiefreiheit an ausgewählten Texten und eine Schlussfolgerung, die die Frage nach dem ideologischen Gehalt des Lesebuchs beantwortet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung der Arbeit beantwortet die Frage, ob das Schullesebuch von 1946 eine spezifische Ideologie transportiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen sowie der Einzeltextanalysen bildet die Grundlage für diese Beurteilung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schullesebuch, 1946, SBZ, DDR, Ideologie, Antifaschistisch-demokratische Schulreform, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Nachkriegszeit, Bildungspolitik, Deutschunterricht, Vorbilder.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob das Schullesebuch von 1946 Anzeichen der späteren DDR-Ideologie aufweist und ob die dargestellten Personen vorwiegend gleichaltrige Vorbilder für die Schüler darstellen.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Der historische Kontext wird durch die Einordnung des Lesebuchs in die unmittelbare Nachkriegszeit der SBZ und die antifaschistisch-demokratische Schulreform berücksichtigt. Das "Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule" von 1946 und seine Ziele werden analysiert.
- Citation du texte
- Kristina Müller (Auteur), 2006, Das Schullesebuch von 1946: ideologiefreie Texte über meist gleichaltrige Vorbilder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131670