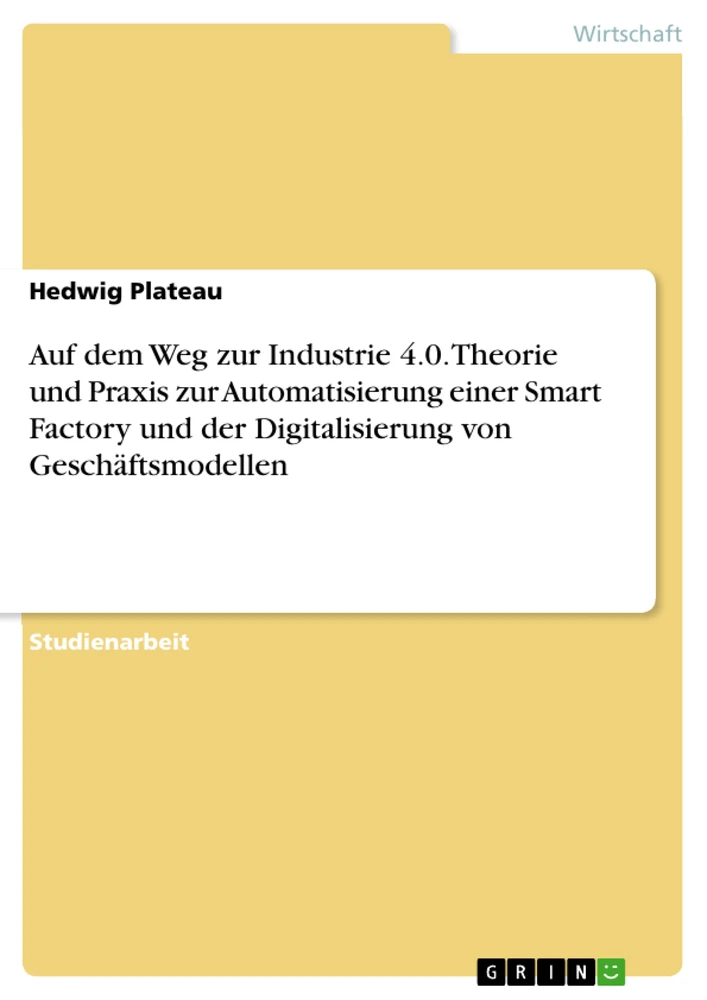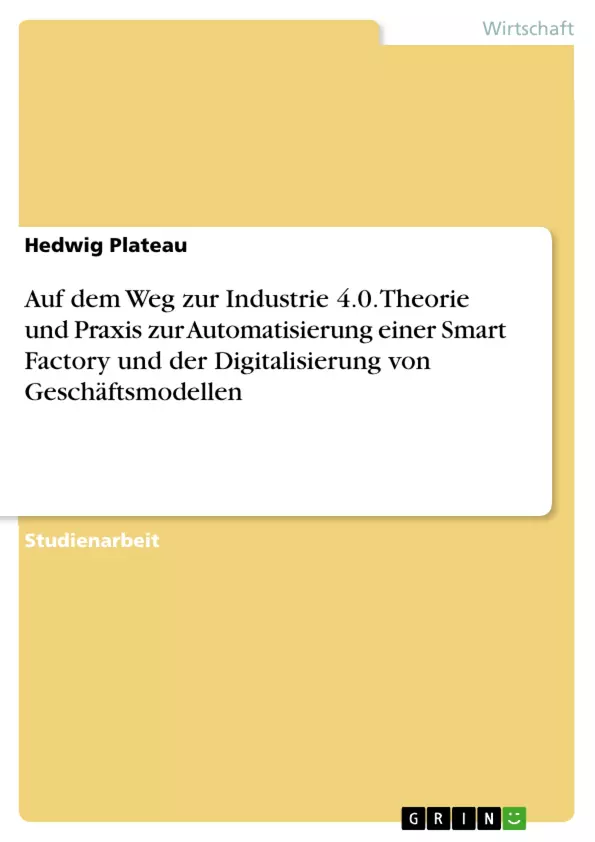Die Hausarbeit begleitet das fiktive mittelständische Familienunternehmen Lacquer GmbH auf dem Weg zur Industrie 4.0. Als Unternehmen aus der Lackindustrie stellt Lacquer Speziallacke für verschiedene Branchen her, wobei insgesamt 320 Mitarbeiter im In- und Ausland beschäftigt sind. Infolge der Globalisierung sowie des wachsenden E-Commerce wird die Anzahl an Konkurrenten am Markt immer größer, die den Wettbewerb etwa durch zusätzliche Produktangebote verstärken und so die Lacquer GmbH unter Druck setzen. Für den Unternehmensinhaber von Lacquer spielt die Digitalisierung eine elementare Rolle, weshalb diese Thematik tief in der Unternehmensstrategie verankert ist. Der CDO, der die Verantwortung für die Digitalisierung und das Supply Chain Management innerhalb des Unternehmens trägt, gerät öfters mit dem Unternehmensinhaber aneinander. Dabei werden Fachausdrücke differenziert betrachtet und ausgelegt, wobei sich beide Akteure schlicht und einfach missverstehen.
Vor diesem Hintergrund soll in der vorliegenden Hausarbeit ein Konzept für die digitale Produktion und das Supply Chain Management der Lacquer GmbH entwickelt werden. Diese Konzept beruht auf eindeutig festgelegten Zielen, um klare Maßnahmen verwirklichen und eine strukturierte Strategie nachhaltig sicherstellen zu können. Hierbei sollen der Inhaber und CDO in Zukunft eine übereinstimmende Auffassung zur digitalen Produktion und zum Supply Chain Management erlangen.
Die Hausarbeit enthält fünf Kapitel. Nachdem das erste Kapitel die Ausgangslage beschreibt, wird im darauffolgenden Kapitel der Theorieteil behandelt, sodass ausgewählte Fachbegriffe definiert und voneinander abgegrenzt werden. Zudem werden die Industrie 4.0-Roadmap sowie das Industrie 4.0-Reifegradmodell als Gesamtvorgehen begutachtet. Basierend auf den Grundlagen ordnet das dritte Kapitel den Ist-Zustand ein, indem das fiktive Familienunternehmen vorgestellt wird und bestehende Lücken und Abweichungen zwischen den Protagonisten und der Theorie aufgezeigt werden. Weiterführend wird im vierten Kapitel ein Soll-Zustand diskutiert, der die Entwicklung des Unternehmens zur Industrie 4.0 darstellt und den Nutzen der Umsetzung widerspiegelt. Im letzten Abschnitt findet eine Abschlussdiskussion statt, welche die Erkenntnisse und Grenzen der Arbeit beinhaltet. Die Hausarbeit schließt mit einem Fazit ab, welches neben einer kritischen Bewertung auch einen Ausblick enthält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der Industrie 4.0
- Definition und begriffliche Abgrenzung
- Vorstellung der Industrie 4.0-Roadmap
- Einführung des Industrie 4.0-Reifegradmodells
- Ist-Zustand
- Vorstellung des Unternehmens Lacquer GmbH
- Anwendung des Industrie 4.0-Reifegradmodells
- Soll-Zustand
- Industrie 4.0-Roadmap zur Lückenschließung
- Abschlussdiskussion
- Erkenntnisse und Grenzen der Hausarbeit
- Fazit der Hausarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, ein Konzept für die digitale Produktion und das Supply Chain Management der fiktiven Lacquer GmbH zu entwickeln. Es soll eine Brücke zwischen der Unternehmensstrategie und der praktischen Umsetzung von Industrie 4.0-Prinzipien geschlagen werden, um Missverständnisse zwischen dem Unternehmensinhaber und dem CDO zu beseitigen und eine gemeinsame Vision zu schaffen. Das Konzept basiert auf klar definierten Zielen und messbaren Maßnahmen.
- Analyse der Ausgangssituation der Lacquer GmbH im Kontext der Industrie 4.0.
- Definition und Abgrenzung relevanter Begriffe der Industrie 4.0.
- Anwendung eines Industrie 4.0-Reifegradmodells zur Bewertung des Ist-Zustands.
- Entwicklung einer Roadmap zur Schließung der identifizierten Lücken.
- Diskussion der Ergebnisse und Grenzen des entwickelten Konzepts.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Lacquer GmbH, ein mittelständisches Familienunternehmen der Lackindustrie, vor und beschreibt die Herausforderungen durch Globalisierung und wachsenden Wettbewerb. Der Konflikt zwischen dem Unternehmensinhaber und dem CDO bezüglich der Digitalisierungsstrategie wird hervorgehoben. Die Arbeit zielt darauf ab, ein Konzept für die digitale Transformation des Unternehmens zu entwickeln, das zu einer gemeinsamen Auffassung über digitale Produktion und Supply Chain Management führt.
Grundlagen der Industrie 4.0: Dieses Kapitel definiert und grenzt zentrale Begriffe der Industrie 4.0 ab. Es werden die Industrie 4.0-Roadmap und ein Reifegradmodell vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse und Gestaltung der digitalen Transformation der Lacquer GmbH dienen. Die Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen und die methodischen Ansätze, die im weiteren Verlauf der Arbeit Anwendung finden werden.
Ist-Zustand: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse des Ist-Zustands der Lacquer GmbH. Das Unternehmensprofil wird vorgestellt und das Industrie 4.0-Reifegradmodell wird angewendet, um den aktuellen Stand der Digitalisierung zu bewerten. Die Analyse identifiziert konkrete Lücken und Diskrepanzen zwischen der bestehenden Praxis und den Zielen der Industrie 4.0-Strategie. Der Fokus liegt auf der Aufdeckung der Herausforderungen und der Erkennung von Verbesserungspotenzialen.
Schlüsselwörter
Industrie 4.0, Digitale Transformation, Supply Chain Management, Reifegradmodell, Roadmap, Digitalisierung, mittelständisches Unternehmen, Lacquer GmbH, CDO, Konfliktlösung, digitale Produktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Digitale Transformation der Lacquer GmbH
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit entwickelt ein Konzept für die digitale Produktion und das Supply Chain Management der fiktiven Lacquer GmbH, einem mittelständischen Familienunternehmen der Lackindustrie. Ziel ist es, eine Brücke zwischen Unternehmensstrategie und praktischer Umsetzung von Industrie 4.0-Prinzipien zu schlagen und Missverständnisse zwischen dem Unternehmensinhaber und dem CDO zu beseitigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Analyse der Ausgangssituation der Lacquer GmbH im Kontext von Industrie 4.0, die Definition und Abgrenzung relevanter Begriffe, die Anwendung eines Industrie 4.0-Reifegradmodells, die Entwicklung einer Roadmap zur Schließung identifizierter Lücken und die Diskussion der Ergebnisse und Grenzen des entwickelten Konzepts.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet ein Industrie 4.0-Reifegradmodell zur Bewertung des Ist-Zustands der Lacquer GmbH und entwickelt eine Roadmap zur Schließung der identifizierten Lücken. Die theoretischen Grundlagen und methodischen Ansätze werden im Kapitel "Grundlagen der Industrie 4.0" erläutert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung (Ausgangssituation, Aufbau der Arbeit), Grundlagen der Industrie 4.0 (Definitionen, Roadmap, Reifegradmodell), Ist-Zustand (Unternehmensprofil, Reifegradmodell-Anwendung), Soll-Zustand (Roadmap zur Lückenschließung) und Abschlussdiskussion (Erkenntnisse, Grenzen, Fazit).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Hausarbeit liefert ein konkretes Konzept für die digitale Transformation der Lacquer GmbH, einschließlich einer Roadmap zur Umsetzung von Industrie 4.0-Prinzipien. Sie identifiziert Lücken im Ist-Zustand und schlägt Maßnahmen zur Schließung dieser Lücken vor. Die Ergebnisse tragen zur Konfliktlösung zwischen dem Unternehmensinhaber und dem CDO bei und schaffen eine gemeinsame Vision für die digitale Zukunft des Unternehmens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Industrie 4.0, Digitale Transformation, Supply Chain Management, Reifegradmodell, Roadmap, Digitalisierung, mittelständisches Unternehmen, Lacquer GmbH, CDO, Konfliktlösung, digitale Produktion.
Wo finde ich detaillierte Informationen zum Ist-Zustand der Lacquer GmbH?
Kapitel "Ist-Zustand" präsentiert eine detaillierte Analyse, inklusive der Anwendung des Industrie 4.0-Reifegradmodells zur Bewertung des aktuellen Digitalisierungsgrades und der Identifizierung von Lücken und Verbesserungspotenzialen.
Wie wird die Roadmap zur Schließung der identifizierten Lücken beschrieben?
Die Roadmap zur Schließung der identifizierten Lücken wird im Kapitel "Soll-Zustand" detailliert dargestellt. Sie beschreibt konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Industrie 4.0-Strategie.
Welche Herausforderungen werden in der Hausarbeit diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert die Herausforderungen der Globalisierung und des wachsenden Wettbewerbs für die Lacquer GmbH, sowie den Konflikt zwischen dem Unternehmensinhaber und dem CDO bezüglich der Digitalisierungsstrategie. Die Arbeit analysiert die Lücken zwischen dem Ist- und Soll-Zustand bezüglich der Digitalisierung.
- Quote paper
- Hedwig Plateau (Author), 2023, Auf dem Weg zur Industrie 4.0. Theorie und Praxis zur Automatisierung einer Smart Factory und der Digitalisierung von Geschäftsmodellen am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1318007