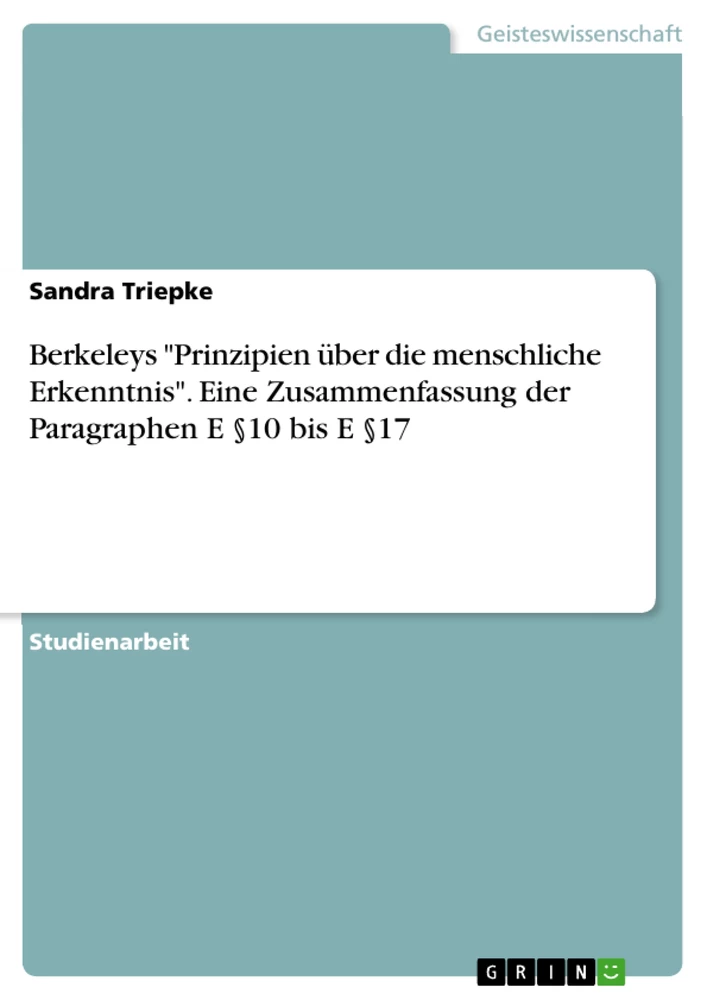Das 18. Jh. gehört zu den Blütezeiten der philosophischen Ära. Neue Denkrichtungen veranlassen den Philosophen zu neuen Begründungen, neuen Beweisdarlegungen. Neben den Rationalisten Réné Descartes und Baruch Spinoza treten die Empiristen, John Locke und David Hume in Erscheinung. Mithilfe ihrer Theorien soll die Welt und ihr Sein der Dinge erklärt werden, welche wiederum andere Denkweisen ins Leben rufen.
Die Rede ist vom Skeptizismus, Atheismus und dem Deismus, die eine treibende Kraft gegen die theologischen Philosophien darstellt. Diese mit beweiskräftigen Aussagen zu bekämpfen, ist das Ziel der Idealisten, wie George Berkeley. Der Kern dieser Philosophie ist die Verneinung über die Existenz der Außenwelt und die Behauptung, wir schließen alles Sein der Dinge aus unseren Wahrnehmungen. Das ist letzten Endes die Erkenntnis der Wirklichkeit, nämlich dass wir, das Subjekt, mithilfe von unseren Sinnen unsere Umwelt kreieren.
Diese Theorie trägt von dem irischen Theologen George Berkeley stark beeinflusst den Begriff des Immaterialismus. Der Immaterialismus richtet sich in erster Linie gegen die so genannten Irreligionen, dem Freidenkertum, den Materialisten. Wie Letzteres verdeutlicht, sind die Anhänger der festen Überzeugung, dass die Welt aus Materie, „das bloß Gegebene, das an sich durch keine Operation der Vorstellungskraft ist“ , also einer vom Wahrnehmen und Denken unabhängigen Außenwelt besteht. Diesen Irrglauben zu widerlegen und den hierfür erforderlichen empirischen Fakt, auch proof , zu liefern, gibt George Berkeley 1710 den Anlass für sein Hauptwerk Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Der Leitfaden windet sich um eine aussagekräftige These: „Esse est percipi“ [Sein ist Wahrgenommenwerden] .
Dabei bezieht sich sein Argumentationsaufbau immer wieder auf das Werk An Essay Concerning the Human Understanding (1690) des berühmten englischen Philosophen John Locke. Besonders in den Paragraphen § 10 bis § 17 der Einleitung, welche in den folgenden Absätzen zusammengefasst werden, widerlegt Berkeley die Behauptungen seines Mitstreiters.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- George Berkeley
- Eine Kurzbiographie
- Zusammenfassung E §10 bis E § 17
- Inhaltsangabe
- E § 10
- E § 11 bis E §13
- E § 14
- E § 15 und E §16
- E § 17
- Schlusswort
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Paragraphen E § 10 bis E § 17 aus George Berkeleys Hauptwerk „Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis“. Die Arbeit zielt darauf ab, Berkeleys Kritik an John Lockes Abstraktionslehre zu beleuchten und seine eigene immaterielle Sichtweise auf die Welt zu erläutern.
- Berkeleys Kritik an Lockes Abstraktionslehre
- Die Rolle der Wahrnehmung in Berkeleys Philosophie
- Die Bedeutung von „Esse est percipi“ (Sein ist wahrgenommen werden)
- Die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen Ideen
- Die Auswirkungen von Berkeleys Philosophie auf die Religion und die Metaphysik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den historischen Kontext von Berkeleys Philosophie dar. Sie beleuchtet die philosophischen Strömungen des 18. Jahrhunderts und die Bedeutung des Empirismus für Berkeleys Denken.
Der Abschnitt über George Berkeley bietet eine kurze Biographie des irischen Philosophen und beleuchtet seine wichtigsten Werke und Lebensstationen.
Die Zusammenfassung der Paragraphen E § 10 bis E § 17 stellt Berkeleys Kritik an Lockes Abstraktionslehre dar. Sie analysiert die einzelnen Argumente Berkeleys und zeigt, wie er die Existenz von abstrakten Ideen in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen George Berkeley, John Locke, Abstraktionslehre, Immaterialismus, „Esse est percipi“, Wahrnehmung, einfache Ideen, komplexe Ideen, Kritik, Philosophie, Empirismus, Idealismus, Religion, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Berkeleys Leitsatz "Esse est percipi"?
Es bedeutet "Sein ist Wahrgenommenwerden". Berkeley vertritt die Ansicht, dass Dinge nur existieren, weil sie von einem Subjekt wahrgenommen werden.
Was kritisiert Berkeley an John Locke?
Berkeley widerlegt vor allem Lockes Abstraktionslehre und die Vorstellung, dass es eine von der Wahrnehmung unabhängige materielle Außenwelt gibt.
Was ist Immaterialismus?
Der Immaterialismus ist Berkeleys Philosophie, die die Existenz unbelebter Materie verneint und stattdessen behauptet, dass alles Sein aus Ideen und Geistern besteht.
Gegen welche Strömungen richtet sich Berkeleys Werk?
Seine Theorie richtet sich gegen Skeptizismus, Atheismus und Materialismus, um die Rolle Gottes und des Geistes in der Welt zu stärken.
Wie kreieren wir laut Berkeley unsere Umwelt?
Das Subjekt kreiert seine Umwelt mithilfe seiner Sinne; die Wirklichkeit ist somit das Ergebnis unserer Wahrnehmungen.
- Citation du texte
- Sandra Triepke (Auteur), 2007, Berkeleys "Prinzipien über die menschliche Erkenntnis". Eine Zusammenfassung der Paragraphen E §10 bis E §17, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131851