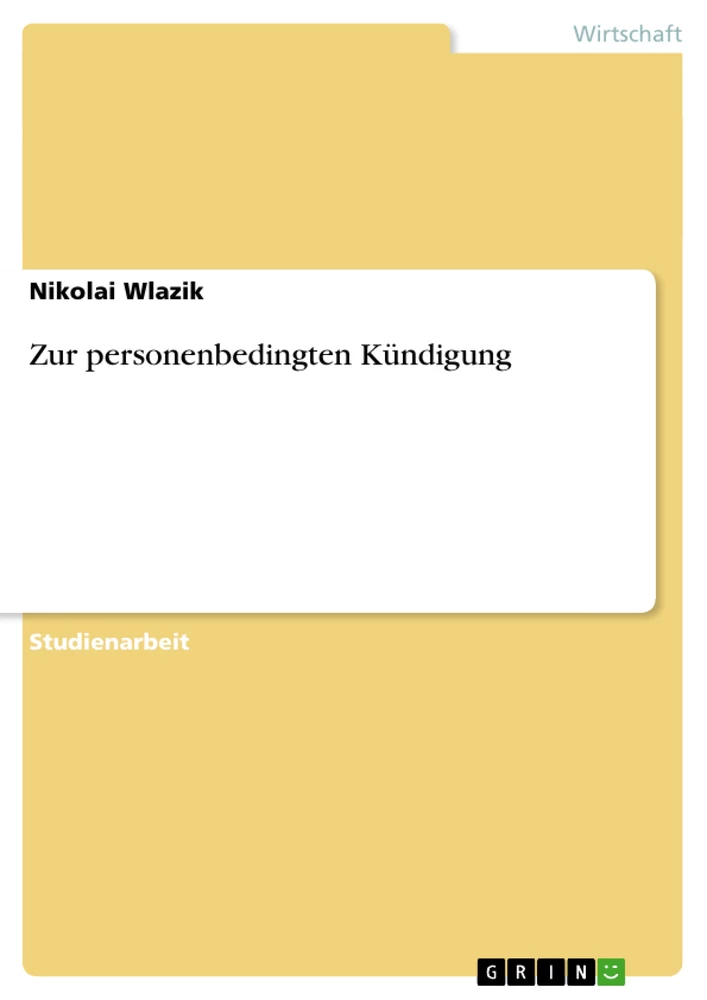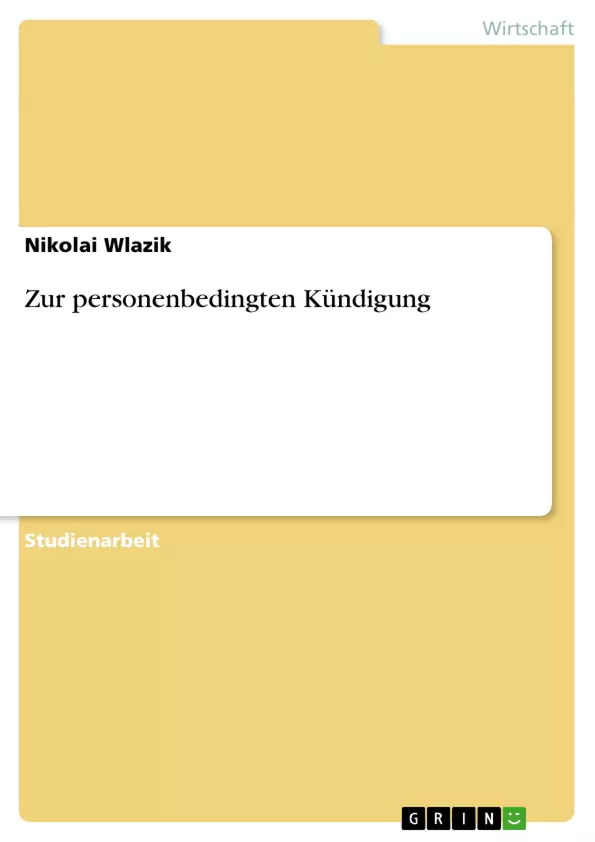I Allgemeine Grundlagen
I.1 Personenkreis
Im Kündigungsschutzgesetz bezieht sich die Schutzfunktion grundsätzlich auf alle Arbeitnehmer.
Der Begriff des Arbeitnehmers ist im Gesetz jedoch nicht genau definiert,
sodass hierfür auf allgemeine arbeitsrechtliche Grundsätze, insbesondere der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts zurückgegriffen wird. Hiernach werden als Arbeitnehmer
diejenigen bezeichnet, welche im Rahmen einer von Dritten bestimmten Arbeitsorganisation
und in persönlicher Abhängigkeit Dienstleistungen erbringen.
Dabei
ist nicht relevant, wie Vertragsinhalte formuliert sind, sondern vielmehr die tatsächliche
Durchführung der Vertragsinhalte.
I.2 Betriebsbezug
Für den Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes kommen Betriebe, Unternehmen
und Konzerne in Betracht; auch wenn letztere nicht namentlich erwähnt werden.
Für Kleinbetriebe gilt das Kündigungsschutzgesetz allerdings nicht. Unter einem
„Kleinbetrieb“ versteht man nach aktuellem Recht gemäß § 23 KSchG Betriebe und
Verwaltungen, die in der Regel weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftigen. Damit
wird den Kleinbetrieben ein Privileg eingeräumt, da diese weniger leistungsfähig sind
und größere Flexibilität benötigen, um Arbeitsverhältnisse zu beenden.
Es greift jedoch eine Sonderregelung für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits
vor dem 01.01.2004 bestanden hat. Hier gilt der alte Schwellenwert von 5 Arbeitnehmern.
Dies führt dazu, dass es bei Betrieben mit 5 bis 9 Arbeitnehmern zu einer „zwei
Klassen-Aufteilung“ kommt. Wird ein weiterer Arbeitnehmer beschäftigt und wächst
der Personalbestand dadurch auf z.B. 8 Arbeitnehmer, so greift für diesen Arbeitnehmer
nicht das Kündigungsschutzgesetz. Alle anderen Arbeitnehmer genießen jedoch den
Schutz (unter der Voraussetzung, dass die Arbeitnehmer bereits vor dem 01.01.2004 bei
diesem Arbeitgeber beschäftigt waren).
Bei der Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmer wird in der Regel auf die Personalstärke
abgestellt, die für den Betrieb im Allgemeinen kennzeichnend ist. Dabei werden
Arbeitnehmer rein rechnerisch mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und mit nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 bewertet.
Es kommt also nicht auf die reine Kopfzahl an.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine Grundlagen
- Personenkreis
- Betriebsbezug
- Wartezeit
- Die Kündigung
- Die personenbedingte Kündigung
- Voraussetzungen
- Krankheitsbedingte Gründe
- Gründe in der Person
- Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen
- Ultima-Ratio-Prinzip
- Negativprognose
- Interessenabwägung
- Auswahl verschiedener Gründe in der Person
- Langanhaltende Krankheit
- Kurzerkrankungen
- Dauernde Leistungsunmöglichkeit
- Krankheitsbedingte Minderung der Leistungsfähigkeit
- Kündigung aus Fürsorge
- Einzelne personenbedingte Kündigungsgründe
- Alkohol- und Drogensucht
- Kündigung aus Altersgründen
- Fehlende Erlaubnis
- Inhaftierung
- Straftaten
- Ehe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Voraussetzungen der personenbedingten Kündigung
- Krankheitsbedingte Kündigungsgründe
- Interessenabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Rechtliche Rahmenbedingungen der personenbedingten Kündigung
- Beispiele für personenbedingte Kündigungsgründe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der personenbedingten Kündigung im Arbeitsrecht. Ziel ist es, die rechtlichen Voraussetzungen und die Anwendung dieser Kündigungsform im Detail zu analysieren. Dabei werden die verschiedenen Gründe für eine personenbedingte Kündigung, die Interessenabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die allgemeinen Grundlagen des Kündigungsschutzgesetzes. Hier werden der Personenkreis, der Betriebsbezug, die Wartezeit und die Kündigung als Rechtsakt erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich der personenbedingten Kündigung. Es werden die Voraussetzungen für eine personenbedingte Kündigung, insbesondere die krankheitsbedingten Gründe, die Interessenabwägung und die Auswahl verschiedener Gründe in der Person, detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die personenbedingte Kündigung, das Kündigungsschutzgesetz, krankheitsbedingte Gründe, Interessenabwägung, Ultima-Ratio-Prinzip, Negativprognose, Alkohol- und Drogensucht, Kündigung aus Altersgründen, fehlende Erlaubnis, Inhaftierung, Straftaten und Ehe. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Anwendung der personenbedingten Kündigung im Arbeitsrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine personenbedingte Kündigung?
Es ist eine Kündigung, die auf Gründen in der Person des Arbeitnehmers basiert, wie z.B. mangelnde Eignung oder langanhaltende Krankheit, die die betrieblichen Interessen beeinträchtigen.
Wann ist eine krankheitsbedingte Kündigung rechtmäßig?
Voraussetzungen sind eine negative Gesundheitsprognose, eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen und eine Interessenabwägung, die zugunsten des Arbeitgebers ausfällt.
Gilt das Kündigungsschutzgesetz in jedem Betrieb?
Nein, es gilt nicht für Kleinbetriebe, die in der Regel weniger als zehn (bzw. nach Altregelung fünf) Arbeitnehmer beschäftigen.
Was besagt das "Ultima-Ratio-Prinzip"?
Die Kündigung darf erst als letztes Mittel ausgesprochen werden, wenn keine milderen Mittel (wie Versetzung oder Umschulung) möglich sind.
Können auch Straftaten oder Suchterkrankungen Kündigungsgründe sein?
Ja, Alkohol- und Drogensucht sowie Inhaftierungen oder schwere Straftaten können Gründe für eine personenbedingte Kündigung darstellen, wenn sie die Arbeitseignung aufheben.
- Quote paper
- Dipl. Kfm. (FH) Nikolai Wlazik (Author), 2005, Zur personenbedingten Kündigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131855