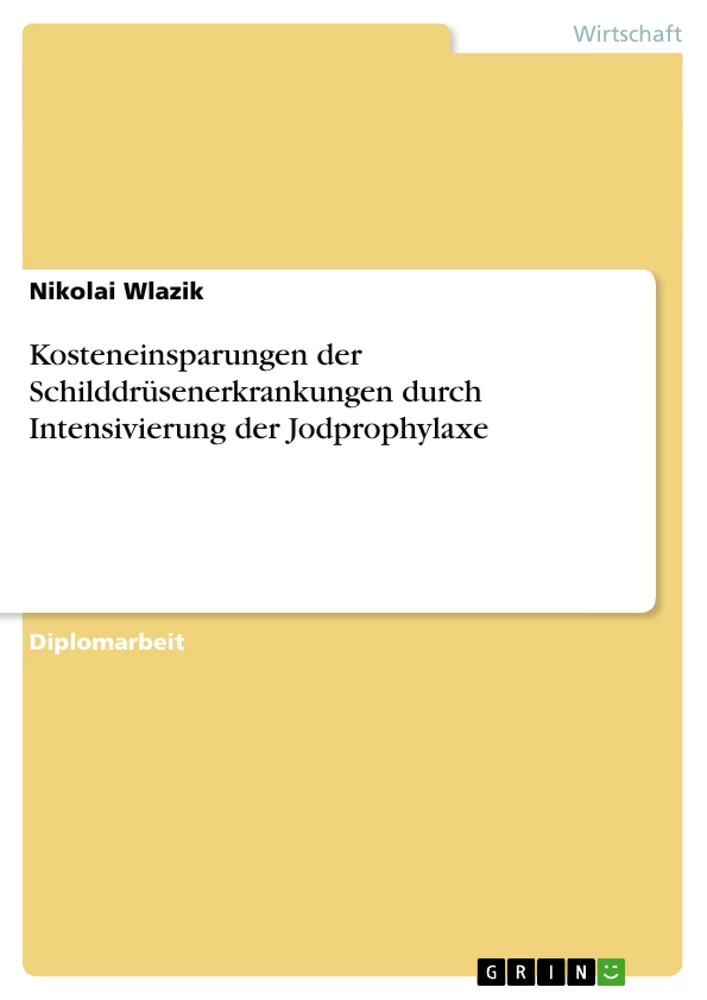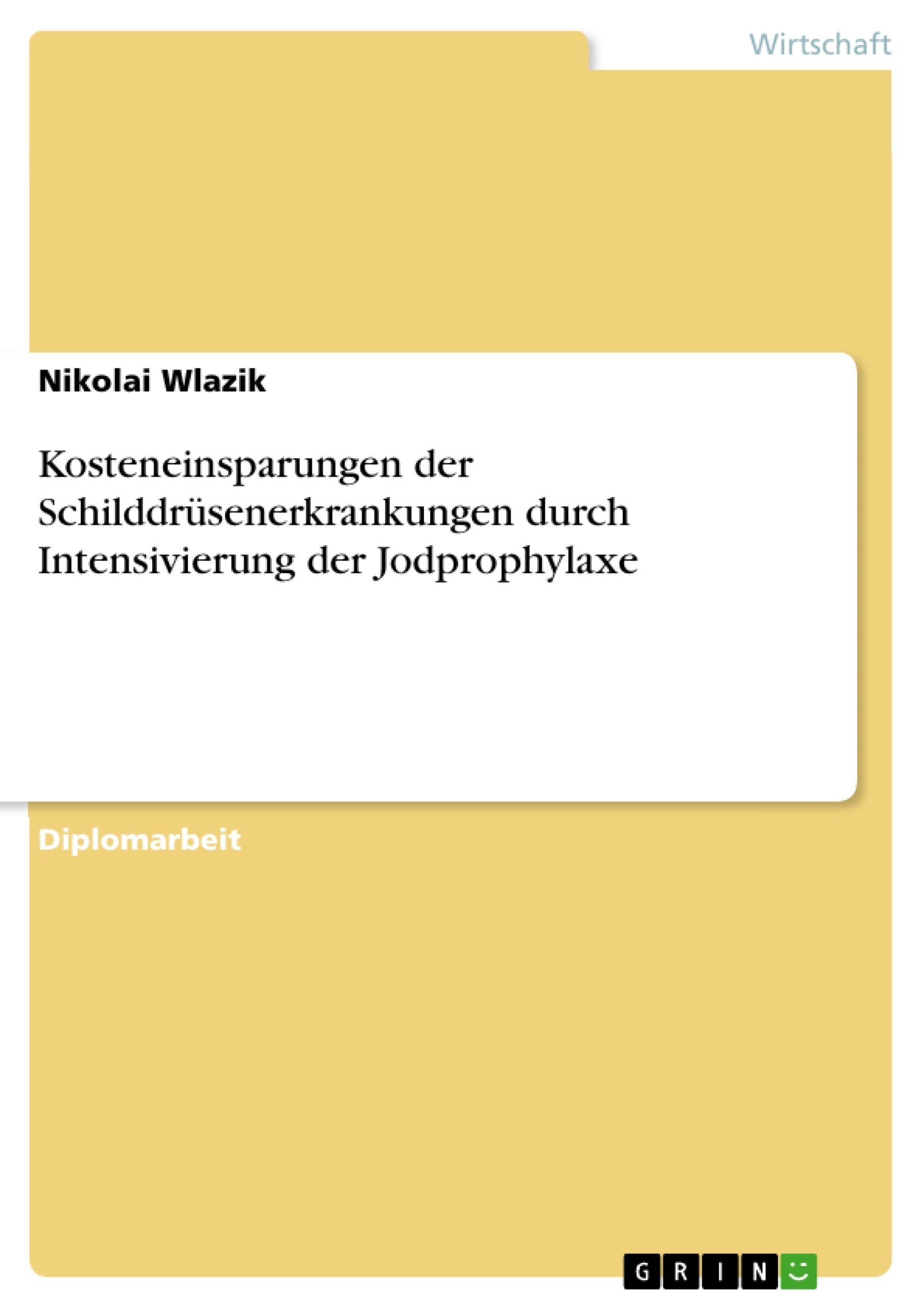1 Einleitung
Die angespannte Ausgabensituation im Gesundheitswesen der letzten Jahre nimmt
nicht ab. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes beliefen sich die Ausgaben für Gesundheit im Jahr 2006 auf 245 Milliarden Euro. Der größte Anteil in Höhe von fast 140 Milliarden Euro entfällt dabei auf die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung.1 Diese soll ihren Versicherten Leistungen zur Verfügung stellen, welche man grob in drei Kategorien einteilen kann. Die Verhütung von Krankheiten, die Früherkennung von Krankheiten sowie die Behandlung von Krankheiten. Geht man nach dem Gesetz, sind diese gleich gewichtet (§ 11 Abs. 1 SGB V). Bei näherer Betrachtung der Ausgaben wird jedoch deutlich, dass der Anteil der Prävention und Gesundheitsförderung dabei lediglich ca. 6 % ausmacht. Der Hauptanteil
liegt im kurativen Bereich. Dies ist mitunter auf die Historie der Krankenkassen zurückzuführen. Wie der Name bereits aussagt, lag die zentrale Aufgabe der Krankenkassen bei deren Einführung (1883) in der Bereitstellung von ärztlicher Hilfe für Kranke.2 Der kurative Bereich leistet jedoch nur maximal 30 % an unserer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung und unserem verbesserten Gesundheitszustand.3
Es stellt sich daher die Frage, warum nicht mehr Anstrengungen unternommen
werden, Krankheiten und damit einhergehende Kosten zu verhüten, anstatt bereits bestehende Erkrankungen zu heilen. Um hier Gegenmaßnahmen einleiten zu können, bedarf es der Klärung folgender Überlegung: „In welchem Verursachungsbereich, zwischen gefährdeter Gesundheit und schwerer Erkrankung, ist mit welcher Interventionsmaßnahme und möglichst geringen Kosten der epidemiologisch abschätzbar größte Gesundheitsgewinn zu erzielen?“4
1 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/05/PD0
8__172__23611,templateId=renderPrint.psml , Stand: 30.10.2008.
2 Hurrelmann / Klotz / Haisch ( 2007/, S. 15.
3 Walter / Drupp / Schwartz (2002), S. 42.
4 Rosenbrock / Gerlinger (2004), S. 23.
1.1 Problemstellung
„So überflüssig wie ein Kropf“ – Diese alte Redewendung wird immer noch oft verwendet, um etwas Überflüssiges, Unnötiges oder Sinnloses zu beschreiben.5 In Deutschland zählen Schilddrüsenerkrankungen zu den häufigsten Erkrankungen. Schätzungen zufolge sind weit mehr als ein drittel der deutschen Bevölkerung betroffen. Die Behandlung erfolgt je nach Stadium der Struma medikamentös, per Schilddrüsenoperation oder Radiojodbehandlung [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eingrenzung der Handlungsfelder
- Schilddrüsenerkrankungen aufgrund von Jodmangel
- Euthyreote Struma
- Struma diffusa
- Struma nodosa
- Hypothyreose
- Hyperthyreose
- Auftreten der Jodmangelerkrankungen
- Prävention
- Primärprävention
- Sekundärprävention
- Tertiärprävention
- Jodversorgung
- Jodaufnahme durch Lebensmittel
- Natürliche Jodvorkommen
- Verwendung von jodiertem Speisesalz in Privathaushalten
- Verwendung von jodiertem Speisesalz in der Industrie
- Jodierung von Futtermittel
- Möglichkeiten der Ausweitung der Jodprophylaxe
- Jodierung des Trinkwassers
- Aufklärungskampagne zum Thema „Jodmangel“
- Kosten der Handlungsfelder
- Kosten der jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen
- Direkte Kosten
- Ambulante Kosten
- Stationäre Kosten
- Indirekte Kosten
- Humankapitalansatz
- Friktionskostenansatz
- Intangible Kosten
- Kostenübersicht
- Kosten der Präventionsmaßnahme
- Bewertung der Ergebnisse
- Grundformen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Kosten-Effektivitäts-Analyse
- Kosten-Nutzwert-Analyse
- Anwendbarkeit der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Auswirkungen einer ausreichenden Jodversorgung
- Bestimmung des erzielbaren Nutzens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten von Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen durch eine Intensivierung der Jodprophylaxe zur Reduktion jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit präventiver Maßnahmen im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen zu analysieren.
- Kostenanalyse jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen
- Bewertung verschiedener Präventionsmaßnahmen
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Kosten-Nutzen, Kosten-Effektivität)
- Auswirkungen einer verbesserten Jodversorgung
- Potenzial zur Kostensenkung im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigenden Gesundheitskosten in Deutschland und den geringen Anteil der Prävention daran. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem optimalen Ansatz zur Vermeidung von Krankheiten und Kosten im Zusammenhang mit gefährdeter Gesundheit und schweren Erkrankungen, unter Berücksichtigung des Einsatzes von Interventionsmaßnahmen und der Minimierung von Kosten. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen und die Analyse ihrer Wirtschaftlichkeit.
Eingrenzung der Handlungsfelder: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankungen wie Euthyreote Struma (diffusa und nodosa), Hypothyreose und Hyperthyreose. Es erläutert das Auftreten dieser Erkrankungen und geht detailliert auf verschiedene Präventionsstrategien ein, darunter Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Ein Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Wegen der Jodversorgung, inklusive der Diskussion über die Jodierung von Lebensmitteln, Trinkwasser und die Durchführung von Aufklärungskampagnen. Der Abschnitt liefert somit die fachliche Grundlage für die spätere Kostenanalyse.
Kosten der Handlungsfelder: Dieser Abschnitt analysiert die Kosten, die durch jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankungen entstehen. Die Kosten werden in direkte (ambulante und stationäre Kosten), indirekte (Humankapitalansatz und Friktionskostenansatz) und intangible Kosten unterteilt. Es wird eine detaillierte Kostenübersicht erstellt, die als Basis für die spätere Wirtschaftlichkeitsbewertung dient. Weiterhin werden die Kosten der verschiedenen Präventionsmaßnahmen beleuchtet, um einen Vergleich zu ermöglichen.
Bewertung der Ergebnisse: Hier werden verschiedene Methoden der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie Kosten-Nutzen-Analyse, Kosten-Effektivitäts-Analyse und Kosten-Nutzwert-Analyse, vorgestellt. Es wird geprüft, inwieweit diese Methoden auf die Fragestellung anwendbar sind und wie der Nutzen einer ausreichenden Jodversorgung quantifiziert werden kann. Dieser Teil verbindet die zuvor ermittelten Kosten mit den potentiellen Vorteilen einer verbesserten Jodprophylaxe, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Jodmangel, Schilddrüsenerkrankungen, Prävention, Gesundheitskosten, Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen-Analyse, Kosten-Effektivitäts-Analyse, Jodprophylaxe, Gesundheitsförderung, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wirtschaftlichkeitsanalyse der Jodprophylaxe zur Reduktion jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Wirtschaftlichkeit präventiver Maßnahmen (Jodprophylaxe) im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen. Ziel ist es, Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen aufzuzeigen.
Welche jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt Euthyreote Struma (diffusa und nodosa), Hypothyreose und Hyperthyreose. Das Auftreten dieser Erkrankungen und verschiedene Präventionsstrategien werden detailliert beschrieben.
Welche Arten der Prävention werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Kontext der Jodprophylaxe.
Wie wird die Jodversorgung betrachtet?
Die verschiedenen Wege der Jodversorgung werden analysiert, darunter die Jodierung von Lebensmitteln (Speisesalz, Futtermittel), Trinkwasser und Aufklärungskampagnen.
Welche Kostenarten werden berücksichtigt?
Die Kostenanalyse umfasst direkte Kosten (ambulante und stationäre Kosten), indirekte Kosten (Humankapitalansatz und Friktionskostenansatz) und intangible Kosten im Zusammenhang mit jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen sowie die Kosten der Präventionsmaßnahmen.
Welche Methoden der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Kosten-Nutzen-Analyse, Kosten-Effektivitäts-Analyse und Kosten-Nutzwert-Analyse, um die Wirtschaftlichkeit der Jodprophylaxe zu beurteilen.
Wie wird der Nutzen einer ausreichenden Jodversorgung bestimmt?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen einer ausreichenden Jodversorgung und quantifiziert den erzielbaren Nutzen, um ihn mit den Kosten der Prävention und Behandlung zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Jodmangel, Schilddrüsenerkrankungen, Prävention, Gesundheitskosten, Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen-Analyse, Kosten-Effektivitäts-Analyse, Jodprophylaxe, Gesundheitsförderung, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Eingrenzung der Handlungsfelder (inkl. Beschreibung der Erkrankungen und Präventionsmaßnahmen), die Kostenanalyse der Handlungsfelder, die Bewertung der Ergebnisse mittels verschiedener Wirtschaftlichkeitsanalysen und ein Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kurzfassung)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse zusammen und bewertet die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Jodprophylaxe im Vergleich zu den Behandlungskosten jodmangelbedingter Schilddrüsenerkrankungen. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im bereitgestellten Text nicht explizit zusammengefasst).
- Quote paper
- Dipl. Kfm. (FH) Nikolai Wlazik (Author), 2008, Kosteneinsparungen der Schilddrüsenerkrankungen durch Intensivierung der Jodprophylaxe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131858