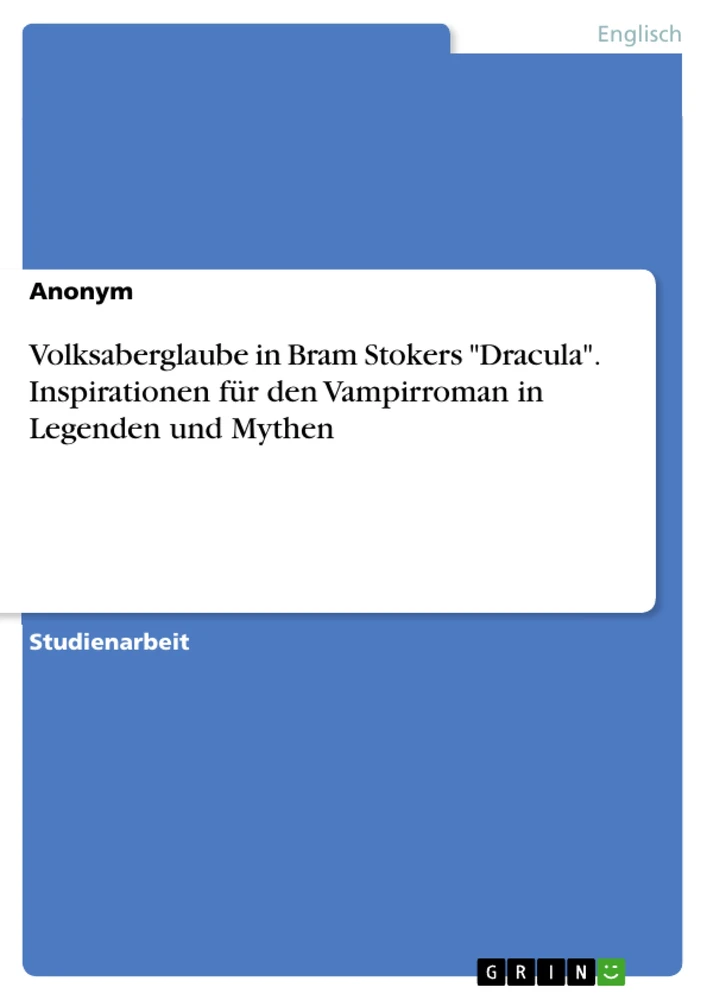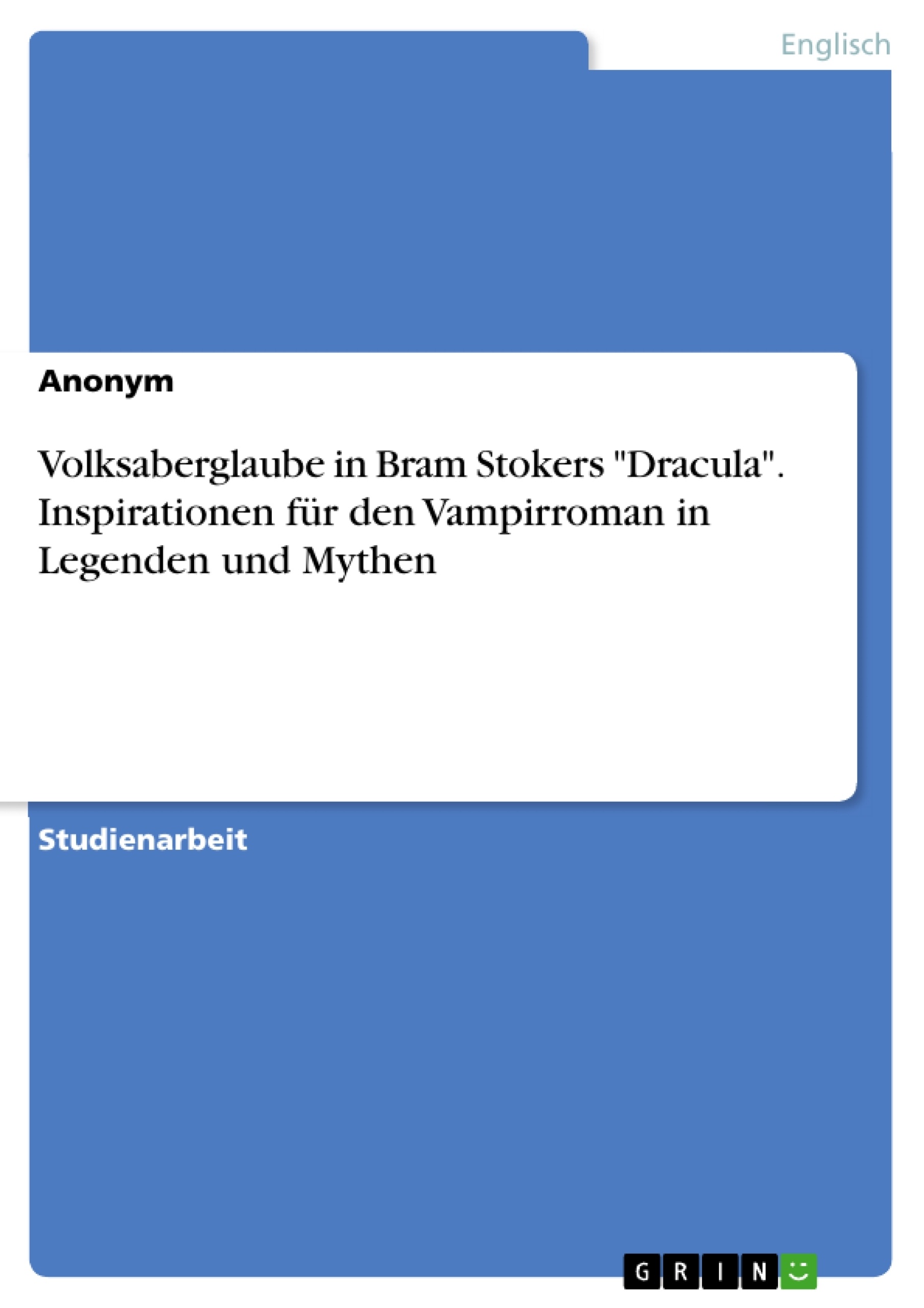Wo Bram Stoker traditionelle Überlieferungen aus Rumänien und Transsilvanien nutzt, wo weitere Legenden und Mythen aus der Welt zum Tragen kommen, welche anderen Quellen und Inspirationen sich für den Vampir finden und, was lediglich Stokers Imagination entspringt, ist Gegenstand dieser Arbeit. Dabei wird zunächst auf die Ursprünge des Vampiraberglaubens und Stokers Grundidee des Romans, einschließlich des Schauplatzes und der Inspiration für Graf Dracula, eingegangen. Im Anschluss findet eine genauere Betrachtung der Verwandlung des Menschen in einen Vampir und darauffolgend, des Vampirs selbst, mit seinem äußeren Erscheinungsbild, seinen Eigenschaften und Fähigkeiten statt. Zuletzt wird ein Blick auf die Maßnahmen gegen den Vampir, sowohl auf Abwehrmaßnahmen wie auch auf die Vernichtung des Vampirs, geworfen. Im Endeffekt soll gezeigt werden, dass Stokers Vampirfigur nicht lediglich auf seine eigene Vorstellungskraft zurückgeht, viel mehr werden verschiedene Mythen und Legenden aus dem Volksaberglauben verschiedener Kulturen miteinander verwoben und es finden sich auch eine Reihe weitere Inspirationen, wie Krankheiten und historische Überlieferungen für seine Vampirfigur.
Beinahe jede Kultur kennt sie, die blutdürstigen wiederauferstandenen Toten. Doch überall tragen sie verschiedene Namen, haben verschiedene Eigenschaften, Fähigkeiten und sind mit variierenden Traditionen verbunden. Als der Urvater der Vampire wird oft der Vampir nach Bram Stokers "Dracula", erschienen 1897, gesehen. Doch der Vampirismus und Aberglaube über den Vampirmythos geht viel weiter zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprünge des Vampiraberglaubens und Stokers Grundidee
- Der Mythos Vampir
- Die Bezeichnung Nosferatu
- Schauplatz des Romans
- Vlad Tepes und Dracula
- Verwandlung in einen Vampir
- Wie wird man zum Vampir
- Der Verwandlungsprozess und typische Krankheitsbilder
- Der Vampir selbst
- Äußerliche Merkmale
- Die Eigenschaften
- Die Fähigkeiten
- Maßnahmen gegen den Vampir
- Abwehr
- Vernichtung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursprünge des Vampirmythos in Bram Stokers Dracula und beleuchtet die verschiedenen Einflüsse, die in die Gestaltung der Vampirfigur eingeflossen sind. Ziel ist es aufzuzeigen, dass Stokers Vampir nicht allein seiner Fantasie entspringt, sondern auf vielfältigen Mythen, Legenden und historischen Überlieferungen basiert.
- Ursprünge des Vampiraberglaubens in verschiedenen Kulturen
- Stokers Inspirationen für seine Vampirfigur (inkl. Vlad Tepes)
- Der Wandel des Vampirmythos im Laufe der Zeit
- Die Darstellung des Vampirs in Dracula: Aussehen, Fähigkeiten und Eigenschaften
- Maßnahmen zur Abwehr und Vernichtung von Vampiren im Volksglauben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursprüngen des Vampirmythos in Bram Stokers Dracula. Sie beschreibt die globale Verbreitung von Vampirvorstellungen mit unterschiedlichen Namen und Eigenschaften und hebt die Bedeutung von Stokers Roman als prägenden Einfluss hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse der Ursprünge des Vampiraberglaubens, Stokers Inspirationen und die Darstellung des Vampirs im Roman an.
2. Ursprünge des Vampiraberglaubens und Stokers Grundidee: Dieses Kapitel untersucht die historischen und kulturellen Wurzeln des Vampirglaubens. Es beleuchtet den Mythos des Vampirs, die problematische Bezeichnung "Nosferatu", den Schauplatz des Romans und die historische Inspiration durch Vlad Tepes. Der Abschnitt zum Mythos Vampir analysiert die verschiedenen Faktoren, die zum Entstehen und zur Verbreitung des Aberglaubens beitrugen, einschließlich der Änderung der Bestattungsrituale, von Seuchen und der Vorstellung von Untoten als Personen und nicht als Gegenstände. Die verschiedenen Varianten des Vampirmythos in verschiedenen Kulturen werden diskutiert, einschließlich der Wiedergänger, des Draugr und des Nachzehrers, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden. Der Abschnitt über "Nosferatu" befasst sich mit der etymologischen Problematik dieser Bezeichnung und ihrer Herkunft aus einer Verwechslung rumänischer Begriffe. Die Ausführungen zum Schauplatz des Romans verdeutlichen die geographische Ungenauigkeit der Lokalisierung und die relative Seltenheit des Vampirglaubens in Transsilvanien im Gegensatz zu anderen Gebieten. Schliesslich werden die Verbindungen zu Vlad Tepes als historischer Inspiration für Graf Dracula untersucht.
Schlüsselwörter
Vampirmythos, Bram Stoker, Dracula, Volksglaube, Nosferatu, Vlad Tepes, Transsilvanien, Untote, Wiedergänger, Blutsauger, Abwehrmaßnahmen, Aberglaube, historische Inspirationen, Krankheiten.
Häufig gestellte Fragen zu "Dracula": Eine umfassende Inhaltsübersicht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ursprünge des Vampirmythos in Bram Stokers Roman "Dracula". Sie untersucht die historischen und kulturellen Einflüsse auf die Gestaltung der Vampirfigur und zeigt auf, dass Stokers Vampir nicht nur Produkt seiner Fantasie ist, sondern auf vielfältigen Mythen, Legenden und historischen Überlieferungen basiert. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Kapitelzusammenfassung, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Ursprünge des Vampirglaubens in verschiedenen Kulturen, Stokers Inspirationen für seine Vampirfigur (einschließlich Vlad Tepes), den Wandel des Vampirmythos im Laufe der Zeit, die Darstellung des Vampirs in "Dracula" (Aussehen, Fähigkeiten, Eigenschaften) und Maßnahmen zur Abwehr und Vernichtung von Vampiren im Volksglauben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Ursprünge des Vampiraberglaubens und Stokers Grundidee (inkl. Mythos Vampir, Nosferatu, Schauplatz des Romans und Vlad Tepes), Verwandlung in einen Vampir (inkl. Verwandlungsprozess und typische Krankheitsbilder), Der Vampir selbst (inkl. Äußerliche Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten), Maßnahmen gegen den Vampir (inkl. Abwehr und Vernichtung) und Fazit.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Einleitung?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursprüngen des Vampirmythos in "Dracula". Sie beschreibt die globale Verbreitung von Vampirvorstellungen und hebt die Bedeutung von Stokers Roman als prägenden Einfluss hervor. Sie kündigt die Analyse der Ursprünge des Vampiraberglaubens, Stokers Inspirationen und die Darstellung des Vampirs im Roman an.
Was wird im Kapitel "Ursprünge des Vampiraberglaubens und Stokers Grundidee" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die historischen und kulturellen Wurzeln des Vampirglaubens. Es analysiert den Mythos des Vampirs, die problematische Bezeichnung "Nosferatu", den Schauplatz des Romans und die historische Inspiration durch Vlad Tepes. Es werden verschiedene Varianten des Vampirmythos in verschiedenen Kulturen diskutiert und die Verbindungen zu Vlad Tepes als historischer Inspiration für Graf Dracula untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Vampirmythos, Bram Stoker, Dracula, Volksglaube, Nosferatu, Vlad Tepes, Transsilvanien, Untote, Wiedergänger, Blutsauger, Abwehrmaßnahmen, Aberglaube, historische Inspirationen und Krankheiten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will die Ursprünge des Vampirmythos in Bram Stokers "Dracula" untersuchen und aufzeigen, dass Stokers Vampir auf vielfältigen Mythen, Legenden und historischen Überlieferungen basiert und nicht allein seiner Fantasie entspringt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Volksaberglaube in Bram Stokers "Dracula". Inspirationen für den Vampirroman in Legenden und Mythen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1319213