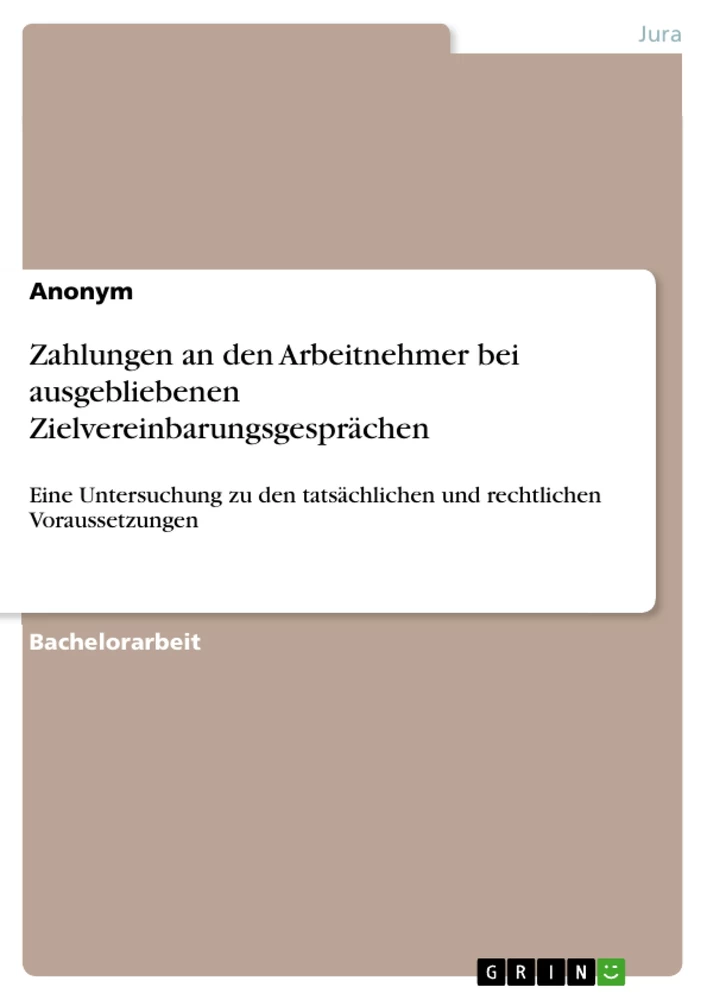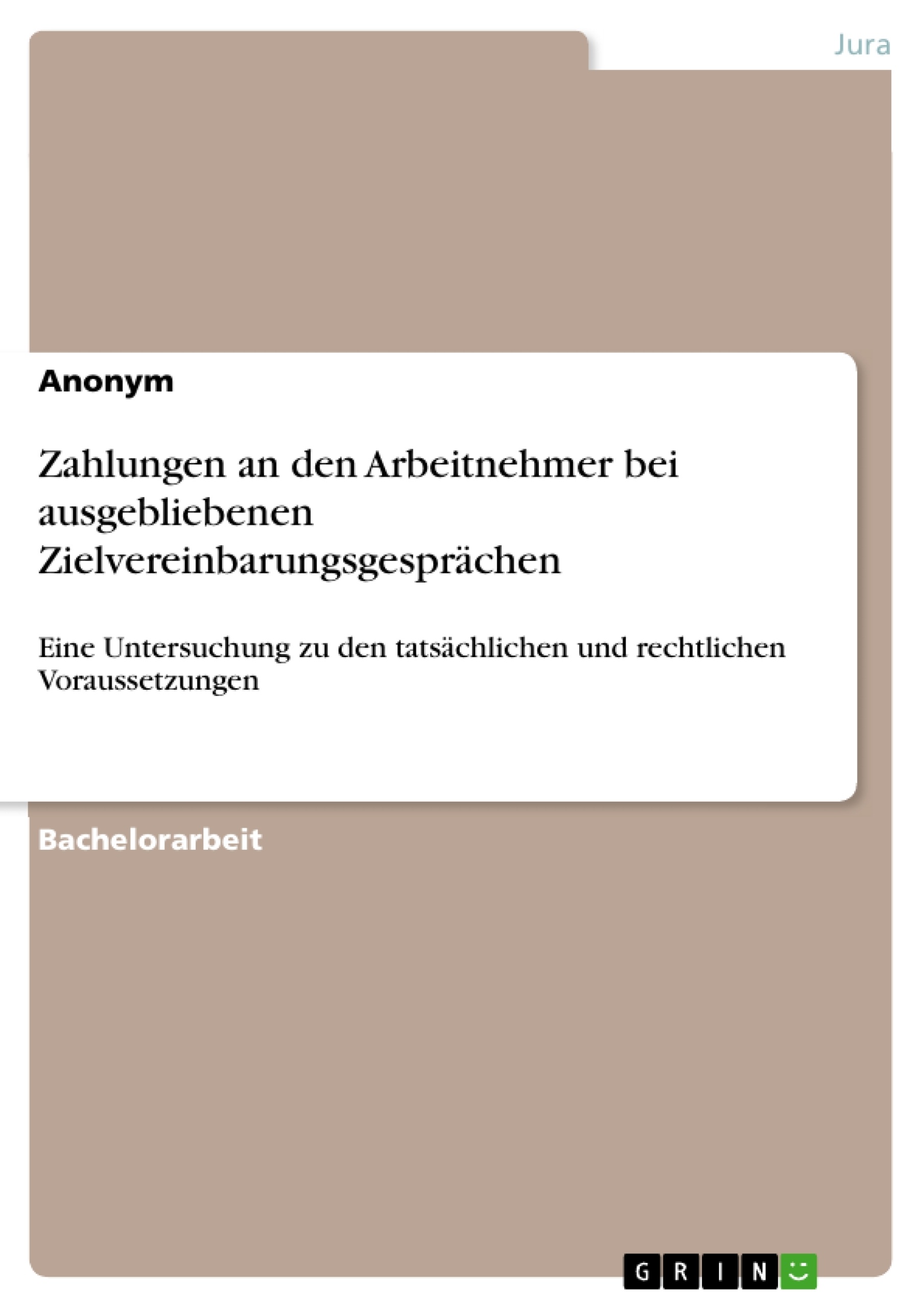In welcher Höhe der Arbeitgeber etwaige Zahlungen an den Arbeitnehmer, insbesondere bei unterlassenen Zielvereinbarungsgesprächen zu leisten hat, soll in der nachfolgenden Arbeit anhand der aktuellen Rechtsprechung näher untersucht und beleuchtet werden.
Auch die in Zusammenhang mit unterbliebenen Zielvereinbarungen verbundenen Risiken für den Arbeitgeber sowie den daraus resultierenden möglichen Ansprüchen des Arbeitnehmers soll im Folgenden näher analysiert werden.
Zielorientierte Vergütungssysteme sind heutzutage in der Praxis keine Seltenheit mehr. Da der Unternehmenserfolg maßgeblich an die Motivation und Leistungsbereitschaft der einzelnen Mitarbeiter gekoppelt ist, setzt sich das Arbeitsentgelt üblicherweise aus festen als auch aus variablen Bestandteilen zusammen. Das variable Arbeitsentgelt bemisst sich damit nach der individuellen Leistung des Arbeitnehmers und wird von der Erreichung festgelegter Ziele, die in einer Zielvereinbarung geregelt sind, abhängig gemacht. Auch der Gesamtunternehmenserfolg ist für dessen Höhe maßgeblich von Bedeutung.
Das diesem Vergütungssystem zugrunde liegende transaktionale Führungskonzept „Management by Objectives“ wurde erstmals im Jahre 1954 von Peter Ferdinand Drucker entwickelt. Dadurch sollen die Unternehmensziele gemeinsam mit den Mitarbeitern mit Hilfe von sog. Zielvereinbarungen erreicht und umgesetzt werden.
Die einzelnen Ziele werden hierbei zwischen den Mitarbeitern und dem Vorgesetzen kommuniziert und dann im gemeinsamen Zielvereinbarungsgespräch festgesetzt. Leistungssteigerungen durch erhöhte Motivation der Mitarbeiter, stärkere Unternehmensbindung, Entlastung von Führungskräften sowie eine Verbesserung der Kommunikation mit den Vorgesetzen sollen mit diesem Führungskonzept angestrebt und verwirklicht werden. Die einzelnen Mitarbeiter erhalten oftmals im Rahmen dieses Führungskonzeptes neben dem Festgehalt einen jährlichen Bonus, dessen Gewährung und Auszahlungshöhe von der Erreichung der festgelegten Ziele in der jeweiligen Zielperiode abhängig ist. Allerdings können sich hieraus in der Praxis zu beachtende Besonderheiten ergeben, da die Rechtsgrundlagen hierzu nicht eindeutig festgelegt sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Zielvereinbarung
- 2.1 Definition Zielvereinbarung
- 2.2 Unterschied zwischen Zielvorgabe und Zielvereinbarung
- 2.3 Arten von Zielen
- 2.4 Sinn und Zweck einer Zielvereinbarung
- 2.5 Rechte und Pflichten der Zielvereinbarungsparteien
- 3. Ausgestaltung von Zielvereinbarungen
- 3.1 Rahmenvereinbarung
- 3.2 Inhaltskontrolle von Zielvereinbarungen (AGB-Kontrolle)
- 3.3 Flexibilisierung der Vergütung durch Zielvereinbarungen
- 3.3.1 Einführung einer variablen zielorientierten Vergütung
- 3.3.2 Freiwilligkeitsvorbehalte
- 3.3.3 Widerrufsvorbehalte
- 3.3.4 Befristung
- 3.4 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
- 4. Nichtzustandekommen von Zielvereinbarungen
- 4.1 Ausgebliebene Zielvereinbarungsgespräche
- 4.1.1 Einführung der Problematik anhand eines Urteils des BAG vom 12.12.2007
- 4.1.2 Festlegung der Ziele durch Urteil nach § 315 Abs. 3 S. 2 BGB
- 4.1.3 Möglichkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung
- 4.1.4 Rückgriff auf den Rechtsgedanken des § 162 Abs. 1 BGB
- 4.2 Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers
- 4.2.1 Verteilung der Initiativpflichten
- 4.2.2 Bemessung der Schadenshöhe
- 4.2.3 Bewertung eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers
- 4.3 Fehlende Einigung im Zielvereinbarungsgespräch
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Thesis befasst sich mit der rechtlichen Problematik von Zahlungen an Arbeitnehmer bei ausgebliebenen Zielvereinbarungsgesprächen. Sie untersucht die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für solche Zahlungen und analysiert die relevanten Rechtsnormen und -prechung.
- Definition und Bedeutung der Zielvereinbarung
- Ausgestaltung und Flexibilisierung von Zielvereinbarungen
- Rechtliche Folgen ausgebliebener Zielvereinbarungsgespräche
- Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Dieses Kapitel führt in das Thema der Zielvereinbarung im Arbeitsrecht ein und erläutert die Relevanz der Thematik.
- Kapitel 2: Die Zielvereinbarung - Dieses Kapitel beleuchtet die Definition, Arten, Sinn und Zweck sowie die Rechte und Pflichten im Kontext von Zielvereinbarungen.
- Kapitel 3: Ausgestaltung von Zielvereinbarungen - Dieses Kapitel behandelt die Rahmenvereinbarung, die Inhaltskontrolle von Zielvereinbarungen und die Flexibilisierung der Vergütung durch Zielvereinbarungen, einschließlich der Einführung einer variablen zielorientierten Vergütung, Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalten sowie der Befristung. Außerdem werden die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates in Bezug auf Zielvereinbarungen erörtert.
- Kapitel 4: Nichtzustandekommen von Zielvereinbarungen - Dieses Kapitel analysiert die Folgen ausgebliebener Zielvereinbarungsgespräche, einschließlich der Festlegung von Zielen durch Urteil, der Möglichkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung und des Rückgriffs auf den Rechtsgedanken des § 162 Abs. 1 BGB. Des Weiteren befasst sich das Kapitel mit Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers, der Verteilung der Initiativpflichten, der Bemessung der Schadenshöhe und der Bewertung eines Mitverschuldens des Arbeitnehmers.
Schlüsselwörter
Zielvereinbarung, Arbeitsrecht, Vergütung, Flexibilisierung, Ausgestaltung, Nichtzustandekommen, Schadensersatz, Mitbestimmungsrecht, Betriebsrat, Rechtsprechung, BGB.
Häufig gestellte Fragen
Was passiert, wenn der Arbeitgeber kein Zielvereinbarungsgespräch führt?
Unterlässt der Arbeitgeber schuldhaft die Festsetzung von Zielen, kann der Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche geltend machen, da ihm die Möglichkeit auf eine variable Vergütung entgangen ist.
Was ist der Unterschied zwischen Zielvorgabe und Zielvereinbarung?
Eine Zielvorgabe wird einseitig vom Arbeitgeber festgelegt, während eine Zielvereinbarung im gemeinsamen Dialog zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter ausgehandelt wird.
Was besagt das Konzept „Management by Objectives“?
Dieses 1954 von Peter Drucker entwickelte Konzept sieht vor, dass Unternehmensziele gemeinsam mit den Mitarbeitern umgesetzt werden, um Motivation und Bindung zu steigern.
Wie wird die Höhe des Schadensersatzes bei fehlenden Zielen bemessen?
Die Bemessung orientiert sich oft an der Erreichung der Ziele in der Vergangenheit oder an einem Urteil nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei Zielvereinbarungen?
Der Betriebsrat hat Mitbestimmungsrechte bei der Ausgestaltung der Entlohnungsgrundsätze und der Einführung variabler Vergütungssysteme.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Zahlungen an den Arbeitnehmer bei ausgebliebenen Zielvereinbarungsgesprächen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1319585