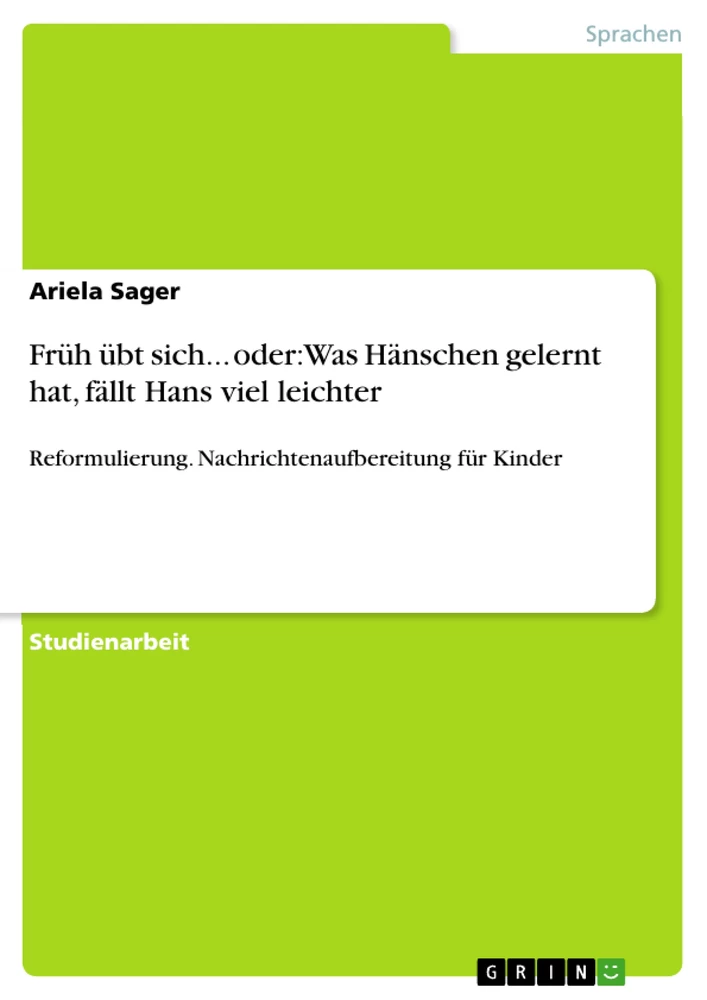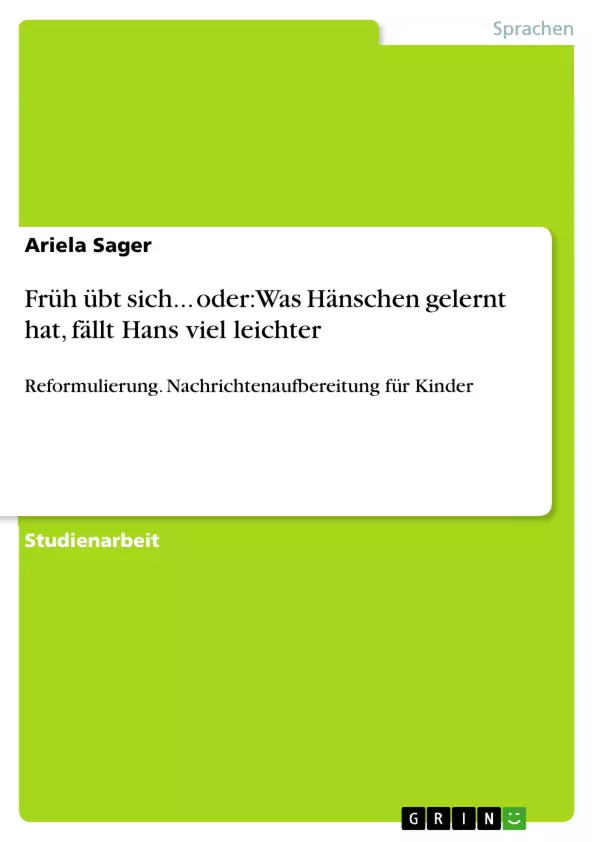Die Vereinten Nationen garantieren in ihrem „Übereinkommen der Rechte des Kindes“ in Artikel 171 auch Kindern ein Recht auf Information. In der Umsetzung dieser Forderung scheint Frankreich einen Schritt weiter zu sein als Deutschland. Die Suchmaschine Blinde Kuh (www.blindekuh.de), die das Onlineangebot für Kinder auswertet, nennt vor allem fünf (Online-)Formate, die die Redakteure der Suchmaschine im Hinblick auf die Information von Kindern für relevant halten. Die Suchmaschine open directory (www.dmoz.org) zeigt dagegen auf deutscher Seite nur drei explizite Nachrichtenmagazine mit der Zielgruppe Kinder auf, auf französischer Seite immerhin sieben. Und die Redaktion der Blinde Kuh stellt fest: „In Deutschland gibt es zwar viele Kinderportale mit Werbung und Zugang zu Spiel und Spaß für Kinder aber kaum Zugang zu Nachrichten.“2
Auch wenn Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen dem Kind „das Recht auf freie Meinungsbildung“3 zugesteht, was eine gute Informationsbasis voraussetzt, könnte sich die Frage stellen, ob es tatsächlich erstrebenswert ist, Kinder bereits so früh an das Weltgeschehen heranzuführen. Sollten Kinder nicht viel mehr unbehelligt leben, von den Ereignissen außerhalb ihrer unmittelbaren Lebenswelt abgeschirmt, vor grausam anmutenden Informationen, vor allem deren begleitenden Bildern geschützt werden? Würden die Informationen über Krieg und Katastrophen die Kinder nicht vielmehr emotional und intellektuell überfordern?
Beim Stichwort Überforderung steht man sich allerdings eher auf der Seite der Erwachsenen, die sich mit den Fragen der Kinder konfrontiert sehen. Kinder nehmen Informationen zwangsläufig aus den sie umgebenden Medien auf und fühlen sich solange von den Informationen verunsichert, wie sie nicht in der Lage sind, sie in ihren Erfahrungshorizont einzuordnen. Erwachsenen fällt es dabei schwer, den Kindern die Ereignisse angemessen, kindgerecht darzulegen, um ihnen die Verunsicherung zu nehmen.
Das Ziel der Nachrichtenaufbereitung für Kinder liegt aber nicht nur darin, den Kindern die Verunsicherung zu nehmen, sondern Kinder sollen – in Analogie zu den Vulgarisierungsbemühungen in der Fachsprachenaufbereitung – in die Lage versetzt werden, „an demokratischen Meinungs-, Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen“4 aktiv oder passiv teilzunehmen. Kindernachrichten fallen also unter die Zielsetzung der Sozialisation von Kindern...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindernachrichten: Wozu die Mühe?
- Kindgerecht: Was heißt das?
- Textanalyse
- Sprachstil
- Satzkomplexität
- Wortverständnis
- Anschaulichkeit
- Gefahren
- Fazit und Ausblick
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die sprachlichen Besonderheiten von Kindernachrichten und untersucht, mit welchen Mitteln Redakteure Kinder zum Nachrichtenkonsum motivieren. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie Kindernachrichten kindgerecht gestaltet werden und welche sprachlichen Mittel zur Verständlichkeit beitragen.
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten von Kindernachrichten
- Untersuchung der Mittel zur Motivation von Kindern zum Nachrichtenkonsum
- Bewertung der Gestaltung von Kindernachrichten im Hinblick auf Kindgerechtigkeit
- Analyse der sprachlichen Mittel zur Verständlichkeit von Kindernachrichten
- Vergleich der sprachlichen Gestaltung von Kindernachrichten mit der von Erwachsenenformaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Kindernachrichten im Kontext des Rechts auf Information und der Sozialisation von Kindern dar. Sie beleuchtet die Frage, ob Kinder frühzeitig an das Weltgeschehen herangeführt werden sollten und welche Herausforderungen sich dabei stellen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, mit welchen Mitteln Redakteure von Kindernachrichten Kinder zum Nachrichtenkonsum motivieren und welche sprachlichen Besonderheiten die Artikel als kindgerecht auszeichnen.
Das Kapitel „Kindernachrichten: Wozu die Mühe?" beleuchtet die Bedeutung von Kindernachrichten für die Bildung und Sozialisation von Kindern. Es wird argumentiert, dass Kinder durch den Konsum von Kindernachrichten an das Medienvokabular herangeführt werden und ihren Wortschatz erweitern. Die Arbeit stellt die Herausforderungen dar, die sich für junge Erwachsene ergeben, wenn sie ohne schrittweise Heranführung an die Tagespresse plötzlich mit komplexen Nachrichten konfrontiert werden.
Das Kapitel „Kindgerecht: Was heißt das?" definiert den Begriff „Kindgerechtigkeit" im Kontext von Kindernachrichten. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die bei der Gestaltung von Kindernachrichten berücksichtigt werden müssen, um sie für Kinder verständlich und interessant zu gestalten. Die Arbeit stellt die Bedeutung von Anschaulichkeit, Einfachheit und Bezug zur Lebenswelt von Kindern heraus.
Das Kapitel „Textanalyse" untersucht die sprachlichen Besonderheiten von Kindernachrichten anhand der Zeitschrift „Les Clés de l'Actualité Junior". Die Analyse fokussiert auf die Aspekte Sprachstil, Satzkomplexität, Wortverständnis und Anschaulichkeit. Die Arbeit vergleicht die sprachliche Gestaltung von Kindernachrichten mit der von Erwachsenenformaten und zeigt die Unterschiede im Sprachgebrauch auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kindernachrichten, Kindgerechtigkeit, Sprachstil, Satzkomplexität, Wortverständnis, Anschaulichkeit, Sozialisation, Medienvokabular, Bildung, Informationsvermittlung, Lesekompetenz, Medienkompetenz, Textanalyse, Vergleichende Analyse, Les Clés de l'Actualité Junior.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Nachrichten für Kinder wichtig?
Sie fördern die Sozialisation, erweitern den Wortschatz und ermöglichen Kindern die Teilhabe an demokratischen Meinungsbildungsprozessen.
Was bedeutet "kindgerecht" bei Nachrichten?
Kindgerecht bedeutet eine geringere Satzkomplexität, einfache Wortwahl, hohe Anschaulichkeit und einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Kinder.
Sollte man Kinder vor grausamen Nachrichten schützen?
Die Arbeit argumentiert, dass Kinder Informationen ohnehin aufnehmen; professionelle Kindernachrichten helfen ihnen, diese ohne Verunsicherung einzuordnen.
Was ist die "Blinde Kuh"?
Eine bekannte deutschsprachige Suchmaschine für Kinder, die Online-Angebote und Nachrichtenformate für die Zielgruppe auswertet.
Wie unterscheiden sich deutsche und französische Kindernachrichten?
Die Untersuchung zeigt, dass Frankreich ein breiteres Angebot an expliziten Nachrichtenmagazinen für Kinder hat als Deutschland.
- Citar trabajo
- Ariela Sager (Autor), 2006, Früh übt sich... oder: Was Hänschen gelernt hat, fällt Hans viel leichter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132135