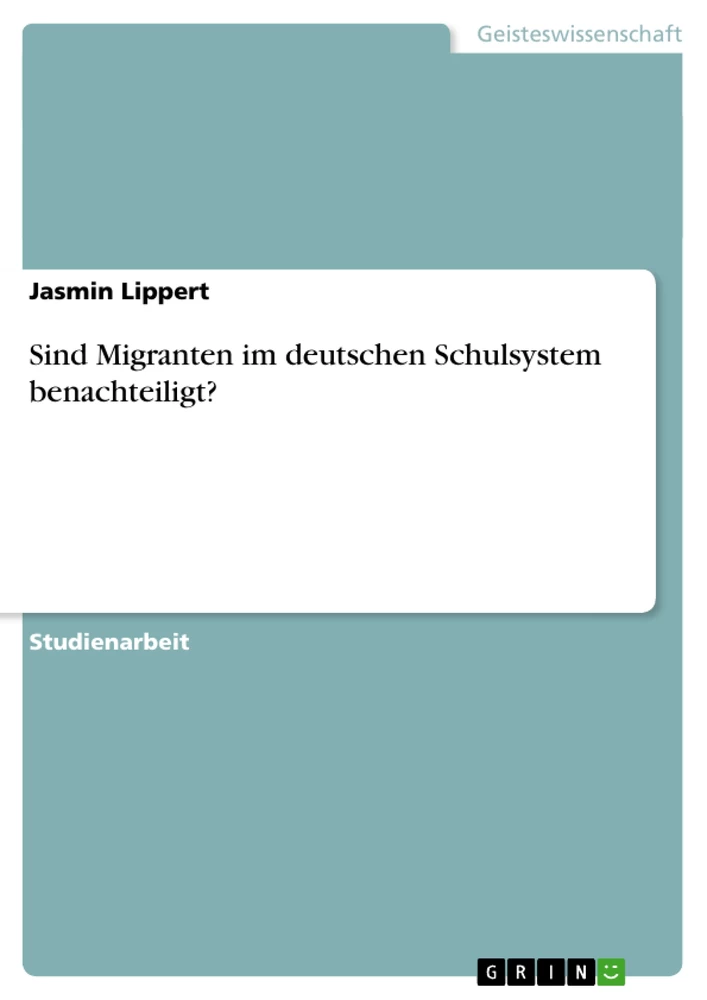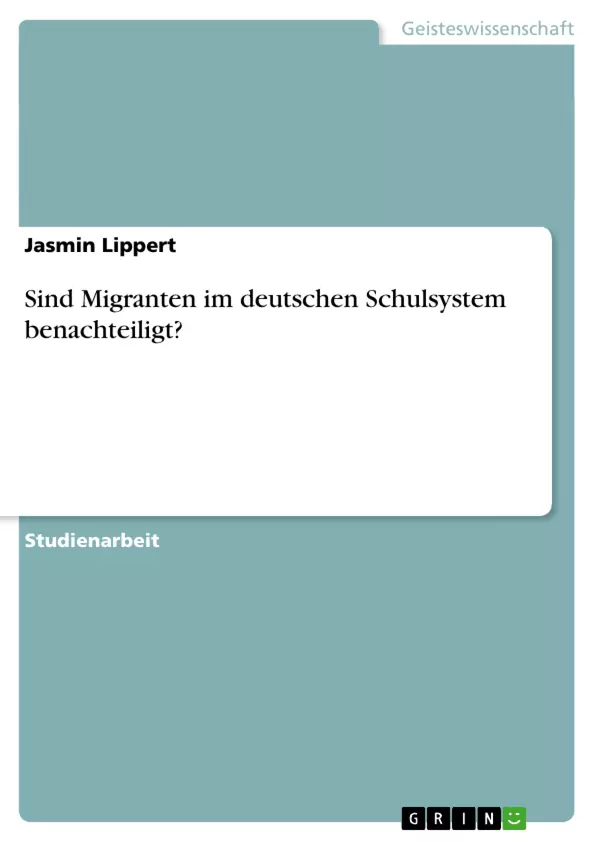Eine Darstellung der Menschheitsgeschichte kann als Abhandlung über Völkerwanderungen geschildert werden. Schon vor mehr als einigen Jahrtausenden waren Menschen bereit, ihr Heimatland aufzugeben und sich an anderen Orten anzusiedeln. Die Gründe dafür konnten sehr vielfältig und unterschiedlich sein. Im Vordergrund solcher Wanderungen stand jedoch häufig die Intention auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Immigrationsland. Auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt verlassen viele Menschen ihre Heimat, um in einem anderen Land bessere Entwicklungsvoraussetzungen zu erfahren als in ihrem eigenen. Die Migrationsbewegungen der Menschen werden durch bestimmte religiöse, politische, kulturelle und wirtschaftliche Umstände ausgelöst. Mit diesen gewichtigen Umständen aus der Soziologie setzt sich die Migrationssoziologie auseinander. In den meisten Fällen ist es so, dass sich nicht nur einzelne Menschen in einem anderen Land ansiedeln, sondern dass diese Menschen mit ihrer ganzen Familie in ein anderes Land gehen. Das bringt unterschiedliche Schwierigkeiten, wie sprachliche Barrieren, demografische Unterschiede sowie Anpassungsschwierigkeiten in Sitten und Gebräuchen mit sich. Besonders die Kinder der Einwandererfamilien werden aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld herausgerissen und sind im neuen Land mit diversen Problemen konfrontiert. Sie müssen eine andere Sprache erlernen, neue Freundschaften schließen und sich in ein ungewohntes schulisches Umfeld integrieren. Dies verläuft oftmals nicht ohne Probleme und in vielen Fällen drohen die Kinder der Einwandererfamilien in einen Randgruppenstatus des Bildungssystems abzurutschen. Es besteht die Gefahr der Diskriminierung durch Mitschüler und Lehrer und die Entstehung fachlicher Defizite. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Migrantenkinder aufgrund der genannten Umstände eine Bildungsbenachteiligung im deutschen Schulsystem erfahren und welche Ursachen dafür zu benennen sind. Ziel dieser Arbeit ist es, unterschiedliche theoretische Ansätze der gegenwärtigen Forschung zu beleuchten und zu hinterfragen. Obwohl zu diesem Themenschwerpunkt eine hohe Anzahl literarischer Darstellungen verfügbar sind, werde ich mich in erster Linie auf die theoretischen Ansätze von Cornelia Kristen, Janet Schofield und Mechthild Gomolla beziehen, da sie herausragende Arbeiten zur Bildungsbenachteiligung im deutschen Schulsystem verfasst haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergleich unterschiedlicher theoretischer Ansätze zur Bildungsbenachteiligung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob Migrantenkinder im deutschen Schulsystem benachteiligt sind und welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze der aktuellen Forschung zu beleuchten und zu hinterfragen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ansätze von Cornelia Kristen, Janet Schofield und Mechthild Gomolla, die sich intensiv mit Bildungsbenachteiligung im deutschen Schulsystem auseinandergesetzt haben.
- Ethnische Diskriminierung im deutschen Schulsystem
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsbenachteiligung
- Einfluss von sozialer Herkunft auf Bildungserfolg
- Institutionelle Diskriminierung und ihre Auswirkungen
- Empirische Forschungsergebnisse zur Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Migrationssoziologie dar und grenzt die Fragestellung ab. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Ansätze von Cornelia Kristen, Janet Schofield und Mechthild Gomolla vorgestellt und miteinander verglichen. Cornelia Kristen untersucht die Rolle ethnischer Diskriminierung im deutschen Schulsystem und unterscheidet zwischen ökonomischer und institutioneller Diskriminierung. Sie analysiert quantitative Studien, um das Ausmaß ethnischer Diskriminierung zu erforschen und ihre Bedeutung im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren zu bewerten. Janet Schofield konzentriert sich auf die Bedeutung von kulturellen Unterschieden und deren Einfluss auf die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern aus unterschiedlichen Kulturen. Sie untersucht die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in der schulischen Praxis und analysiert die Auswirkungen auf die Lernmotivation und den Bildungserfolg von Migrantenkindern. Mechthild Gomolla untersucht die Rolle von institutionellen Strukturen und deren Einfluss auf die Entstehung von Bildungsungleichheiten. Sie analysiert die Auswirkungen von Schulorganisation, Lehrplänen und pädagogischen Praktiken auf die Bildungschancen von Migrantenkindern. Das dritte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse der verschiedenen theoretischen Ansätze zusammen und diskutiert die Implikationen für die Bildungspolitik und die schulische Praxis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bildungsbenachteiligung, Migrantenkinder, ethnische Diskriminierung, institutionelle Diskriminierung, kulturelle Unterschiede, soziale Herkunft, Bildungserfolg, Schulsystem, Migrationssoziologie, empirische Forschung, theoretische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Sind Migrantenkinder im deutschen Schulsystem benachteiligt?
Die Arbeit untersucht diese Frage und zeigt auf, dass Migrantenkinder oft aufgrund sprachlicher Barrieren und institutioneller Strukturen geringere Bildungschancen haben.
Was ist "institutionelle Diskriminierung"?
Es beschreibt Benachteiligungen, die durch die Regeln, Praktiken und Strukturen des Bildungssystems selbst entstehen, unabhängig von individuellen Vorurteilen.
Welche Rolle spielt die soziale Herkunft für den Schulerfolg?
Die soziale Herkunft ist oft ein entscheidender Faktor; Migrantenkinder aus bildungsfernen Schichten sind doppelt belastet.
Wie wirken sich kulturelle Unterschiede auf die Lehrer-Schüler-Interaktion aus?
Stereotype und Vorurteile können die Erwartungshaltung der Lehrer beeinflussen, was sich negativ auf die Lernmotivation der Kinder auswirkt.
Welche Herausforderungen haben Einwandererfamilien im Bildungssystem?
Neben der Sprachbarriere sind es oft Anpassungsschwierigkeiten an Sitten und Gebräuche sowie fehlende Netzwerke im neuen Land.
Welche Theoretikerinnen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die Ansätze von Cornelia Kristen, Janet Schofield und Mechthild Gomolla.
- Arbeit zitieren
- Jasmin Lippert (Autor:in), 2007, Sind Migranten im deutschen Schulsystem benachteiligt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132147