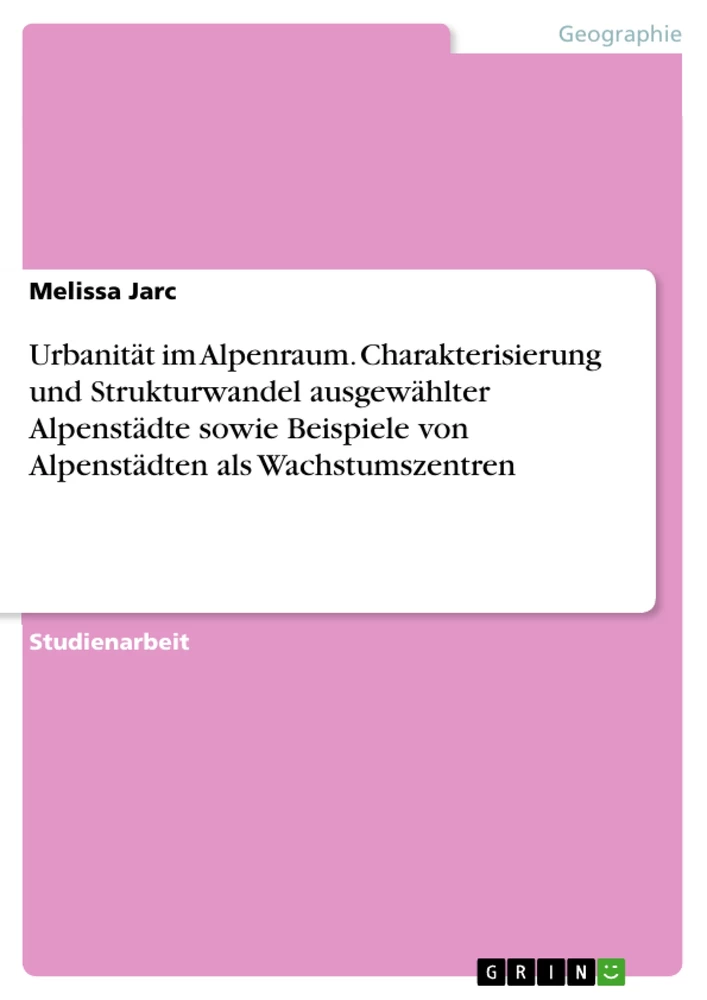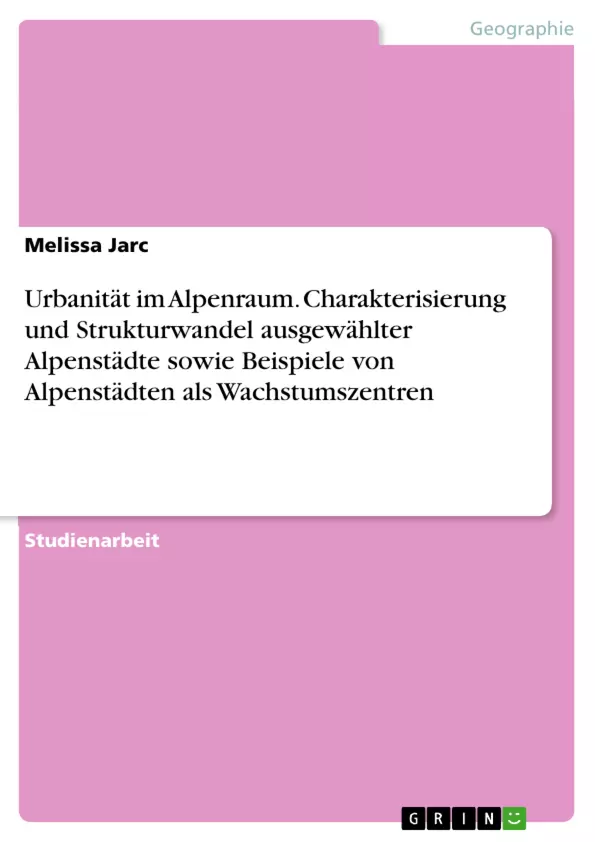Welche Kriterien lassen sich für die Charakterisierung von Stadt oder Urbanität im Alpenraum ansetzen? Ab wann kann man historisch betrachtet von einem wirklichen Städtewachstum sprechen? Wo liegen die Wachstums- und Schrumpfungszentren im Alpenraum und durch welche entscheidenden einflussnehmenden Faktoren sind diese determiniert? Welche Risiken oder auch welche Chancen birgt der sogenannte Strukturwandel für die Zukunft der Alpen? Diese zentralen Fragestellungen liegen der Struktur dieser Arbeit zu Grunde.
Zunächst wird Kapitel II sich kurz dem definitorischen Bereich von Urbanität, Stadt und dem Alpenraum beschäftigen. Kapitel III "Der Strukturwandel und die Formen der Verstädterung in den Alpen: Historischer Rückblick ab dem 19. Jahrhundert bis heute" beleuchtet dann die Entwicklung der Siedlungsgebiete in den Alpen näher und nimmt eine parallele Charakterisierung der unterschiedlichen Alpenstädte nach dem Konzept der „Fünf Formen der Verstädterung“ nach BÄTZING vor. Im Anschluss erweitert der Erklärungsansatz für Siedlungsentwicklung, die endogenen und exogenen Steuerungsfaktoren nach BORSDORF, die theoretische Basis für die darauffolgenden Fallbeispiele.
Kapitel III widmet sich dann den Fallbeispielen der Gemeinden Visp und Kötschach-Mauthen im Gailtal, welche hierbei in Ansätzen auf die zuvor dargelegten theoretischen Merkmale von Urbanität, Verstädterungsformen und Steuerungsfaktoren geprüft werden. Kapitel IV wird sich abschließend mit einer Bewertung der Urbanität und des Charakters alpiner Städte befassen und um ein eigenes abschließendes Werturteil ergänzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Definitorische Grundlage der Begriffe „Urbanität, Stadt und Alpenraum“
- III. Der Strukturwandel und die Formen der Verstädterung in den Alpen
- III.1 Historischer Rückblick ab dem 19. Jahrhundert bis heute
- III.2 Die dem Strukturwandel zu Grunde liegenden Steuerungsfaktoren nach Borsdorf
- III.2.A Endogene Faktoren
- III.2.B Exogene Faktoren
- IV. Fallbeispiele: Visp und Kötschach-Mauthen
- IV.1 Visp - „Einst Marktflecken, heute Oberwalliser Industrie- und bald Verkehrszenrum“
- IV.2 Kötschach-Mauthen im Gailtal
- V. Resümee zur Urbanität und dem Charakter von Alpenstädten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Urbanität im Alpenraum, charakterisiert ausgewählte Alpenstädte und beleuchtet deren Strukturwandel. Sie analysiert die Entwicklung von Städten in den Alpen seit der Industrialisierung und untersucht Wachstums- und Schrumpfungszentren. Die Arbeit befasst sich mit den Faktoren, die diesen Wandel beeinflussen, und bewertet die Chancen und Risiken des Strukturwandels für die Zukunft der Alpenregion.
- Definition von Urbanität, Stadt und Alpenraum
- Strukturwandel und Verstädterung in den Alpen
- Analyse endogener und exogener Steuerungsfaktoren
- Fallstudien ausgewählter Alpenstädte
- Bewertung der Urbanität und des Charakters alpiner Städte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Urbanität im Alpenraum ein und benennt zentrale Forschungsfragen. Sie beleuchtet die begriffliche Vielfalt im Diskurs um die Entwicklung der Urbanität in den Alpen und zeigt die Herausforderungen einer einfachen Stadt-Land-Dichotomie auf, die durch die zunehmende Mobilität und Globalisierung überholt ist. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodischen Vorgehensweisen.
II. Definitorische Grundlage der Begriffe „Urbanität, Stadt und Alpenraum“: Dieses Kapitel widmet sich der Klärung der zentralen Begriffe. Aufgrund der unterschiedlichen Abgrenzungen des Alpenraums wird eine mittlere Abgrenzung favorisiert, um sowohl die Beziehungen zwischen Berg- und Tallagen als auch die zu alpennahen Metropolen zu berücksichtigen. Die Schwierigkeit einer einheitlichen Definition von „Stadt“ wird hervorgehoben und ein soziologischer Ansatz der „Urbanität“ nach Radtke (2013) eingeführt, der neben Bevölkerungsdichte und -heterogenität, auch baulich-physische und objektbezogene Aspekte umfasst. Personenbezogene Aspekte werden aus Gründen des Umfangs der Arbeit ausgeschlossen.
III. Der Strukturwandel und die Formen der Verstädterung in den Alpen: Kapitel III beleuchtet den historischen Wandel der Siedlungsgebiete in den Alpen seit dem 19. Jahrhundert und charakterisiert verschiedene Alpenstädte anhand des Konzepts der „Fünf Formen der Verstädterung“ nach Bätzing (2015). Der Erklärungsansatz von Borsdorf (2006) mit seinen endogenen und exogenen Steuerungsfaktoren bildet die theoretische Grundlage für die folgenden Fallstudien. Der Abschnitt analysiert die komplexen Prozesse der Verstädterung im Alpenraum und deren Einflussfaktoren.
Schlüsselwörter
Urbanität, Alpenraum, Strukturwandel, Verstädterung, Alpenstädte, Wachstumszentren, Schrumpfungsgebiete, endogene Faktoren, exogene Faktoren, Fallbeispiele, Visp, Kötschach-Mauthen, Raumordnung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Urbanität im Alpenraum
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Urbanität im Alpenraum, charakterisiert ausgewählte Alpenstädte und beleuchtet deren Strukturwandel seit der Industrialisierung. Sie analysiert Wachstums- und Schrumpfungszentren und die Einflussfaktoren dieses Wandels, bewertet die Chancen und Risiken für die Zukunft der Alpenregion und verwendet dabei einen soziologischen Ansatz der „Urbanität“ nach Radtke (2013).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, definitorische Grundlagen der Begriffe „Urbanität, Stadt und Alpenraum“, Strukturwandel und Formen der Verstädterung in den Alpen (mit historischem Rückblick und Analyse endogener und exogener Faktoren nach Borsdorf), Fallbeispiele (Visp und Kötschach-Mauthen) und ein Resümee zur Urbanität und dem Charakter von Alpenstädten.
Welche Städte werden als Fallbeispiele untersucht?
Die Arbeit analysiert die Städte Visp und Kötschach-Mauthen als Fallbeispiele, um den Strukturwandel und die Urbanität in unterschiedlichen alpinen Kontexten zu veranschaulichen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Konzept der „Fünf Formen der Verstädterung“ nach Bätzing (2015) und den Erklärungsansatz von Borsdorf (2006) mit seinen endogenen und exogenen Steuerungsfaktoren, um den Strukturwandel in den Alpen zu analysieren. Für die Definition von Urbanität wird ein soziologischer Ansatz nach Radtke (2013) verwendet.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Urbanität in den Alpen seit der Industrialisierung, analysiert die Faktoren, die diesen Wandel beeinflussen, und bewertet die Chancen und Risiken des Strukturwandels für die Zukunft der Alpenregion. Sie beleuchtet auch die begriffliche Vielfalt im Diskurs um die Entwicklung der Urbanität in den Alpen und die Herausforderungen einer einfachen Stadt-Land-Dichotomie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Urbanität, Alpenraum, Strukturwandel, Verstädterung, Alpenstädte, Wachstumszentren, Schrumpfungsgebiete, endogene Faktoren, exogene Faktoren, Fallbeispiele, Visp, Kötschach-Mauthen, Raumordnung.
Wie wird der Alpenraum in der Arbeit abgegrenzt?
Aufgrund der unterschiedlichen Abgrenzungen des Alpenraums wird in der Arbeit eine mittlere Abgrenzung favorisiert, um sowohl die Beziehungen zwischen Berg- und Tallagen als auch die zu alpennahen Metropolen zu berücksichtigen.
Wie wird der Begriff „Urbanität“ definiert?
Die Arbeit verwendet einen soziologischen Ansatz der „Urbanität“ nach Radtke (2013), der neben Bevölkerungsdichte und -heterogenität auch baulich-physische und objektbezogene Aspekte umfasst. Personenbezogene Aspekte werden aus Gründen des Umfangs der Arbeit ausgeschlossen.
- Citation du texte
- Melissa Jarc (Auteur), 2019, Urbanität im Alpenraum. Charakterisierung und Strukturwandel ausgewählter Alpenstädte sowie Beispiele von Alpenstädten als Wachstumszentren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1321793