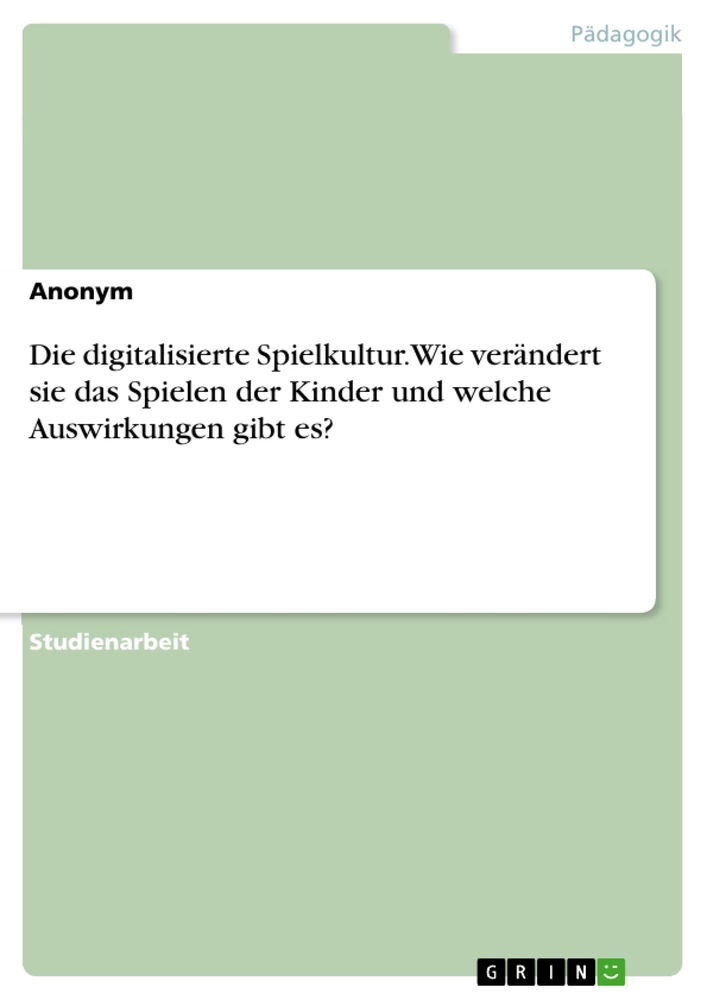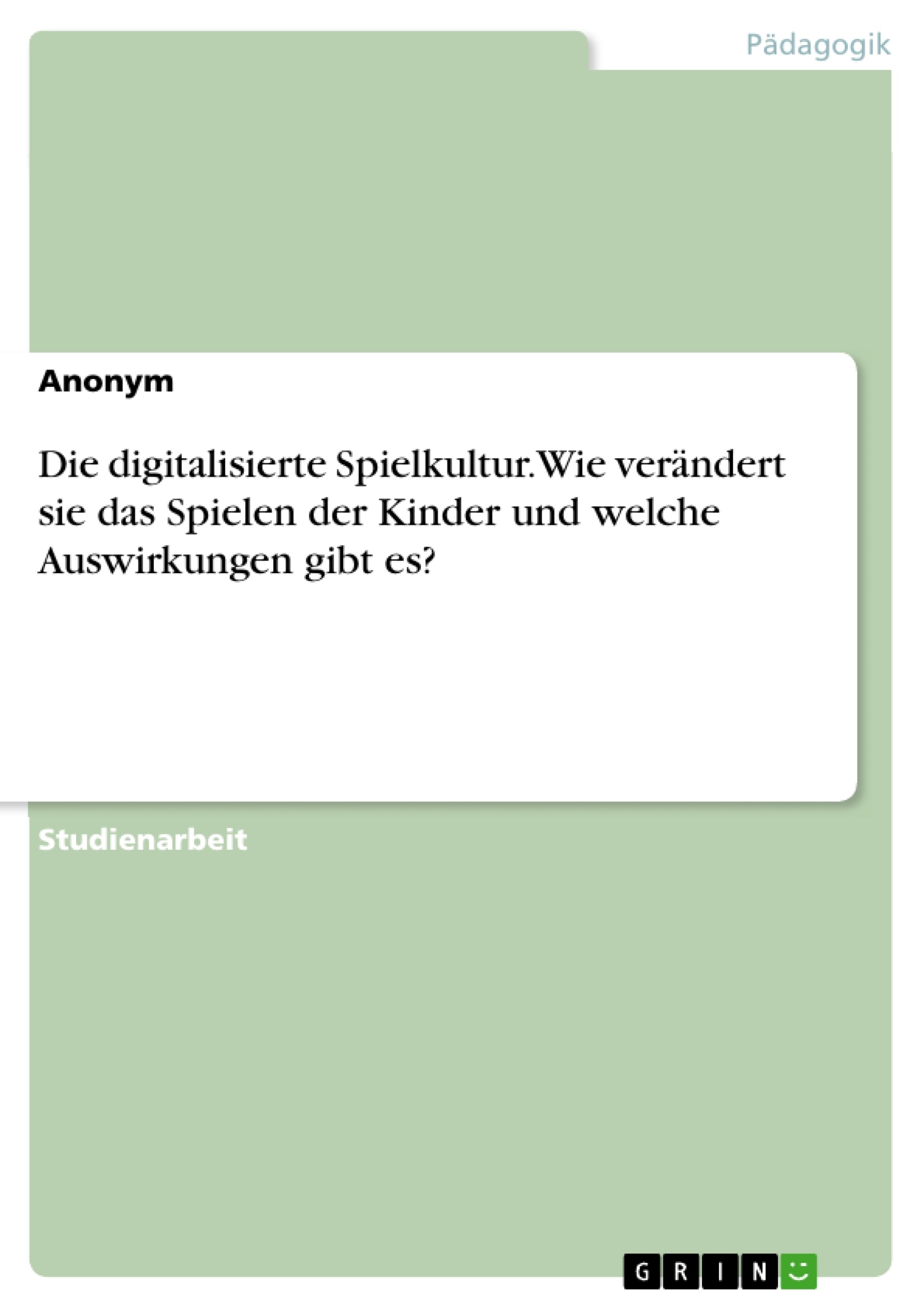Die Fragestellung dieser Arbeit lautet: Inwieweit verändert eine digitalisierte Spielkultur das Spielen heranwachsender Kinder und wie wirkt sich diese aus? Zunächst wird dazu im theoretischen Teil ein kurzer historischer Blick auf das Spielen geworfen, die Bedeutung des Spielens für die Erziehung von Heranwachsenden erläutert und die digitalisierte Spielkultur dargestellt. Im Hauptteil dieser Arbeit wird dann auf der Grundlage des theoretischen Teils die veränderte Erziehung heranwachsender Kinder im Kontext einer digitalisierten Spielkultur dargestellt und die Auswirkungen auf die Kinder und Eltern erläutert. Im Fazit werden die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfassend dargestellt.
In nahezu allen Zeitaltern und Epochen der Menschheit ist gespielt worden und in der Betrachtung kindlicher Spielaktivitäten im Kontext der Bedeutung für die pädagogische und soziokulturelle Umwelt, gilt das Spielen als wichtiger Teil der Erziehung des Menschen, in Abhängigkeit und Ausprägung der zeitlichen Einordnung und verschiedener Kulturen. Nach Siegfried Bernfeld (1924/1994) gilt die Erziehung „als Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache“ und diese Reaktionen unterscheiden sich immer in ihrer jeweiligen zeitgeschichtlichen und kulturellen Einordnung.
Digitale Endgeräte und ihre Nutzung etablieren sich zunehmend in den Familien und bereits auch schon unter Kindern, die das fünfte Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Sei es die zunehmende Nutzung digitaler Medien zum Vorlesen der Eltern, der Bedieneinsatz zur Beschäftigung der Kinder (bei Kindern mit drei Jahren liegt hier der Wert, von denen, die allein vor dem Fernseher beschäftigt werden, bei 46 %), die zunehmende Anzahl an Fernsehgeräten im Kinderzimmer (17 % bei den vierjährigen Kindern), oder der Anteil der Computer- und Videospielnutzung der Kinder (25 % bei vierjährigen, ca. 40 % schon bei den fünfjährigen Kindern). Wenn innerhalb dieser Arbeit von einer digitalisierten Spielkultur gesprochen wird, beziehe ich mich auf die Medien wie Computer, Laptop/Notebook, Spielkonsolen, Handy/Smartphone, iPads, welche von Kindern zum Spielen verwendet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Erziehung durch Spielen
- Digitalisierte Spielkultur
- Auswirkungen einer digitalisierten Spielkultur
- Veränderte Erziehung
- Auswirkungen auf die Kinder
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen einer digitalisierten Spielkultur auf das Spielen heranwachsender Kinder. Sie beleuchtet die veränderte Erziehung im Kontext der digitalen Spielwelt und analysiert die Folgen für Kinder und Eltern.
- Die Bedeutung des Spielens in der Erziehung
- Die Entwicklung der digitalen Spielkultur
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Spielen von Kindern
- Veränderungen in der Erziehungspraxis
- Die Rolle von Eltern und Erziehern in der digitalen Spielwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine kurze historische Einordnung des Spielens als Bestandteil der Erziehung. Es beleuchtet die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung von Kindern und die Herausforderungen, die eine digitalisierte Spielkultur mit sich bringt.
Kapitel 2.1 widmet sich der Bedeutung des Spielens für die Erziehung. Es werden historische Perspektiven sowie die Rolle des Spielens in der Entwicklung von Kindern und ihrer Identität dargestellt.
Kapitel 2.2 betrachtet die Entstehung und Verbreitung der digitalisierten Spielkultur und ihre Auswirkungen auf das Spielen von Kindern.
Schlüsselwörter
Digitale Spielkultur, Erziehung, Kinder, Spiel, Entwicklung, Identität, Socialisation, digitale Medien, Eltern, Erzieher.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert die Digitalisierung das Spielen von Kindern?
Das klassische Spiel wird zunehmend durch digitale Medien (Tablets, Konsolen, Smartphones) ergänzt oder ersetzt, was Auswirkungen auf Bewegung und soziale Interaktion hat.
Welche Rolle spielt das Spielen für die Erziehung?
Spielen gilt als Hauptform der kindlichen Weltaneignung; es fördert die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung sowie die Identitätsbildung.
Ab welchem Alter nutzen Kinder heute digitale Endgeräte?
Studien zeigen, dass bereits ein erheblicher Teil der Drei- bis Fünfjährigen regelmäßig Computer- oder Videospiele nutzt oder Zeit vor dem Fernseher verbringt.
Welche Auswirkungen hat eine digitalisierte Spielkultur auf die Eltern?
Eltern stehen vor neuen Herausforderungen bei der Medienerziehung, müssen Nutzungszeiten kontrollieren und als Vorbilder im Umgang mit digitalen Medien agieren.
Gibt es Risiken bei zu früher Mediennutzung?
Mögliche Risiken sind Bewegungsmangel, eine Reizüberflutung, verringerte Konzentrationsfähigkeit und eine Vernachlässigung des realweltlichen, haptischen Spielens.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Die digitalisierte Spielkultur. Wie verändert sie das Spielen der Kinder und welche Auswirkungen gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322088