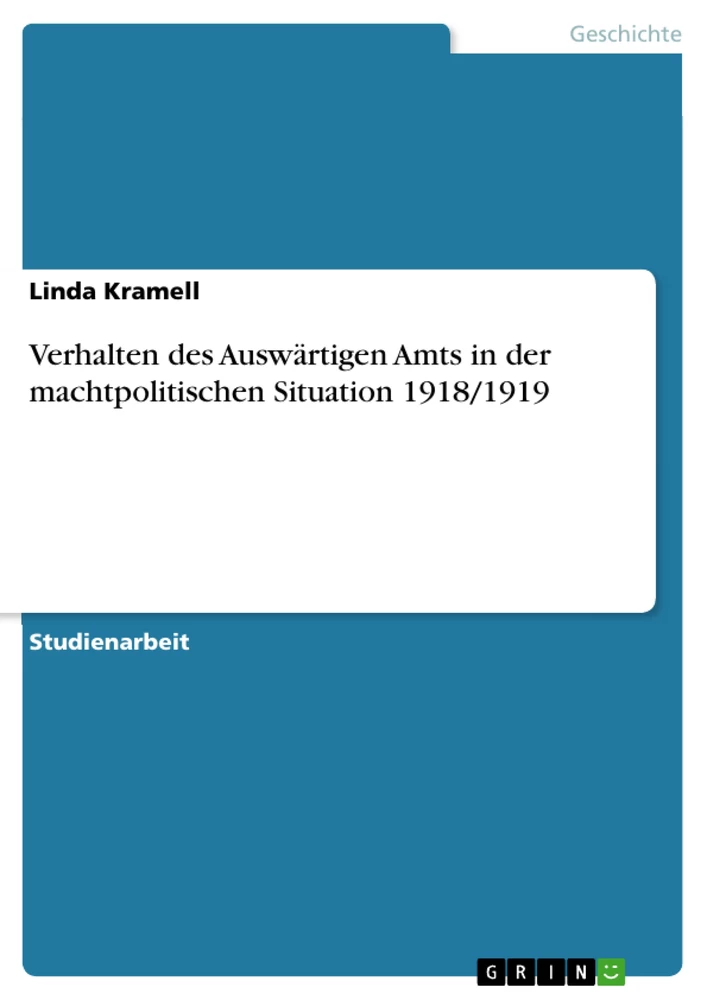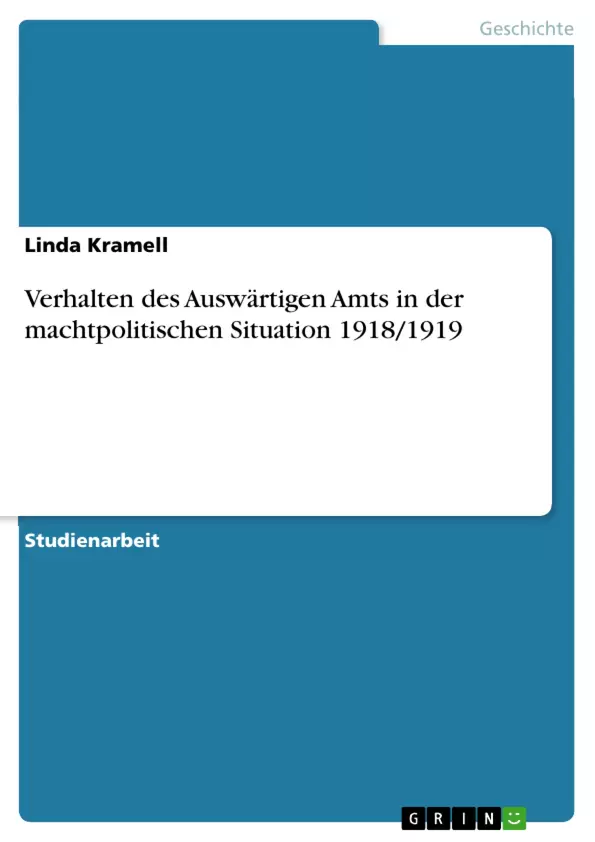Der Bereich der Außenpolitik 1918/1919 soll näher beleuchten werden. Gegenstand dieser Arbeit werden das Auswärtige Amt und die Neuordnung nach außen in der Übergangszeit von Krieg zu Frieden sein. Außerdem stellen sich die Fragen, inwiefern man von einer außenpolitischen Neuordnung sprechen kann, welche neuen außenpolitischen Aufgaben das Auswärtige Amt inne hat und wie es sich im Zusammenhang mit den Prinzipien Wilsons verhalten hat. Als Leitfrage soll also dienen: Verhielt sich das Auswärtige Amt der machtpolitischen Situation 1918/1919 angemessen?
Deutschland 1918. Nachdem der erste Weltkrieg angesichts der drohenden militärischen Niederlage verloren schien, gründete der neue Reichskanzler Max von Baden am 3. Oktober 1918 eine parlamentarische verantwortliche Regierung. Relativ zügig trat der Reichskanzler Max von Baden jedoch zurück und übergab das Reichskanzlertum dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Die neue Regierung bestand demnach aus dem SPD-Politiker Friedrich Ebert und drei weiteren Mitgliedern der Mehrheitssozialdemokratie (MSPD) und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD). Man nannte diese neue Regierung den Rat der Volksbeauftragten.
Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstandsvertrag in Compiegne unterzeichnet, zu einer Zeit, als es noch nicht zu einer offenkundigen militärischen Niederlage gekommen war, denn die Front verlief weiterhin auf französischem und belgischem Gebiet. Man kann also sagen, dass die bedingungslose Kapitulation des deutschen Reiches Voraussetzung für den Waffenstillstandsvertrag war. Im November 1918 war die politische Neuordnung ein zentrales Element.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Ausgangslage und politische Situation der Übergangsperiode
- Die militärische Niederlage zwingt zum Waffenstillstand
- Improvisationscharakter der Demokratie
- Die Frage nach einem dritten Weg und die Legende der bolschewistischen Gefahr
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die außenpolitische Situation Deutschlands in der Übergangszeit von Krieg zu Frieden im Jahr 1918/1919. Sie analysiert die Rolle des Auswärtigen Amtes in der Neuordnung der deutschen Außenpolitik und betrachtet die Frage, ob und wie die Prinzipien Wilsons in dieser Zeit eine Rolle spielten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Auswärtige Amt in den gegebenen Umständen angemessen handelte.
- Die Auswirkungen der militärischen Niederlage auf die deutsche Außenpolitik
- Die Rolle des Auswärtigen Amtes bei der Neuordnung der Außenpolitik
- Die Herausforderungen der Übergangszeit zwischen Krieg und Frieden
- Die Beziehung Deutschlands zu den Siegermächten und insbesondere zu den USA
- Der Einfluss der bolschewistischen Revolution auf die deutsche Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die historische und politische Ausgangssituation Deutschlands im Jahr 1918 dar. Es beleuchtet die militärische Niederlage, den Waffenstillstand von Compiegne und den Wechsel von der Monarchie zur demokratischen Republik. Das Kapitel beleuchtet auch die Herausforderungen der neuen Regierung, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik.
Das zweite Kapitel analysiert die politische Situation und die Herausforderungen der Weimarer Republik im Kontext der damaligen Zeit. Es beleuchtet den Improvisationscharakter der Demokratie, die Frage nach einem dritten Weg und die Legende der bolschewistischen Gefahr.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Deutsche Außenpolitik, Auswärtiges Amt, Übergangszeit, Krieg zu Frieden, Neuordnung, Waffenstillstand, Friedensvertrag von Versailles, Wilson-Prinzipien, Machpolitik, Weimarer Republik, Bolschewistische Revolution, Sozialdemokratie, Reparationszahlungen, Friedensrevolution.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte das Auswärtige Amt in der Übergangszeit 1918/19?
Das Auswärtige Amt war für die außenpolitische Neuordnung verantwortlich und musste den Übergang vom Kriegszustand zum Frieden unter extremem machtpolitischem Druck bewältigen.
Was waren die Wilson-Prinzipien?
Es handelt sich um das 14-Punkte-Programm des US-Präsidenten Woodrow Wilson, das als Grundlage für einen gerechten Friedensschluss dienen sollte.
Was war der Rat der Volksbeauftragten?
Nach dem Rücktritt von Max von Baden bildete sich diese provisorische Regierung aus MSPD- und USPD-Mitgliedern unter der Führung von Friedrich Ebert.
Wie wirkte sich die militärische Niederlage auf die Außenpolitik aus?
Die drohende Niederlage zwang Deutschland zum Waffenstillstand von Compiègne, dessen Bedingungen faktisch einer bedingungslosen Kapitulation glichen.
Was ist mit der „Legende der bolschewistischen Gefahr“ gemeint?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Angst vor einer russischen Revolution (Bolschewismus) die politischen Entscheidungen und die diplomatische Strategie Deutschlands beeinflusste.
War das Handeln des Auswärtigen Amtes der Situation angemessen?
Dies ist die zentrale Leitfrage der Arbeit, die das Verhalten der Behörde gegenüber den Siegermächten und den inneren Umbrüchen kritisch hinterfragt.
- Citar trabajo
- Linda Kramell (Autor), 2021, Verhalten des Auswärtigen Amts in der machtpolitischen Situation 1918/1919, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322828