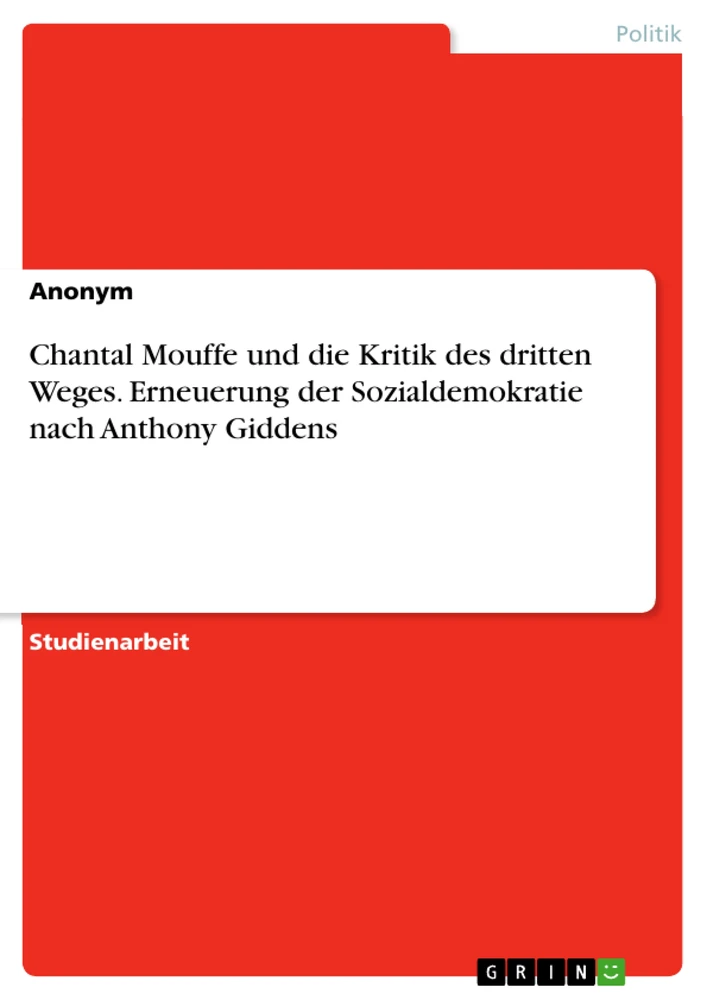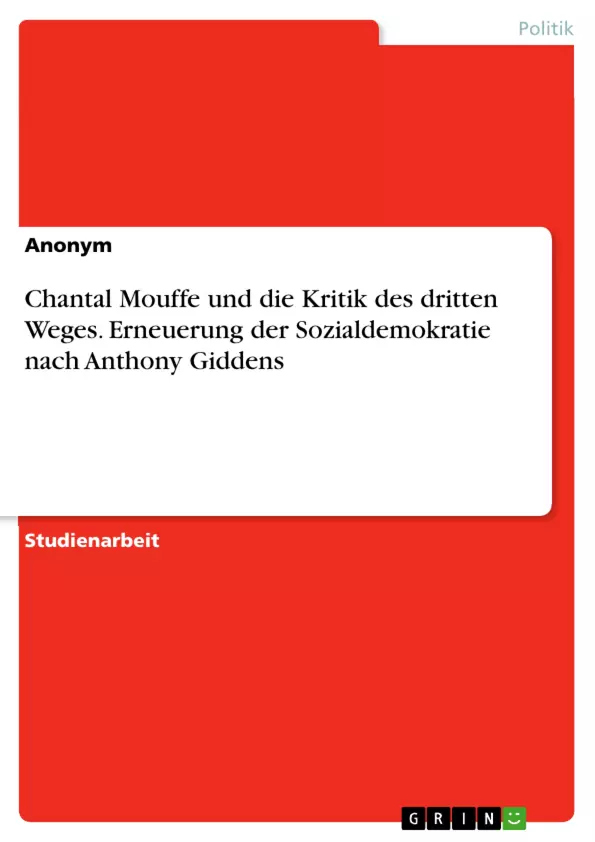Mittlerweile sind rechtspopulistische Parteien in 14 Ländern Europas an einer Regierung beteiligt, während der Stimmenanteil der sozialdemokratischen Parteien in 15 von 17 untersuchten Ländern Europas zwischen den Jahren 2000 und 2017 sank. Angesichts dieser Entwicklung ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit, ob Chantal Mouffes Konzept eines linken Populismus mit den Argumenten und der Kritik am dritten Weg von Labour ein erfolgreicherer Kurs für die Sozialdemokratie sein könnte.
Um dieser Frage nachzugehen, werden zuerst die politischen Pläne des dritten Weges von Anthony Giddens dargestellt. Anschließend werden, nach einer Erläuterung der Theorie der agonistischen Politik von Chantal Mouffe, die Hauptkritikpunkte des dritten Weges aufgezeigt. Abschließend wird das Konzept eines linken Populismus als Antwort auf die Krise der Sozialdemokratie erläutert.
Anfang der 90er Jahre befand sich Europa in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen. Der internationale Handel wurde vereinfacht und führte auf der einen Seite zu gesellschaftlicher Modernisierung, während negative Folgen, wie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Einkommensunterschiede nicht ausblieben. Auch die Parteien reagierten auf die gesellschaftliche Modernisierung. Mithilfe des „dritten Weges“ versuchten sozialdemokratische Parteien sich auf die veränderten Umstände einzustellen. Die Grundidee der Sozialdemokratie war es mit einem Kurs der radikalen Mitte, konservative Wirtschaftspolitik mit progressiver Gesellschaftspolitik zu verknüpfen und somit einer möglichst breiten Masse ein Politikangebot zu machen. Getragen wurde dieses Konzept unter anderem vom Soziologen Anthony Giddens, der ab 1997 als Berater von Tony Blair arbeitete und dessen politischer Plan des „dritten Weges“ eine der Grundlagen für das Programm von Labour Ende der 90er Jahre war. Eine der schärfsten Kritiker*innen war zu dieser Zeit die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Sie kritisierte den Modernisierungskurs der Sozialdemokratie bereits in den 90er Jahren und sah in dem Vorhaben der Sozialdemokratie einen „Konsens in der Mitte“ zu finden eine Gefahr für die Demokratie. Ihr Hauptargument war, dass jede Gesellschaft aus Widersprüchen (Antagonismen) besteht, die jedoch in einem Konsens ohne Exklusion nicht korrekt geäußert werden können. Wenn Antagonismen nicht mehr im politischen Kontext artikuliert werden können, führe dies dazu, dass sie in Extremismus oder Rechtspopulismus aufgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthony Giddens und der dritte Weg
- Chantal Mouffe und die Theorie der agonistischen Politik
- Eine agonistische Politik
- Chantal Mouffe's Kritik an Anthony Giddens
- Für einen linken Populismus?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Kritik von Chantal Mouffe an Anthony Giddens' Konzept des „dritten Weges", einer Erneuerung der Sozialdemokratie. Das Hauptziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, ob Mouffes Konzept eines linken Populismus eine bessere Alternative zur Sozialdemokratie darstellen könnte, angesichts der Herausforderungen, denen sie im 21. Jahrhundert gegenübersteht.
- Die Kritik des „dritten Weges" von Chantal Mouffe
- Die Theorie der agonistischen Politik von Chantal Mouffe
- Die Entwicklung sozialdemokratischer und rechtspopulistischer Parteien
- Das Konzept eines linken Populismus als Antwort auf die Krise der Sozialdemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie auf die tiefgreifenden Veränderungen in Europa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und die Entstehung des „dritten Weges" als Reaktion auf die Globalisierung und gesellschaftliche Modernisierung eingeht. Die Arbeit untersucht die Kritik von Chantal Mouffe an diesem Konzept und die Frage, ob ein linker Populismus eine bessere Alternative für die Sozialdemokratie darstellt.
- Anthony Giddens und der dritte Weg: Dieses Kapitel beleuchtet Giddens' politischen Plan zur Erneuerung der Sozialdemokratie, der insbesondere die Labour-Partei unter Tony Blair beeinflusst hat. Es werden die zentralen Argumente von Giddens hinsichtlich des Neoliberalismus, der Globalisierung und der Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Wohlfahrtstaates erläutert. Das Kapitel stellt auch die fünf Dilemmata der Modernisierung dar, auf die die Sozialdemokratie laut Giddens eine Antwort finden muss, um weiterhin mehrheitsfähig zu sein.
- Chantal Mouffe und die Theorie der agonistischen Politik: Dieses Kapitel erläutert Mouffes Theorie der agonistischen Politik, die auf dem Konzept der Antagonismen basiert. Es werden die Kritikpunkte von Mouffe am „dritten Weg" von Giddens dargelegt, die sich auf die Gefahr eines „Konsenses in der Mitte" und die Unterdrückung von Widersprüchen konzentrieren. Mouffe argumentiert, dass ein solcher Konsens die Artikulation von Antagonismen verhindert und zu Extremismus oder Rechtspopulismus führen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Sozialdemokratie, des „dritten Weges", der agonistischen Politik von Chantal Mouffe, dem linken Populismus, der Globalisierung, dem Neoliberalismus und der Frage nach der Zukunft der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Anthony Giddens unter dem „Dritten Weg“?
Der Dritte Weg ist ein politisches Konzept zur Erneuerung der Sozialdemokratie, das versucht, neoliberale Wirtschaftspolitik mit progressiven sozialen Zielen zu verbinden (radikale Mitte).
Warum kritisiert Chantal Mouffe den Konsens in der Mitte?
Mouffe argumentiert, dass Politik auf Antagonismen (Widersprüchen) basiert. Ein erzwungener Konsens in der Mitte unterdrückt diese Konflikte, was zu Politikverdrossenheit und dem Erstarken von Rechtspopulismus führen kann.
Was ist das Konzept der agonistischen Politik?
Agonistische Politik sieht Konflikte als essenziell für die Demokratie an. Ziel ist es nicht, den Gegner zu vernichten, sondern ihn als legitimen Gegner zu akzeptieren, mit dem man leidenschaftlich streitet.
Wie erklärt Mouffe den Erfolg rechtspopulistischer Parteien?
Wenn die etablierten Parteien der Mitte keine echten Alternativen mehr bieten, suchen sich unzufriedene Bürger Kanäle außerhalb des Systems, was den Rechtspopulismus stärkt.
Was ist Mouffes Vorschlag für einen „linken Populismus“?
Ein linker Populismus soll eine klare Grenze zwischen „dem Volk“ und „dem Establishment“ ziehen und demokratische Forderungen radikalisieren, um eine echte Alternative zum Neoliberalismus zu bieten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Chantal Mouffe und die Kritik des dritten Weges. Erneuerung der Sozialdemokratie nach Anthony Giddens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322969