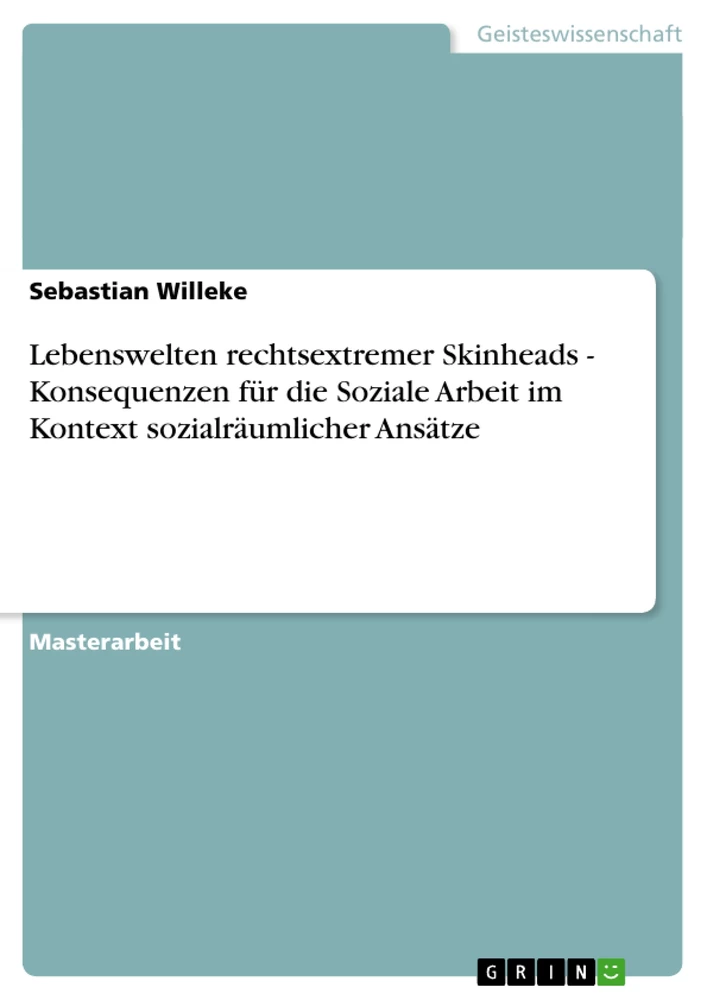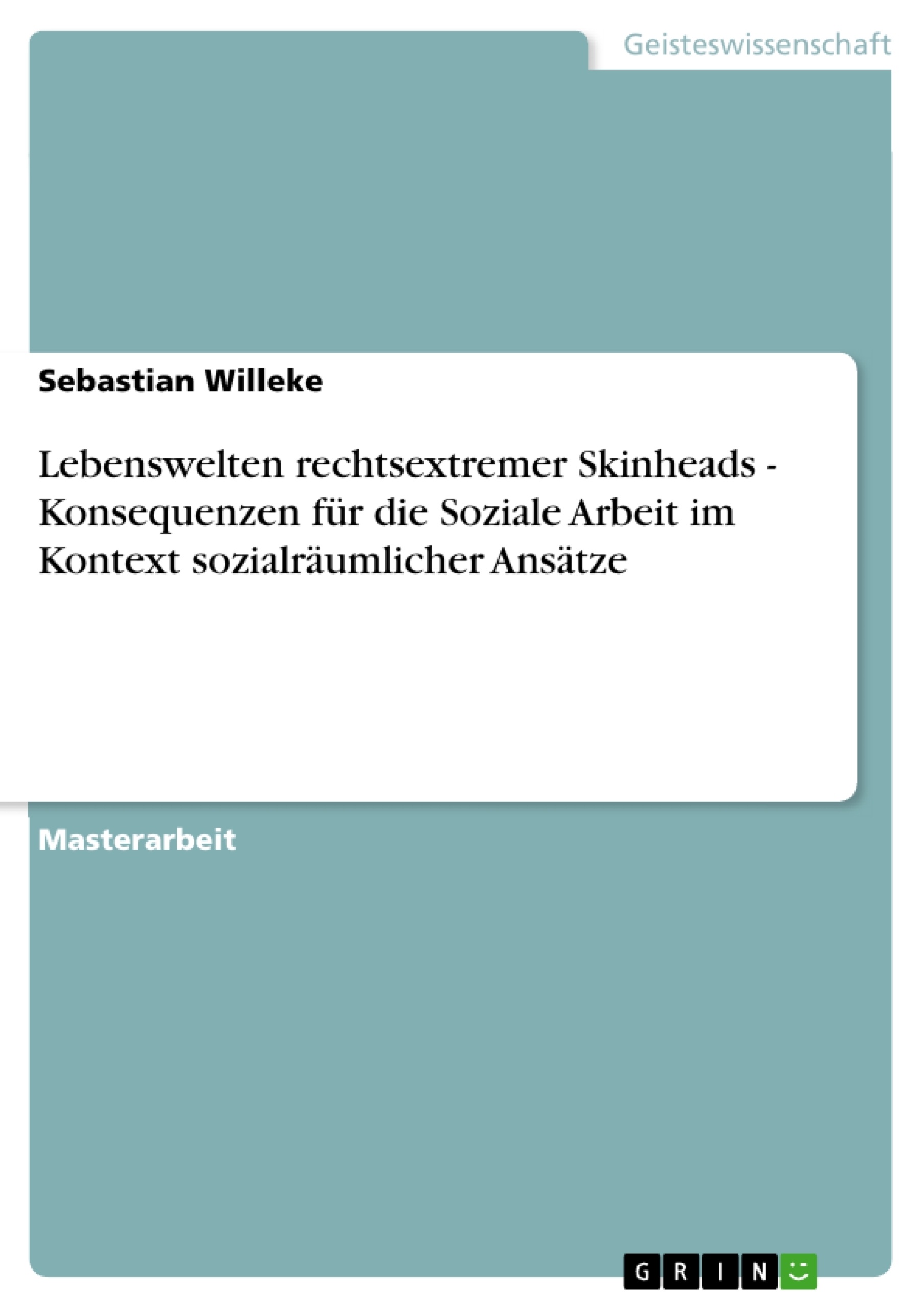„Skin|head [...hεt] der; -s, -s <engl.>: Angehöriger einer Gruppe männlicher Jugendlicher, die äußerlich durch Kurzhaarschnitt bzw. Glatze gekennzeichnet sind u. zu aggressivem Verhalten u. Gewalttätigkeiten neigen [auf der Grundlage rechtsradikalen Gedankenguts]“ (Duden 2006: 962).
Die meisten Menschen würden einer solchen Definition wahrscheinlich zustimmen.
Aber entspricht diese im aktuellen Fremdwörterbuch des Duden enthaltene Umschreibung eines Skinheads tatsächlich der Lebenswirklichkeit?
Bei der Betrachtung dieser Definition bleiben jedoch einige Fragen offen: Sind nun alle Skinheads als rechtsradikal zu bezeichnen? Und was bedeutet „Rechtssein“ überhaupt? Man könnte sich zudem fragen, ob man einen Skinhead auf der Straße wirklich immer schon an seinem äußeren Erscheinungsbild erkennen würde. Spielt Gewalt im Leben von Skinheads tatsächlich so eine große Rolle, dass sie als konstituierendes Merkmal des „Skinhead-Seins“ angesehen werden kann und daher sogar in der Begriffsdefinition erscheint? Zu untersuchen wäre auch, ob dieses gewalttätige Verhalten, wie im Duden behauptet, wirklich einer politisch fundierten Ideologie entspringt.
In jedem Fall spiegelt die oben angeführte Begriffsbestimmung die vorherrschenden Einstellungen in unserer Gesellschaft wider.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob das gezeichnete Bild von den meist jugendlichen Skinheads der Realität entspricht. Um dies beurteilen zu können, ist eine Analyse der Lebenswelt dieser Gruppierung vorzunehmen. Dabei werden die im Duden angesprochenen Bereiche der Kleidung und des Erscheinungsbildes, der Gewalt, des rechtsextremen Gedankenguts bzw. bestimmter ideologischer Orientierungen sowie die Bedeutung von Gruppenphänomenen genauer beleuchtet.
Dass Rechtsextremismus nicht an Aktualität verloren hat, verdeutlichen die aktuellen Ausschreitungen Rechtsextremer bei den Mai-Kundgebungen in verschiedenen deutschen Städten in diesem Jahr. Auch seitens der Regierung wird im neusten Verfassungsschutzbericht, der am 19.5.2009 durch Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble vorgestellt wurde, mit Besorgnis auf die Zunahme rechtsextremistischer Taten in Deutschland im Jahr 2008 hingewiesen.
Vor diesem Hintergrund wird erneut die Frage nach Präventionsmaßnahmen laut.
Wie kann dem Einstieg in die rechte Szene und damit den rechtsextremistischen Straftaten vor-gebeugt werden?
Welche Möglichkeiten bestehen, um den Ausstieg aus der Szene zu fördern?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zur Methode der Lebensweltanalyse
- 3 Konkreter Gegenstand der Lebensweltanalyse: rechtsextreme Skinheads
- 3.1 Rechtsextremismus – eine Begriffsdefinition
- 3.2 Die Skinhead-Bewegung
- 3.2.1 Geschichte der Skinheadbewegung
- 3.2.2 Die unterschiedlichen Gruppierungen in der Skin-Szene
- 3.2.3 Zum Begriff der Subkultur /Szene
- 3.3 Zwischenfazit
- 4 Die Skinhead-Lebenswelt
- 4.1 Erscheinungsbild und Kleidung
- 4.2 Sozialstruktur innerhalb der Skinhead-Szene
- 4.2.1 Personenpotenzial
- 4.2.2 Alters- und Geschlechtsstruktur
- 4.2.3 Familiärer Hintergrund
- 4.2.4 Ausbildung/Bildung
- 4.3 Musik und andere Kommunikationsmedien
- 4.3.1 Rechte Musik – Einstiegsdroge, Propagandamittel, Vernetzungsinstrument?
- 4.3.2 Szenekommunikation: Vom Fanzine bis zum Internet
- 4.4 Gewalt, delinquentes Verhalten und Straftaten
- 4.4.1 Statistische Befunde
- 4.4.2 Qualitative Untersuchungen
- 4.5 Gruppenprozesse - Das „Wir“- Gefühl
- 4.5.1 Die Psychologie der Gruppe
- 4.5.2 Die Bedeutung der Gruppe für rechtsextreme Skinheads
- 4.6 Ideologie und Weltanschauung
- 4.6.1 Szenespezifische Ideologiefragmente in der Eigendarstellung
- 4.6.2 Haben rechte Skins eine fundierte Ideologie?
- 4.6.3 Fazit
- 5 Konsequenzen für die soziale Arbeit im Kontext sozialräumlicher Ansätze
- 5.1 Ein- und Ausstiegsmotive
- 5.2 Die Akzeptierende Jugendarbeit
- 5.2.1 Das Konzept der Akzeptierenden Jugendarbeit nach Krafeld
- 5.2.2 Die Bedeutung des Aufsuchenden Ansatzes
- 5.3 Jugendliche und ihre Sozialräume
- 5.4 Sozialraumanalyse am Beispiel „Distanzierung durch Integration“
- 5.4.1 Grundsätzliche Überlegungen und Konzeptziele
- 5.4.2 Thematische Schwerpunkte und Arbeitsbereiche
- 5.4.3 Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebenswelt rechtsextremer Skinheads und deren Implikationen für die soziale Arbeit. Ziel ist es, ein umfassendes Bild dieser Lebenswelt zu zeichnen und den Nutzen sozialraumorientierter Ansätze in der Jugendarbeit zu beleuchten.
- Analyse der Lebenswelt rechtsextremer Skinheads
- Untersuchung der Sozialstruktur und Ideologie innerhalb der Szene
- Bewertung des Einflusses von Musik und Gewalt
- Evaluierung sozialraumorientierter Ansätze in der Jugendarbeit
- Diskussion von Ein- und Ausstiegsmotiven
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Übereinstimmung des gängigen Bildes von Skinheads mit der Realität. Sie hinterfragt die gängige Definition von Skinheads als rechtsradikal und gewalttätig und leitet die Notwendigkeit einer Lebensweltanalyse ein. Aktuelle Entwicklungen im Rechtsextremismus unterstreichen die Relevanz des Themas und formulieren die Forschungsfragen nach Präventions- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie dem Nutzen sozialraumorientierter Ansätze in der Jugendarbeit.
2 Zur Methode der Lebensweltanalyse: Dieses Kapitel erläutert die Methode der Lebensweltanalyse nach Husserl, Merchel und Schütz/Luckmann. Es betont die individuelle Perspektive und die Bedeutung sozialer und räumlicher Bezugspunkte für die Konstruktion der Lebenswelt. Die Lebenswelt wird als flexibles und räumlich ausdifferenziertes Konstrukt dargestellt, das eng mit dem persönlichen Lebensentwurf des Individuums verknüpft ist.
3 Konkreter Gegenstand der Lebensweltanalyse: rechtsextreme Skinheads: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Rechtsextremismus und beschreibt die Skinhead-Bewegung, ihre Geschichte, verschiedene Gruppierungen und ihren Status als Subkultur. Es legt den Grundstein für die anschließende Analyse der Lebenswelt rechtsextremer Skinheads.
4 Die Skinhead-Lebenswelt: Dieser umfangreiche Kapitelteil analysiert verschiedene Aspekte der Lebenswelt rechtsextremer Skinheads: Erscheinungsbild, Sozialstruktur (inklusive Alter, Geschlecht, familiärer Hintergrund und Bildung), Musik und Medienkonsum, Gewalt und Kriminalität, Gruppenprozesse und die Rolle der Ideologie und Weltanschauung. Es kombiniert quantitative und qualitative Ansätze, um ein vielschichtiges Bild zu zeichnen.
5 Konsequenzen für die soziale Arbeit im Kontext sozialräumlicher Ansätze: Das Kapitel diskutiert die Implikationen der gewonnenen Erkenntnisse für die soziale Arbeit. Es analysiert Ein- und Ausstiegsmotive, beleuchtet das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit nach Krafeld und betont den Wert des aufsuchenden Ansatzes. Besonderes Augenmerk liegt auf der Sozialraumanalyse und deren Bedeutung für die Arbeit mit rechten Jugendlichen. Ein spezifisches Konzept wird am Beispiel „Distanzierung durch Integration“ vorgestellt und bewertet.
Schlüsselwörter
Rechtsextremer Skinhead, Lebensweltanalyse, Sozialraumorientierung, Jugendarbeit, Prävention, Ausstieg, Ideologie, Gewalt, Subkultur, Sozialraumanalyse, Akzeptierende Jugendarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Lebenswelt rechtsextremer Skinheads
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Lebenswelt rechtsextremer Skinheads und deren Implikationen für die soziale Arbeit. Ziel ist es, ein umfassendes Bild dieser Lebenswelt zu zeichnen und den Nutzen sozialraumorientierter Ansätze in der Jugendarbeit zu beleuchten.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet eine Lebensweltanalyse nach Husserl, Merchel und Schütz/Luckmann. Diese Methode betont die individuelle Perspektive und die Bedeutung sozialer und räumlicher Bezugspunkte für die Konstruktion der Lebenswelt. Die Analyse kombiniert quantitative und qualitative Ansätze.
Wie wird Rechtsextremismus definiert?
Die Studie bietet eine eigene Definition von Rechtsextremismus an (im Kapitel 3.1), die jedoch im gegebenen HTML-Auszug nicht explizit dargestellt wird. Die Definition bildet die Grundlage für die Untersuchung der rechtsextremen Skinhead-Bewegung.
Wie wird die Skinhead-Bewegung beschrieben?
Die Studie beschreibt die Skinhead-Bewegung, ihre Geschichte (Kapitel 3.2.1), verschiedene Gruppierungen innerhalb der Szene (Kapitel 3.2.2) und ihren Status als Subkultur (Kapitel 3.2.3). Es wird betont, dass nicht alle Skinheads rechtsextrem sind.
Welche Aspekte der Skinhead-Lebenswelt werden analysiert?
Die Analyse umfasst das Erscheinungsbild und die Kleidung, die Sozialstruktur (Alter, Geschlecht, familiärer Hintergrund, Bildung), Musik und Medienkonsum (inkl. rechter Musik und Szenekommunikation), Gewalt und Kriminalität (mit statistischen und qualitativen Befunden), Gruppenprozesse und das „Wir“-Gefühl, sowie die Ideologie und Weltanschauung der Szene.
Welche Rolle spielen Musik und Medien?
Die Studie untersucht die Rolle rechter Musik als mögliche „Einstiegsdroge“, Propagandamittel und Instrument der Vernetzung. Weiterhin wird die Szenekommunikation, von Fanzines bis zum Internet, analysiert.
Wie wird Gewalt und Kriminalität behandelt?
Die Studie analysiert Gewalt und delinquentes Verhalten mit Hilfe statistischer Befunde und qualitativer Untersuchungen.
Welche Bedeutung hat die Ideologie?
Die Studie untersucht, ob rechte Skinheads eine fundierte Ideologie haben und analysiert szenespezifische Ideologiefragmente in der Eigendarstellung der Skinheads.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die soziale Arbeit?
Die Studie diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für die soziale Arbeit, insbesondere im Kontext sozialräumlicher Ansätze. Sie analysiert Ein- und Ausstiegsmotive, beleuchtet die akzeptierende Jugendarbeit nach Krafeld und betont den Wert des aufsuchenden Ansatzes. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sozialraumanalyse und einem Beispiel-Konzept „Distanzierung durch Integration“.
Was ist die „akzeptierende Jugendarbeit“?
Die Studie beschreibt das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit nach Krafeld und dessen Bedeutung im Kontext der Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen.
Welche Rolle spielt die Sozialraumanalyse?
Die Sozialraumanalyse wird als wichtiges Instrument für die Arbeit mit rechten Jugendlichen dargestellt. Das Beispiel „Distanzierung durch Integration“ illustriert deren Anwendung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Rechtsextremer Skinhead, Lebensweltanalyse, Sozialraumorientierung, Jugendarbeit, Prävention, Ausstieg, Ideologie, Gewalt, Subkultur, Sozialraumanalyse, Akzeptierende Jugendarbeit.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Willeke (Autor:in), 2009, Lebenswelten rechtsextremer Skinheads - Konsequenzen für die Soziale Arbeit im Kontext sozialräumlicher Ansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132341