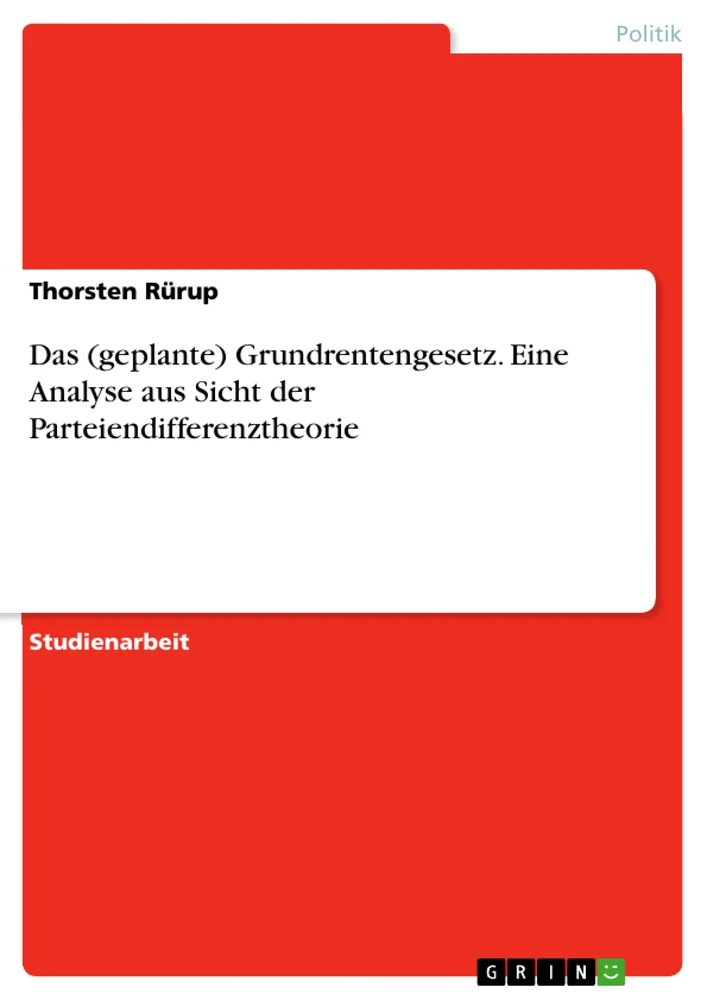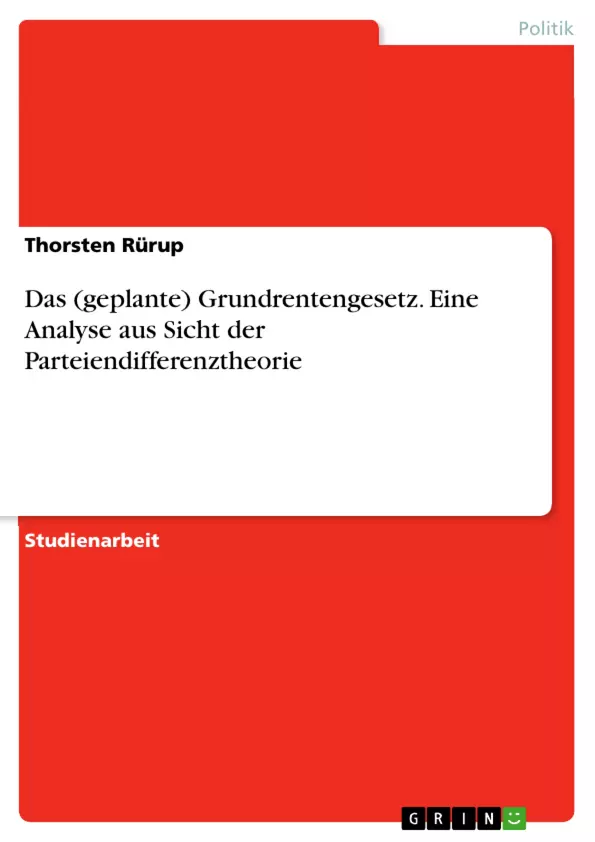Die vorliegende Hausarbeit untersucht die folgende Fragestellung: Warum ist die Bedürftigkeitsprüfung im (geplanten) Grundrentengesetz einer Einkommensprüfung gewichen?
Die Idee einer „Mindestrente“ oder „Grundrente“ steht schon seit einigen Jahren auf der politischen Tagesordnung. Seit die ehemalige Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) im September 2011 ihr Modell einer „Zuschussrente“ vorgestellt hat, wurden in der Folge mit der „Garantierente“ (Bündnis 90/Die Grünen), der „Solidarrente“ (SPD) und der „Solidarischen Mindestrente“ (Die Linke) verschiedene Modelle zur Aufwertung niedriger Renten diskutiert. Ruhland führt das Scheitern der bisherigen Vorschläge u. a. auf nicht auflösbare Systemwidersprüche zurück. Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD ist sich dahingehend einig, dass Personen mit langjähriger Erwerbstätigkeit eine (geplante) Grundrente erhalten sollen, die 10 Prozent über dem Grundsicherungsbedarf liegt. So sieht es der Koalitionsvertrag vor. Es bestanden aber divergierende Positionen zwischen CDU, CSU und SPD darüber, ob die geplante Grundrente an eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung gekoppelt sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Parteiendifferenztheorie
- 3 Das (geplante) Grundrentengesetz
- 4 Analyse und Auswertung der Policy-Positionen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD
- 4.1 Policy-Position der CDU
- 4.2 Policy-Position der CSU
- 4.3 Policy-Position der SPD
- 4.4 Zusammenfassung und Auswertung der Analyse
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, warum die Bedürftigkeitsprüfung im geplanten Grundrentengesetz einer Einkommensprüfung gewichen ist. Die Arbeit nutzt die Parteiendifferenztheorie als theoretischen Ansatz, um die Policy-Positionen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der unterschiedlichen sozialpolitischen Positionen der Parteien und deren Einfluss auf die Gestaltung des Gesetzes.
- Einführung der Parteiendifferenztheorie und ihrer Anwendung auf das Politikfeld der Sozialpolitik
- Analyse des geplanten Grundrentengesetzes und der Debatte um die Bedürftigkeitsprüfung
- Vergleichende Untersuchung der Policy-Positionen von CDU, CSU und SPD bezüglich der Grundrente
- Bewertung des Einflusses parteipolitischer Differenzen auf den Gesetzgebungsprozess
- Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse im Kontext der Parteiendifferenztheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des geplanten Grundrentengesetzes ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Sie skizziert den bisherigen politischen Diskurs um verschiedene Mindestrentenmodelle und benennt die Divergenzen zwischen den Regierungsparteien bezüglich der Bedürftigkeitsprüfung. Die Hausarbeit kündigt die methodische Herangehensweise mit der Parteiendifferenztheorie an und umreißt den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Erklärung der Verschiebung von Bedürftigkeits- zu Einkommensprüfung im politischen Prozess. Das begrenzte Ausmaß der Arbeit und die verwendeten Datenquellen werden ebenfalls definiert.
2 Die Parteiendifferenztheorie: Dieses Kapitel erläutert die Parteiendifferenztheorie, ausgehend von Douglas Hibbs' ursprünglicher Arbeit. Es beschreibt die These von unterschiedlichen Policy-Outputs von Links- und Rechtsparteien, insbesondere im Hinblick auf Arbeitslosigkeit und Inflation. Der Zusammenhang zwischen Parteipraferenzen, Wählerschaft und Policy-Outcomes wird detailliert dargelegt, inklusive der Erläuterung des Zielkonflikts zwischen Arbeitslosigkeitsbekämpfung und Inflationsbekämpfung. Das Kapitel zeigt auf, wie die Theorie auf die Analyse des Grundrentengesetzes angewendet werden kann und legt die Basis für die anschließende Analyse der Policy-Positionen der Regierungsparteien.
3 Das (geplante) Grundrentengesetz: Dieses Kapitel beschreibt das geplante Grundrentengesetz im Detail, unter Berücksichtigung der vorherigen gescheiterten Versuche, eine Mindestrente einzuführen. Es beleuchtet die Einigung der großen Koalition auf eine Grundrente, die über dem Grundsicherungsbedarf liegt, und die unterschiedlichen Positionen der CDU, CSU und SPD hinsichtlich einer Bedürftigkeitsprüfung. Die Nicht-Umsetzung der Bedürftigkeitsprüfung wird als zentrale Forschungsfrage des Papiers hervorgehoben, um die späteren Analysen der Policy Positionen zu kontextualisieren. Hier werden die verschiedenen Modelle und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile kurz gegenübergestellt um ein differenziertes Verständnis für den politischen Entscheidungsprozess zu liefern.
4 Analyse und Auswertung der Policy-Positionen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD: Dieses Kapitel analysiert die Policy-Positionen der CDU, CSU und SPD bezüglich des Grundrentengesetzes, wobei das Sozialstaatsverständnis, die rentenpolitische Parteiprogrammatik und die Motive für die Einführung einer Grundrente berücksichtigt werden. Es untersucht die Argumentationslinien der einzelnen Parteien hinsichtlich der Bedürftigkeitsprüfung und deren Einbindung in die jeweilige parteipolitische Strategie. Der Vergleich der Positionen soll die Gründe für den Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung im finalen Kompromiss beleuchten und die Anwendung der Parteiendifferenztheorie veranschaulichen. Die einzelnen Unterkapitel (4.1-4.3) liefern detaillierte Analysen der jeweiligen Parteipositionen, die in Kapitel 4.4 zusammengefasst und ausgewertet werden. Der Fokus liegt auf der Synthese der unterschiedlichen Positionen und ihrer Bedeutung für den politischen Kompromiss.
Schlüsselwörter
Grundrentengesetz, Parteiendifferenztheorie, Policy-Analyse, Sozialpolitik, Bedürftigkeitsprüfung, Einkommensprüfung, CDU, CSU, SPD, Koalitionsvertrag, Rentenpolitik, Wohlfahrtsstaat, parteipolitische Differenzen, Policy-Output, vergleichende Staatstätigkeitsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Analyse der Policy-Positionen zum Grundrentengesetz
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Gründe für den Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung im geplanten deutschen Grundrentengesetz. Sie untersucht die Policy-Positionen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD und verwendet die Parteiendifferenztheorie als theoretischen Rahmen.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum wurde im geplanten Grundrentengesetz die Bedürftigkeitsprüfung zugunsten einer Einkommensprüfung aufgegeben?
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit nutzt die Parteiendifferenztheorie, insbesondere basierend auf Douglas Hibbs' Arbeit, um die unterschiedlichen Policy-Outputs der Regierungsparteien zu erklären.
Welche Parteien werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die Policy-Positionen der CDU, CSU und SPD bezüglich des Grundrentengesetzes.
Was sind die zentralen Aspekte der Analyse?
Die Analyse betrachtet das Sozialstaatsverständnis der Parteien, ihre rentenpolitische Programmatik, die Motive für die Einführung einer Grundrente und die Argumentationslinien bezüglich der Bedürftigkeitsprüfung.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Parteiendifferenztheorie, ein Kapitel zum Grundrentengesetz, eine Analyse der Policy-Positionen der drei Parteien und ein Resümee. Es werden Kapitelzusammenfassungen bereitgestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Parteiendifferenztheorie, Das (geplante) Grundrentengesetz, Analyse der Policy-Positionen der Regierungsparteien (inkl. Unterkapitel zu CDU, CSU, SPD und Zusammenfassung) und Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundrentengesetz, Parteiendifferenztheorie, Policy-Analyse, Sozialpolitik, Bedürftigkeitsprüfung, Einkommensprüfung, CDU, CSU, SPD, Koalitionsvertrag, Rentenpolitik, Wohlfahrtsstaat, parteipolitische Differenzen, Policy-Output, vergleichende Staatstätigkeitsforschung.
Welche Methode wird zur Analyse verwendet?
Es wird eine vergleichende Policy-Analyse unter Anwendung der Parteiendifferenztheorie durchgeführt, um die Policy-Positionen der drei Parteien zu vergleichen und den Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung zu erklären.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf dem Vergleich der sozialpolitischen Positionen der Regierungsparteien und deren Einfluss auf die Gestaltung des Grundrentengesetzes, insbesondere auf die Entscheidung gegen eine Bedürftigkeitsprüfung.
- Quote paper
- Thorsten Rürup (Author), Das (geplante) Grundrentengesetz. Eine Analyse aus Sicht der Parteiendifferenztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324359