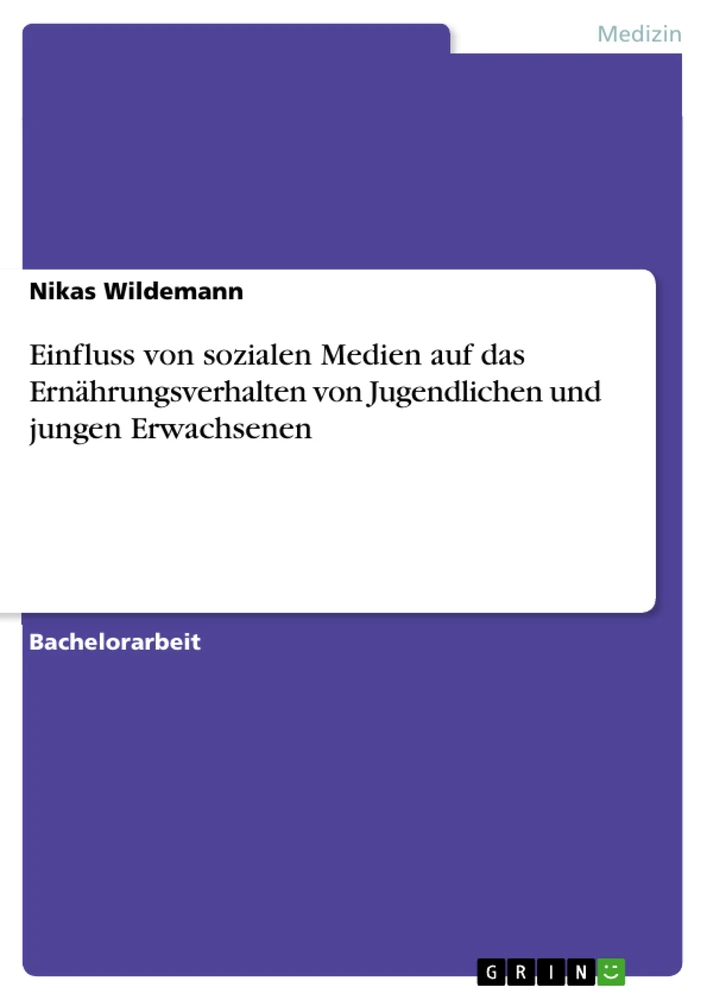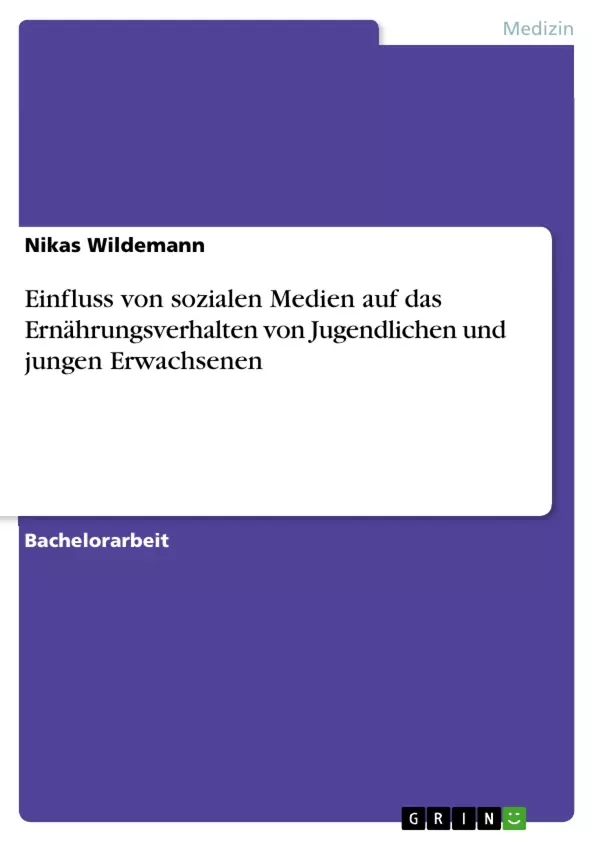Ziel der Arbeit ist es, im Rahmen eines narrativen Reviews eine eigenständige Zusammenfassung des Forschungsstands zum Thema "Einfluss von sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten von Jugendlichen/jungen Erwachsenen" auf der Grundlage der einschlägigen theoretischen und empirischen Forschungsliteratur zu verfassen.
In der aktuellen Lage durch COVID-19 und dem kontinuierlichen Wachstum der Internetnutze wird die Relevanz und Wichtigkeit "online" zu sein immer größer. Die heutige Popularität des Vergleichs mit anderen, wie es in zahlreichen Sozialen Medien getan wird, verursacht negative Assoziationen mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Nun stellt sich die Frage: Wirkt sich dies auf die Ernährung im Allgemeinen aus und kann man mit Folgen gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen rechnen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Problemstellung
2. Zielsetzung
3. Gegenwärtiger Kenntnisstand
3.1 Begriffserklärung
3.1.1 Soziale Medien
3.1.2 Jugendliche/junge Erwachsene
3.1.3 Influencer
3.1.4 Ernährungsverhalten
3.1.5 „Gesunde“ Ernährung
3.2 Soziale Medien
3.2.1 Häufigkeit der Nutzung/Nutzungsdauer von sozialen Medien in Deutschland
3.2.2 Höhe der Werbeeinnahmen der jeweiligen sozialen Medien in Deutschland
3.2.3 Marktanteile der jeweiligen sozialen Medien in Deutschland
3.2.4 Prävalenz der Nutzer von sozialen Medien in Deutschland
3.3 Ernährungsverhalten und Biometrische Daten
3.3.1 Ernährungsverhalten Jugendlicher/junger Erwachsener in Deutschland
3.3.2 Prävalenz verschiedener biometrischer Daten von Jugendlichen/jungen Erwachsenen
3.4 Überleitung zur Problemstellung
4. Methodik
4.1 Forschungsfragen
4.2 Untersuchungsobjekte
4.3 Datenerhebung
4.4 Auswertung der Literaturquellen
5. Ergebnisse
5.1 Studienanalyse
6. Diskussion
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse bezogen auf die Zielsetzung
6.1.1 Beeinflussung durch soziale Medien im Alltag in Bezug auf die Lebensqualität
6.1.2 Beeinflussung durch heutige Trends oder Werbungen
6.1.3 Zusammenhang zwischen soziale Medien und dem Ernährungsverhalten
6.1.4 Zusammenhang zwischen der eigenen Körperwahrnehmung und der Identifizierung durch soziale Medien
6.2 Kritischer Vergleich der Ergebnisse
6.3 Methodenkritik
6.4 Schlussfolgerung
7. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen soziale Medien das Ernährungsverhalten von Jugendlichen?
Soziale Medien fördern den ständigen Vergleich mit anderen, was negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben und die Wahl der Lebensmittel durch Trends oder Influencer beeinflussen kann.
Welche Rolle spielen Influencer bei der Ernährung?
Influencer agieren als Vorbilder für Jugendliche und junge Erwachsene und prägen deren Vorstellung von einer „gesunden“ Ernährung sowie aktuellen Food-Trends.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Social Media und Körperwahrnehmung?
Ja, die Identifizierung über soziale Medien kann die eigene Körperwahrnehmung stark beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf das Essverhalten haben kann.
Welche Altersgruppen sind besonders betroffen?
Die Untersuchung konzentriert sich primär auf Jugendliche und junge Erwachsene, da diese Gruppe eine besonders hohe Nutzungsfrequenz aufweist.
Welchen Einfluss hatte COVID-19 auf dieses Thema?
Durch die Pandemie stieg die Internetnutzung weiter an, was die Relevanz der sozialen Medien als Informationsquelle und Vergleichsplattform für die Ernährung verstärkte.
- Quote paper
- Nikas Wildemann (Author), 2022, Einfluss von sozialen Medien auf das Ernährungsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324771