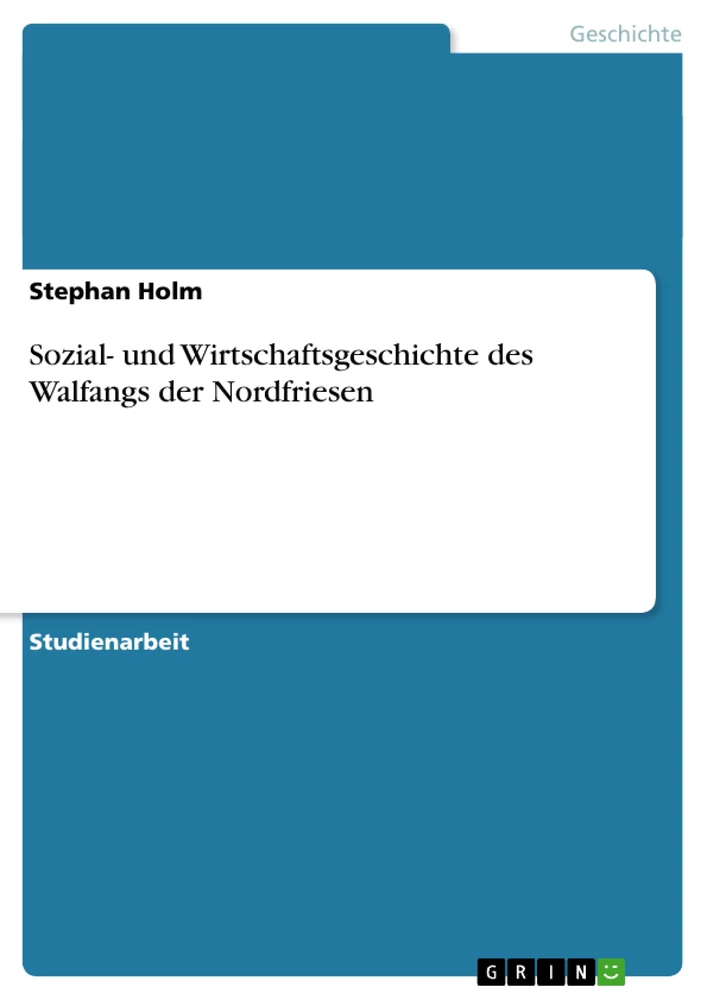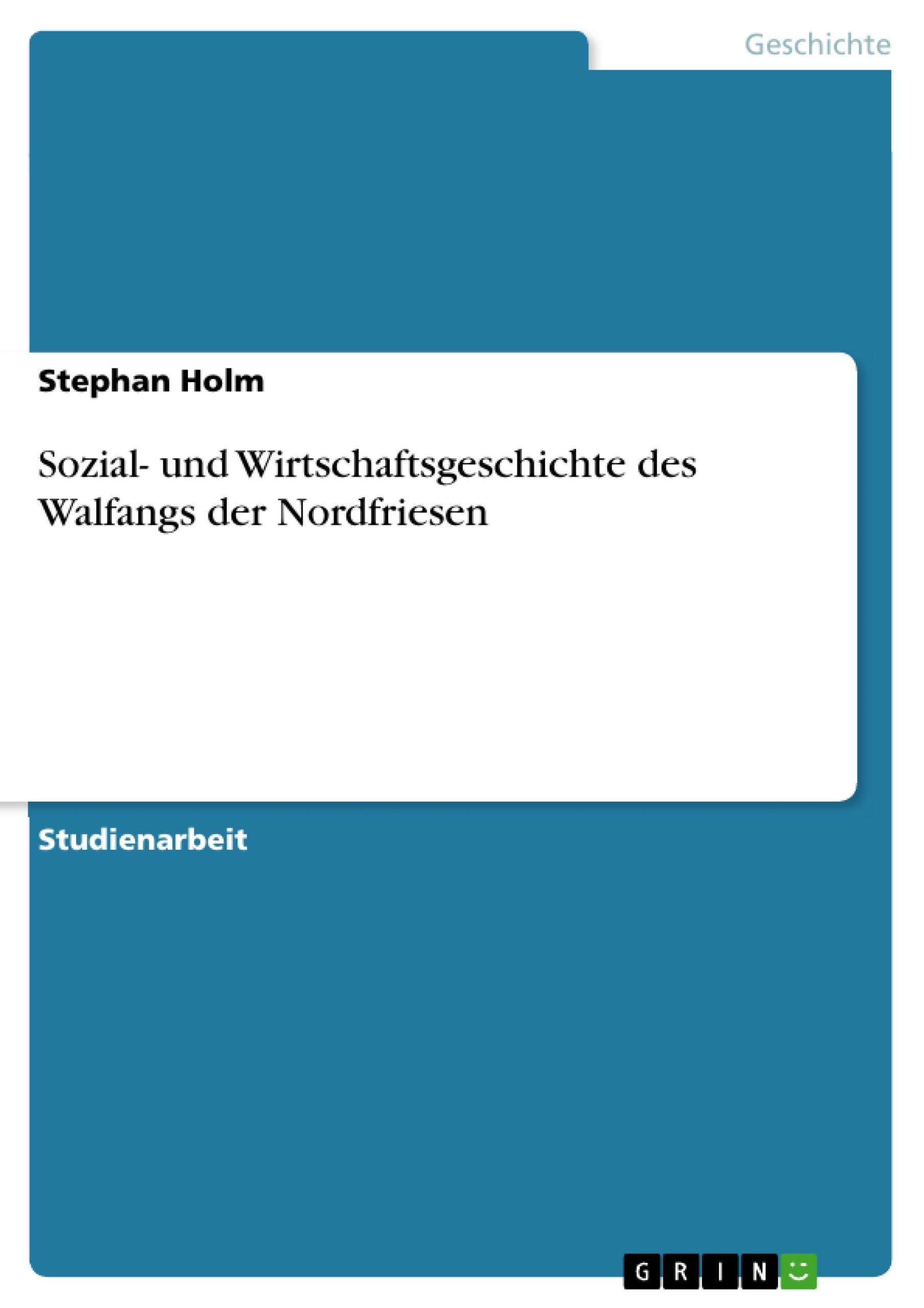Selbst heute gibt es gegen Ende des Februars in vielen Orten der nordfriesischen Küste noch das beliebte Biikebrennen. Dieser Brauch erinnert an längst vergangene Zeiten, in denen zahlreiche Männer Nordfrieslands am 22. Februar jeden Jahres von den Angehörigen mit den weithin leuchtenden Feuern verabschiedet wurden, bevor sie zum Walfang aufbrachen. Weitere Überbleibsel aus der Blütezeit des Walfangs sind Grabsteine auf den Inselfriedhöfen, Kachelbilder in alten Häusern, auf denen Schiffe und Walfangszenen zu erkennen sind, oder Walfangkiefer als Trophäen vor Föhrer Kapitänshäusern. Wenn man sich näher mit dem Walfang der Nordfriesen im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigen will, gestaltet es sich allerdings schwierig, ausreichend Literatur zu finden. Die meisten Werke beschäftigen sich oft nur sehr ausführlich mit der geschichtlichen Entwicklung eines einzigen Ortes. Manchmal ist es auch zweifelhaft, ob alle überlieferten Informationen der Wahrheit entsprechen.
Nur wenigen Menschen ist es heute geläufig, dass die Nordfriesen auf den Inseln und Halligen ihr Leben einst komplett auf den Walfang umgestellt hatten und wie sehr der Walfang ihre regionale Sozial- und Wirtschaftsgeschichte über zwei Jahrhunderte nachhaltig beeinflusst hat.
Dabei stellen sich folgende zentrale Fragen: Welche Folgen hatte das monatelange Fortbleiben der Walfänger auf die Gesellschaft der Daheimgebliebenen? Waren soziale Entwicklungen auf den Inseln zu beobachten, die unmittelbar aus dem Walfang resultieren? Welche Position nahm die Frau ein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie die Nordfriesen zum Walfang kamen
- Der Walfang in Nordeuropa und die Stellung der Nordfriesen
- Gefahren und Risiken des Walfanges
- Gesellschaftliche Auswirkungen auf die Angehörigen
- Das Ende des Walfangs
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Walfangs der Nordfriesen im 17. und 18. Jahrhundert. Sie untersucht die Umstände, die die Nordfriesen zum Walfang führten, ihre Rolle im europäischen Walfangkontext, die Gefahren und Risiken des Berufes, die gesellschaftlichen Auswirkungen auf die Angehörigen und schließlich die Gründe für das Ende des Walfangs in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
- Die ökonomischen und sozialen Bedingungen, die die Nordfriesen zum Walfang zwangen.
- Die Bedeutung und Stellung der Nordfriesen im Walfang Nordeuropas.
- Die Gefahren und Risiken des Walfanges und die daraus resultierenden Regelungen und sozialen Auswirkungen.
- Die Folgen des monatelangen Fortbleibens der Walfänger auf die Gesellschaft der Daheimgebliebenen.
- Die Gründe für das Ende des historischen Walfangs in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die historische Bedeutung des Walfangs für die Nordfriesen dar. Sie verdeutlicht, wie der Walfang die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Region über zwei Jahrhunderte hinweg beeinflusst hat. Die Einleitung hebt die Schwierigkeit hervor, ausreichend Literatur über den Walfang der Nordfriesen zu finden, da sich viele Werke auf die Geschichte einzelner Orte konzentrieren. Sie gibt einen Ausblick auf die wichtigsten Themen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
2. Wie die Nordfriesen zum Walfang kamen
Dieses Kapitel beleuchtet die Umstände, die die Nordfriesen zum Walfang zwangen. Es wird gezeigt, wie die Nordfriesen im 14. Jahrhundert durch den Heringsfang bei Helgoland ihren Lebensunterhalt verdienten. Die Zerstörung der Heringsfanggründe und die „zweite Manndränke“ von 1634 führten jedoch zu großer Armut und zwangen die Nordfriesen, neue Einkommensquellen zu erschließen. Der Walfang bot ihnen eine alternative Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu sichern.
3. Der Walfang in Nordeuropa und die Stellung der Nordfriesen
Dieses Kapitel beschreibt die Rolle der Nordfriesen im europäischen Walfangkontext. Es beleuchtet die Bedeutung des Walfangs in Nordeuropa und zeigt die Position, die sich die Nordfriesen im Laufe der Zeit erarbeitet haben. Das Kapitel geht auch auf die Karrieremöglichkeiten ein, die sich für die Nordfriesen im Walfang öffneten.
4. Gefahren und Risiken des Walfanges
Dieses Kapitel widmet sich den Gefahren und Risiken des Walfangs. Es untersucht die Herausforderungen, denen die Walfänger auf ihren Grönlandfahrten begegneten, und die Regelungen, die getroffen wurden, um diesen entgegenzuwirken. Darüber hinaus werden die sozialen Auswirkungen der Gefahren und Risiken auf das Leben an Bord thematisiert.
5. Gesellschaftliche Auswirkungen auf die Angehörigen
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen des Walfangs auf die Gesellschaft der Daheimgebliebenen. Es untersucht die Folgen des monatelangen Fortbleibens der Walfänger auf die Familien und die soziale Entwicklung der Inseln. Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft während der Abwesenheit der Männer wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Walfang, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Nordfriesland, Inseln, Halligen, Grönland, Heringsfang, Helgoland, Sturmflut, Salzsiederei, Gefahren, Risiken, Gesellschaftliche Auswirkungen, Lebensunterhalt, Karrieren, Berufsstand, soziale Entwicklung, Frauenrolle.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden die Nordfriesen zu Walfängern?
Nach der Zerstörung der Heringsfanggründe und der verheerenden Sturmflut von 1634 herrschte große Armut. Der Walfang bot eine neue, wenn auch gefährliche Einkommensquelle.
Welche Rolle spielten die Frauen während der Fangzeit?
Da die Männer oft monatelang auf See waren, übernahmen die Frauen die alleinige Verantwortung für Haus, Hof und die Erziehung der Kinder, was ihre soziale Stellung stärkte.
Was ist das Biikebrennen?
Ein nordfriesischer Brauch am 21. Februar, der ursprünglich dazu diente, die Walfänger zu verabschieden und ihnen ein weithin leuchtendes Signal für die Heimkehr zu geben.
Was waren die größten Gefahren beim Walfang?
Neben den Naturgewalten und dem Packeis in der Arktis stellten Krankheiten und Unfälle bei der Jagd auf die riesigen Meeressäuger ein extremes Risiko dar.
Wann und warum endete der Walfang in Nordfriesland?
Die Blütezeit endete im 18. Jahrhundert; Mitte des 19. Jahrhunderts kam der historische Walfang aufgrund sinkender Walbestände und wirtschaftlicher Veränderungen zum Erliegen.
- Quote paper
- Stephan Holm (Author), 2003, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Walfangs der Nordfriesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13247