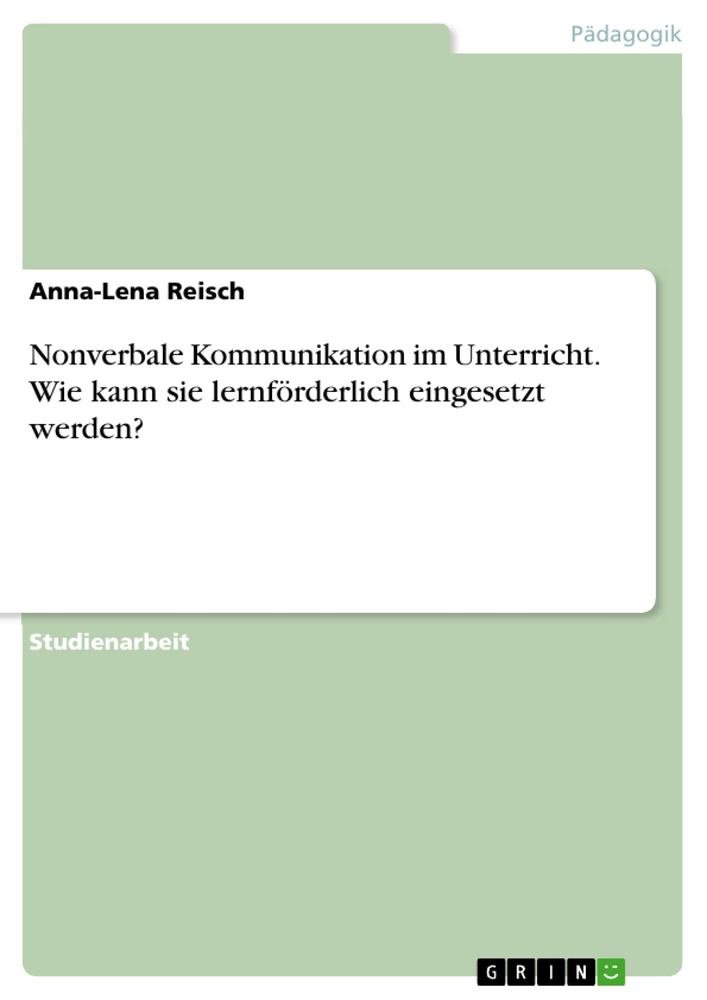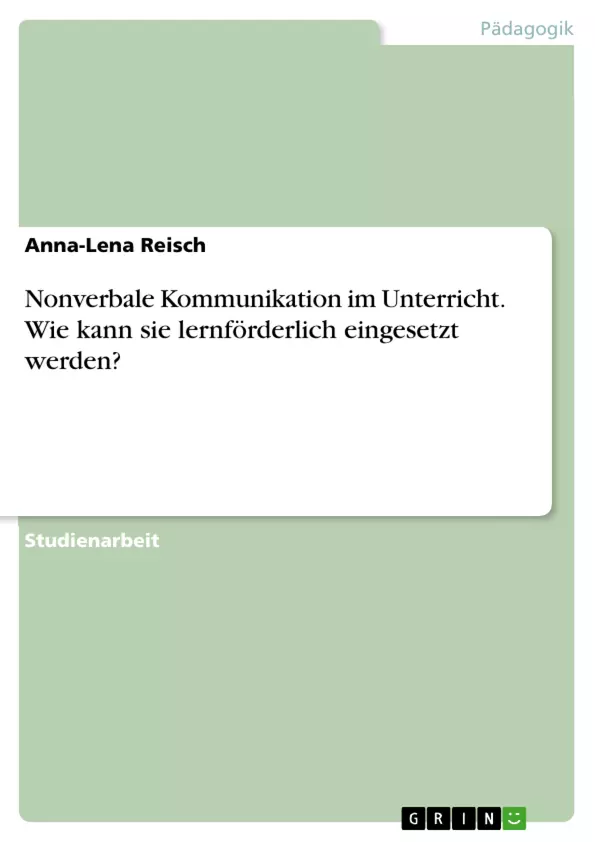Die Einschätzung unseres Gegenübers, die wahrgenommenen Emotionen im Zusammenhang mit dieser Person und das Wissen um mögliche Problematiken innerhalb von nonverbalen Kommunikationsprozessen ist für eine störungsfreie Kommunikation, gerade im schulischen Kontext, von großer Bedeutung. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, inwiefern der Lernprozess der Klasse durch die nonverbale Kommunikation der Lehrkraft beeinflusst wird.
Darüber hinaus ist neben der Darstellung der nonverbalen Kommunikation als Unterstützung im Unterricht auch das Heraus-arbeiten von Ansätzen zur Minimierung beziehungsweise zum Ausschluss von Störungen und Missverständnissen auf pädagogischer Ebene Ziel dieser Arbeit. Da sich die pädagogische Psychologie mit Erziehungs- und Bildungsprozessen befasst, lässt sich die Thematik der vorliegenden Arbeit in dieser Wissenschaft verorten.
Zur differenzierten Bearbeitung der Thematik wird die vorliegende Arbeit wie folgt gegliedert. Zu Beginn wird auf die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen eingegangen, um ein grundlegendes Verständnis zu schaffen. Nachfolgend wird in Kapitel drei die menschliche Kommunikation beleuchtet, indem die verschiedenen Formen und Bereiche der Kommunikation definiert und differenziert sowie Einfluss- und Störfaktoren aufgezeigt werden. Basierend auf den verschiedenen theoretischen Grundlagen werden in Kapitel vier an-schließend konkrete Anregungen für die Unterrichtsgestaltung mittels nonverbaler Kommunikation abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen
- 3.Nonverbale Kommunikation
- 3.1 Definition
- 3.2 Funktionen
- 3.3 Einfluss- und Störfaktoren
- 4 Maßnahmen zur erfolgreichen nonverbalen Unterrichtsgestaltung
- 4.1 Vorbereitung auf den Unterricht
- 4.1.1 Stimmungsbeeinflussung
- 4.1.2 Power-Posing
- 4.2 Ausdrucksformen der Lehrkraft
- 4.2.1 Mimik
- 4.2.2 Gestik
- 4.2.3 Haltung, Raumverhalten und Gangart
- 4.2.4 Innere Haltung und Unterbewusstsein
- 4.3 Applikation von Bedeutungszuschreibungen
- 4.3.1 Darstellung und Ausdruck über den Körper
- 4.3.2 Nutzung von Materialien
- 4.1 Vorbereitung auf den Unterricht
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den lernförderlichen Einsatz nonverbaler Kommunikation im Unterricht. Ziel ist es, aufzuzeigen, inwiefern die nonverbale Kommunikation der Lehrkraft den Lernprozess der Klasse beeinflusst und welche Ansätze zur Minimierung von Störungen und Missverständnissen auf pädagogischer Ebene bestehen.
- Einfluss nonverbaler Kommunikation auf den Lernprozess
- Stärkung der Motivation und des Lehrerfolgs durch nonverbale Kommunikation
- Nutzung nonverbaler Signale zur Wissensvermittlung und Interaktionsregulation
- Ansätze zur Minimierung von Störungen und Missverständnissen in der nonverbalen Kommunikation
- Bedeutung der nonverbalen Kommunikation für die pädagogische Psychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz nonverbaler Kommunikation im Unterricht. Sie beleuchtet die Bedeutung des nonverbalen Kommunikationsverhaltens für die Beziehung zwischen Lehrkraft und Lernenden sowie für die Wissensvermittlung und Interaktionsregulation. Darüber hinaus werden die Ziele der Hausarbeit und die zentrale Fragestellung vorgestellt.
Kapitel 2: Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen, die neben der Lernkultur und -struktur auch ein positives und vertrauensvolles Lernklima sowie Motivation und Selbststeuerung umfassen. Die Bedeutung von Emotionen und Selbstkontrolle sowie die grundlegenden Lernvoraussetzungen wie Arbeitsgedächtnis, Vorwissen und Lernstrategien werden hervorgehoben.
Kapitel 3: Nonverbale Kommunikation
Das Kapitel erläutert die Definition und die verschiedenen Formen der nonverbalen Kommunikation. Es werden Mimik, Gestik, Körpersprache, Blickkontakt, Nähe- und Distanzverhalten sowie deren Funktionen und Einflussfaktoren beleuchtet.
Kapitel 4: Maßnahmen zur erfolgreichen nonverbalen Unterrichtsgestaltung
Dieses Kapitel stellt konkrete Ansätze zur erfolgreichen Gestaltung des Unterrichts mithilfe nonverbaler Kommunikation vor. Es geht auf die Vorbereitung auf den Unterricht, die Ausdrucksformen der Lehrkraft sowie die Applikation von Bedeutungszuschreibungen ein.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst nonverbale Kommunikation den Lernprozess?
Nonverbale Signale der Lehrkraft steuern die Interaktion, vermitteln Emotionen und können das Lernklima sowie die Motivation der Schüler maßgeblich stärken oder stören.
Welche Formen der nonverbalen Kommunikation sind im Unterricht wichtig?
Dazu zählen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Raumverhalten (Nähe/Distanz), Blickkontakt und sogar die Gangart der Lehrkraft.
Was versteht man unter „Power-Posing“ für Lehrkräfte?
Power-Posing ist eine Methode der körperlichen Vorbereitung, um durch bestimmte Haltungen das eigene Selbstbewusstsein und die Ausstrahlung vor Unterrichtsbeginn positiv zu beeinflussen.
Wie können Missverständnisse in der Kommunikation minimiert werden?
Durch das Bewusstsein für Störfaktoren und die bewusste Steuerung der eigenen Körpersprache können pädagogische Missverständnisse und Unterrichtsstörungen reduziert werden.
Welche Rolle spielt die „innere Haltung“ der Lehrperson?
Die innere Haltung überträgt sich oft unterbewusst auf die Körpersprache. Eine authentische und positive innere Einstellung ist daher Basis für eine lernförderliche Ausstrahlung.
Was sind die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen laut dieser Arbeit?
Neben einer klaren Struktur sind ein vertrauensvolles Lernklima, Emotionen, Motivation und die Selbststeuerung der Lernenden entscheidend.
- Citar trabajo
- Anna-Lena Reisch (Autor), 2023, Nonverbale Kommunikation im Unterricht. Wie kann sie lernförderlich eingesetzt werden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1325288