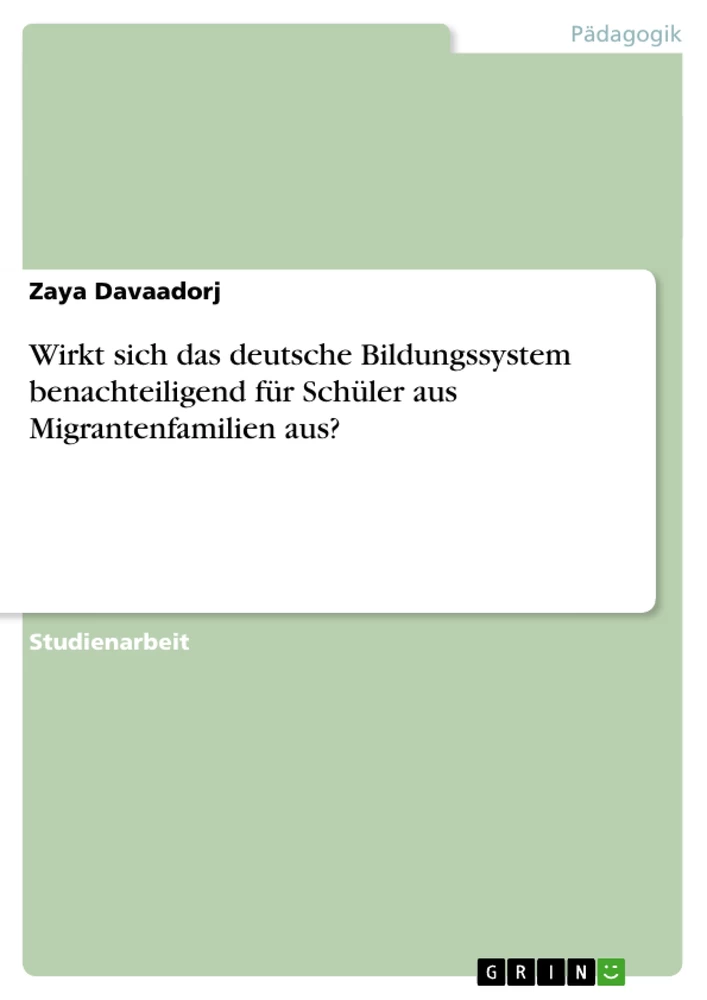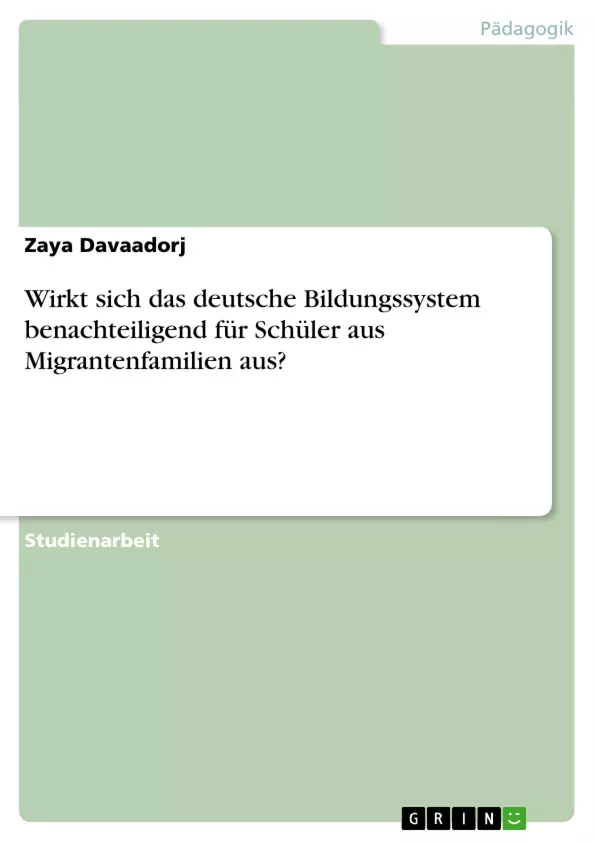Im aktuellen Diskurs um Vermögen, Wohlstand und Reichtum werden drei Bedingungen erwähnt, die zur individueller oder familialer Reichtum und Vermögen führen können. Diese wären: durch den Erwerb individueller Einkommen, Heiratsmobilität und intergenerationale Übertragung von Erbschaften . Während man im Falle der Erbschaften eher von einer Ungleichheitsverstärkenden Wirkung ausgehen kann, sollte man annehmen, dass der Weg zum Vermögen, Wohlstand und Reichtum in einer meritoktratischen Gesellschaft wie Deutschland durch individuelles Einkommen Ungleichverteilungen verringern sollte und viel einfacher zu bewerkstelligen sei. Aber „Kinder schichthöherer Eltern gehen eher auf das Gymnasium, besuchen eher eine Hochschule, erhalten von den Eltern eher finanzielle Unterstützungen [und] erreichen bessere Berufe“. Das würde bedeuten, dass soziale Herkunft die schulischen Leistungen und somit die berufliche Laufbahn negativ beeinflusst. Dadurch wäre dieser Weg zum Vermögen für einige Gruppen erschwert.
Die bei dieser Arbeit zu beantwortende Frage ist, was die Ursachen für die nachweislich schlechten schulischen Leistungszertifikate von Schülern aus Migrationsfamilien sind und wie ihr Bildungserfolg benachteiligt wird. Wo liegen die Gründe für ihren negativen Bildungsverlauf und damit die geringe Chancen am gesellschaftlichen Wohlstand zu partizipieren?
Laut empirischen Daten besuchten im Jahre 2006 44% der Schüler mit Migrationshintergrund eine Hauptschule (im Gegensatz zu 19 % der deutschen Jugendlichen), 17 % verlassen das deutsche Bildungssystem ohne Abschluss (im Gegensatz zu 8,5% der deutschen Jugendlichen) und ca. 40% sogar ohne jegliche berufliche Qualifizierung (11% der Deutschen). Mit schlechten oder fehlenden schulischen Leistungszertifikaten ergeben sich für Schüler mit Migrationshintergrund pessimistische persönliche und berufliche Lebensperspektiven und der Zugang zum Vermögen, Wohlstand und Reichtum scheint verwehrt. Wurden bei den Eltern von Migrantenkindern die Schul- und Universitätsabschlüsse nicht als gleichwertig wie deutsche Abschlüsse anerkannt, so müssen Kinder aus Migrantenfamilien heutzutage Einkommenseinbußen und einen sozialen Abstieg erleben, weil sie selber fast keine Universitätsabschlüsse vorzeigen können oder nur schlechte Schulabschlüsse besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BEGRIFFSERKLÄRUNG (BENACHTEILIGUNG)
- URSACHEN FÜR SCHLECHTE SCHULLEISTUNGEN BEI MIGRANTENKINDERN
- MÖGLICHE ERKLÄRUNGEN IN ABHÄNGIGKEIT ZU DEN INDIVIDUELLEN MERKMALEN
- Kulturelle Defizite
- Schichtspezifische Herkunft
- Humankapitaltheoretische Erklärung
- Migrationssituationsbegründete Strategien und Bildungsentscheidungen
- MÖGLICHE ERKLÄRUNGEN IN ABHÄNGIGKEIT ZU KONTEXTUELLEN MERKMALEN
- Schulformen im deutschen Bildungssystem und ihre Effekte
- Institutionelle Diskriminierung
- Einschulung
- Übergang in die Sekundarstufe
- MÖGLICHE ERKLÄRUNGEN IN ABHÄNGIGKEIT ZU DEN INDIVIDUELLEN MERKMALEN
- FAZIT
- LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das deutsche Bildungssystem benachteiligend für Schüler aus Migrantenfamilien wirkt. Sie analysiert die Ursachen für die nachweislich schlechteren schulischen Leistungen von Schülern mit Migrationshintergrund und untersucht, wie ihr Bildungserfolg beeinträchtigt wird. Die Arbeit beleuchtet sowohl individuelle Faktoren wie kulturelle Herkunft, schichtspezifische Herkunft und Migrationssituation als auch institutionelle Aspekte wie Schulformen, Diskriminierung und den Übergang in die Sekundarstufe.
- Benachteiligung von Schülern aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem
- Ursachen für schlechte Schulleistungen bei Migrantenkindern
- Individuelle und institutionelle Faktoren, die den Bildungserfolg beeinflussen
- Die Rolle von kulturellen Defiziten, schichtspezifischer Herkunft und Migrationssituation
- Institutionelle Diskriminierung und ihre Auswirkungen auf den Bildungsverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Benachteiligung von Schülern aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung von Bildungserfolg für die soziale Mobilität und den Zugang zu Vermögen und Wohlstand. Die Einleitung zeigt auf, dass Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu deutschen Jugendlichen häufiger Hauptschulen besuchen, ohne Abschluss das Bildungssystem verlassen und nur selten eine berufliche Qualifizierung erlangen.
Das Kapitel „Begriffserklärung (Benachteiligung)“ definiert den Begriff der Benachteiligung im Kontext der Bildungsdiskussion. Es zeigt auf, dass Benachteiligung als eine normative Zuschreibung von Defiziten verstanden werden kann, die von außen, in der Regel von Institutionen, vorgenommen wird. Die subjektive Wahrnehmung des Benachteiligten kann jedoch von dieser externen Zuschreibung abweichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Benachteiligung von Schülern aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem, die Ursachen für schlechte Schulleistungen bei Migrantenkindern, kulturelle Defizite, schichtspezifische Herkunft, Migrationssituation, institutionelle Diskriminierung, Schulformen, Einschulung, Übergang in die Sekundarstufe und Bildungserfolg. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen von individuellen und institutionellen Faktoren auf den Bildungsverlauf von Schülern mit Migrationshintergrund und analysiert die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen sozialen und kulturellen Herkunft ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Benachteiligt das deutsche Bildungssystem Kinder aus Migrantenfamilien?
Die Arbeit untersucht empirische Daten, die zeigen, dass Schüler mit Migrationshintergrund häufiger Hauptschulen besuchen und seltener höhere Abschlüsse erreichen als deutsche Jugendliche.
Was sind die Ursachen für schlechtere Schulleistungen bei Migrantenkindern?
Als Gründe werden individuelle Faktoren (kulturelle/schichtspezifische Herkunft) sowie kontextuelle Merkmale (institutionelle Diskriminierung, Übergangssysteme) genannt.
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung?
Dies bezieht sich auf Mechanismen innerhalb des Schulsystems, die Schüler aufgrund ihrer Herkunft benachteiligen, beispielsweise bei der Einschulung oder der Empfehlung für die Sekundarstufe.
Wie hoch ist der Anteil der Migrantenkinder ohne Berufsabschluss?
Laut Daten von 2006 verlassen ca. 40 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund das System ohne berufliche Qualifizierung, verglichen mit 11 % bei Deutschen.
Welchen Einfluss hat die schichtspezifische Herkunft?
Die soziale Herkunft korreliert stark mit dem Bildungserfolg; Kinder aus bildungsnahen Schichten erhalten mehr Unterstützung und erreichen eher Gymnasien.
- Arbeit zitieren
- Zaya Davaadorj (Autor:in), 2009, Wirkt sich das deutsche Bildungssystem benachteiligend für Schüler aus Migrantenfamilien aus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132556