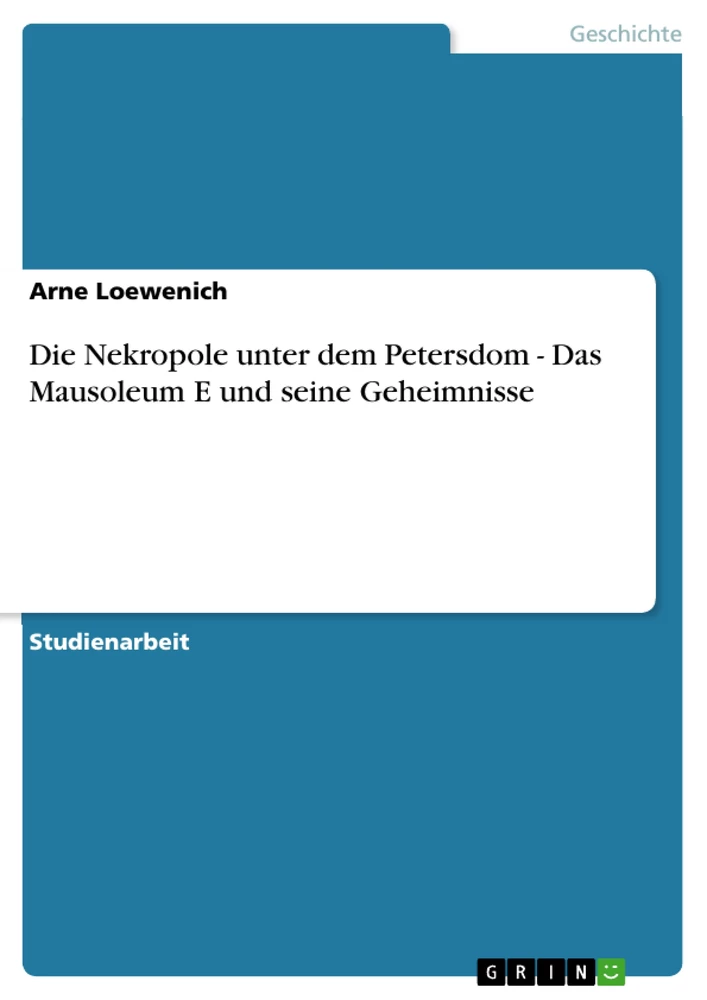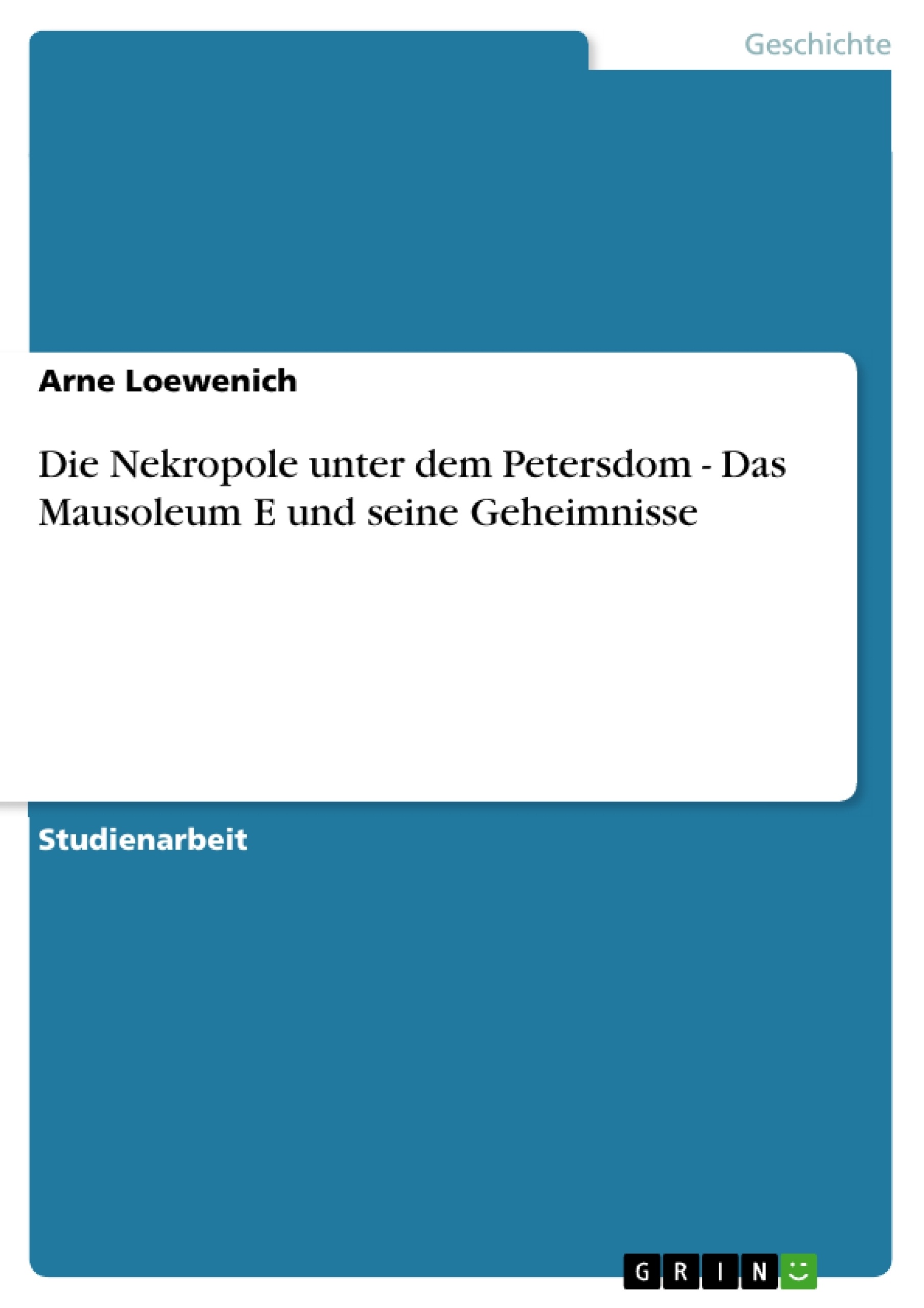„Die Grabungen unter der Peterskirche bieten eine beschränkten Ausschnitt auf einer Nekropole, deren ursprüngliche Ausdehnung sich dadurch nur schemenhaft zu erkennen gibt“ , beschreibt Henner von Heesberg den Befund der Nekropole.
Dass wir uns heute mit der Nekropole beschäftigen können, haben wir v. a. Papst Pius XII. zu verdanken: Er veranlasste im Jahr 1940 das Grab Pius’ X. zu erneuern. Die dazu nötigen Grabungen brachten die ersten Teile der verschollenen Nekropole ans Licht.
Während der Recherche zu dieser Arbeit wurde mir klar, wie schwierig es ist, die genauen Zusammenhänge zwischen einzelnen begrabenen Personen untereinander herauszufinden: Das Grab allein zu betrachten, würde nicht viel bringen; man benötigt Information über die damalige Zeit und deren Riten und Sitten und man muss sich auch mit den umliegenden Gräbern in einem Gräberkomplex wie der Nekropole beschäftigen. „Gleichzeitig sind Grabbauten […] wesentliche Äußerungen des Lebens einer Gesellschaft“ , so dass es unumgänglich ist, diese Informationen herauszusuchen. Weiterhin ist zu beachten, dass auf Grabinschriften die Personen meist immer nur als „ehrenvolle [und; Vf.] liebenswerte Menschen“ dargestellt werden. Es ist also nicht einfach, alle Umstände zu betrachten und am Ende die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Daher werde ich versuchen zuerst einen Blick auf die Nekropole allgemein zu richten, um dann danach das Mausoleum E mit seinen Grabinschriften und deren Übersetzungen näher zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Nekropole unter St. Peter zu Rom
- Das Mausoleum E
- Beschreibung
- Gefundene Inschriften und ihre Übersetzung
- Auswertung der gefundenen Inschriften
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Nekropole unter der Heiligen Peterskirche in Rom, insbesondere mit dem Mausoleum E und seinen Inschriften. Ziel ist es, die Geschichte und Bedeutung dieser Grabstätte im Kontext der römischen Grabkultur zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die gefundenen Inschriften und versucht, die Lebensgeschichten der dort bestatteten Personen zu rekonstruieren.
- Die Entwicklung der römischen Grabkultur im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.
- Die Bedeutung von Mausoleen als Ausdruck von Reichtum und sozialem Status
- Die Rolle von Inschriften als Quelle für die Rekonstruktion von Lebensgeschichten
- Die Herausforderungen der Interpretation von Grabinschriften
- Die Bedeutung der Nekropole unter St. Peter im Kontext der römischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nekropole unter St. Peter ein und erläutert die Bedeutung der Grabkultur im antiken Rom. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Nekropole unter St. Peter. Es beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Grabstätte, die verschiedenen Arten von Grabbauten und die Bedeutung der Nekropole im Kontext der römischen Stadtentwicklung.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Mausoleum E. Es beschreibt die Architektur und Ausstattung des Mausoleums und analysiert die gefundenen Inschriften. Die Inschriften werden übersetzt und interpretiert, um Aufschluss über die Lebensgeschichten der dort bestatteten Personen zu geben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Nekropole unter St. Peter, das Mausoleum E, römische Grabkultur, Inschriften, Epigraphik, Bestattung, Grabstätte, Lebensgeschichte, Rekonstruktion, Geschichte Roms, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Nekropole unter dem Petersdom entdeckt?
Die ersten Teile der Nekropole kamen 1940 ans Licht, als Papst Pius XII. Grabungen veranlasste, um das Grab von Pius X. zu erneuern.
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich speziell auf das Mausoleum E innerhalb der Nekropole, seine Architektur und die dort gefundenen Grabinschriften.
Welche Informationen liefern die Grabinschriften?
Inschriften dienen als Quelle zur Rekonstruktion von Lebensgeschichten und geben Einblick in die Riten, Sitten und den sozialen Status der bestatteten Personen.
Was sind die Herausforderungen bei der Interpretation der Gräber?
Es ist schwierig, genaue Zusammenhänge zwischen den Personen zu finden, da Inschriften Verstorbene meist idealisiert darstellen und man umfangreiches Wissen über zeitgenössische Bräuche benötigt.
Welche Epoche wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der römischen Grabkultur vorwiegend im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.
Werden die Inschriften im Text übersetzt?
Ja, das dritte Kapitel der Arbeit widmet sich der Beschreibung, Übersetzung und Auswertung der im Mausoleum E gefundenen Inschriften.
- Quote paper
- Arne Loewenich (Author), 2007, Die Nekropole unter dem Petersdom - Das Mausoleum E und seine Geheimnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132590