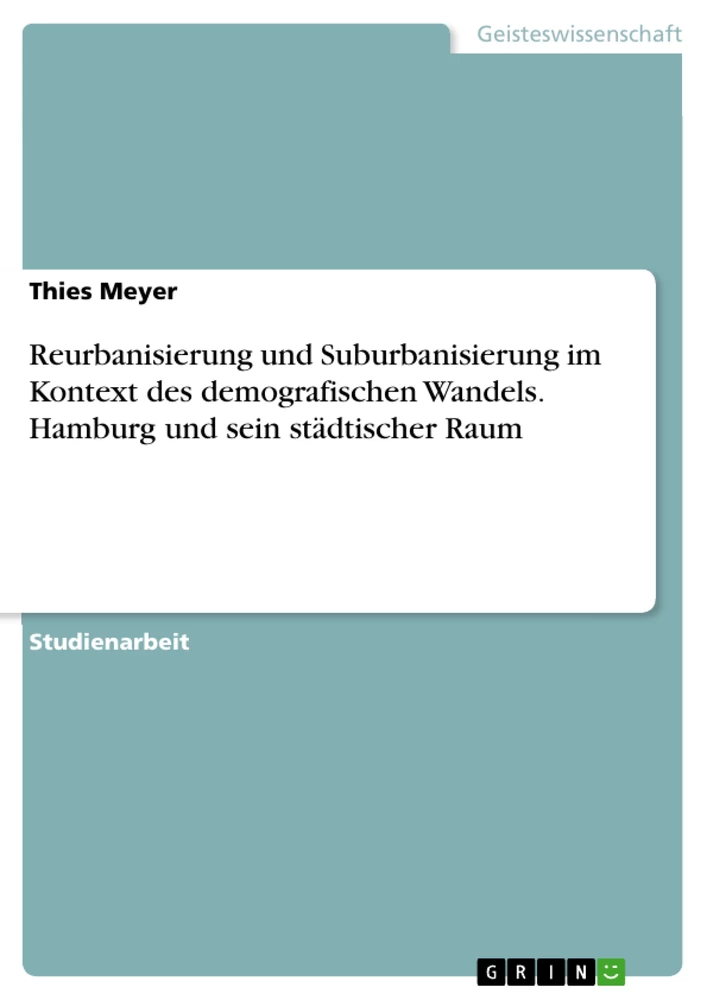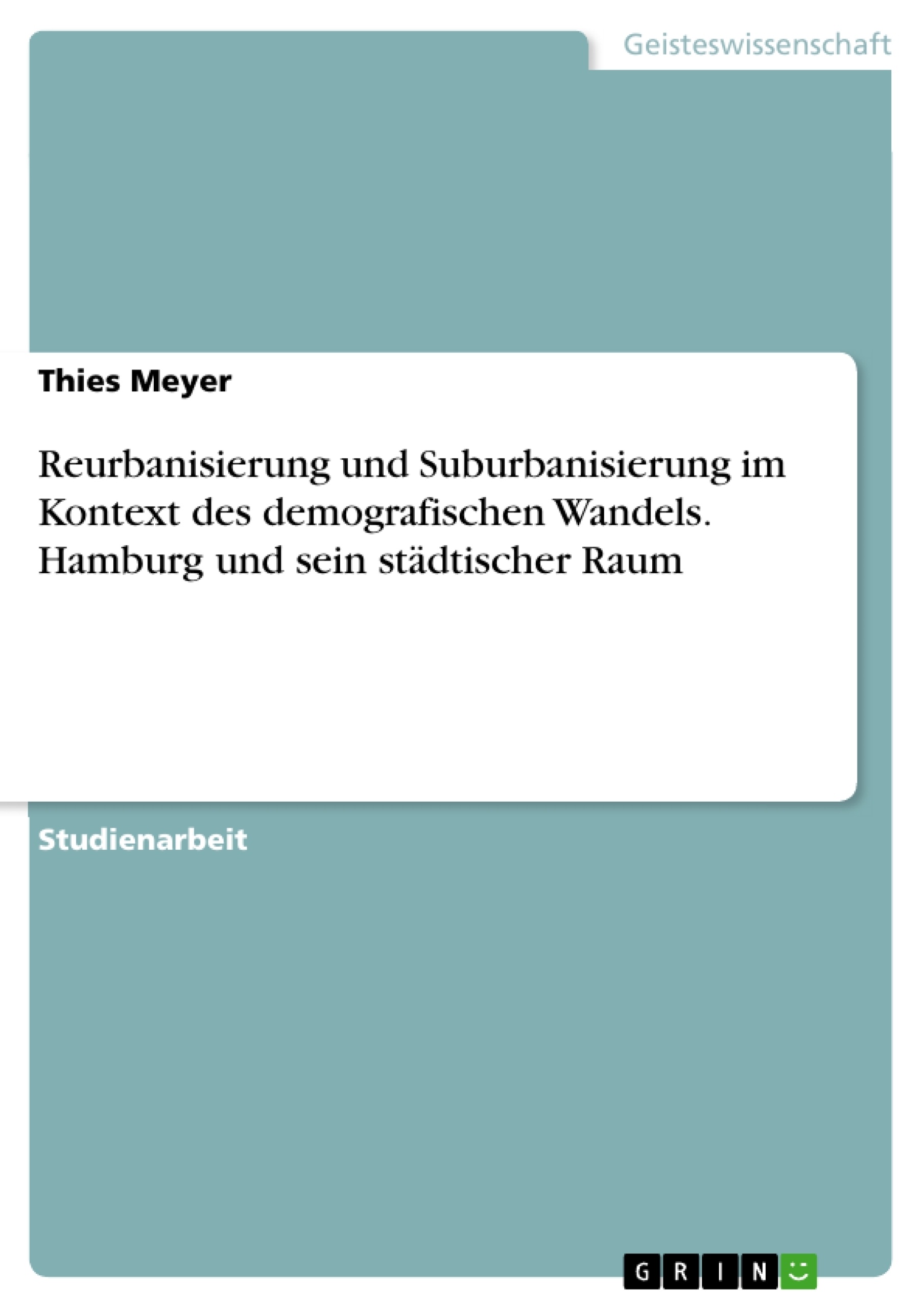Unter dem Thema „Reurbanisierung und Suburbanisierung im Kontext des demografischen Wandels – das Beispiel Hamburg und sein städtischer Raum“ wird zuerst mit Statistiken ermittelt, was die Kennzeichen von Re- und Suburbanisierung sind. Einerseits wird unter dem Aspekt der Reurbanisierung Hamburg als explizites Beispiel in den Blick genommen. Darauf aufbauend ist der zweite Blickwinkel, die Suburbanisierung, notwendig, indem der angrenzende Landkreis Stade musterweise herangezogen wird.
Bei beiden Phänomenen werden sowohl Pull-Faktoren, warum es die Menschen vom Land wegzieht (aus der Stadt wegzieht), als auch Push-Faktoren, warum die Menschen das Leben auf dem Land (und umgekehrt) vorziehen, genannt. Beiläufig werden aber auch demografische Entwicklungen induktiv in den Blick genommen, das heißt nicht nur Hamburg einzeln, sondern auch die gesamte Situation deutscher Großstädte betrachtet. So wird ein allgemeiner Überblick der Großstadt Entwicklung in Deutschland mit Hamburg als ein Spiegelbild dessen generiert.
Im zweiten Teil gilt es, nachstehende Frage zu beantworten: Inwiefern wirken sich Re- und Suburbanisierung im Kontext des demografischen Wandlungsprozesses auf die kommunale Struktur aus? Trotz der parallelen Trends, die positiv zur Wiedererstarkung der Kernstadt beziehungsweise des städtischen Raums beitragen, bringt der demografische Wandel Probleme mit sich, die beide Phänomene vor zukünftig bahnbrechende Herausforderungen stellen dürften. Die demografischen Entwicklungen determinieren auf mittel- und langfristige Sicht beide Formen, indem Einwohnerzuwachs sich gleichzeitig auch mit Bevölkerungsalterung und weiteren gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen überschneidet.
Hamburg zählte 2021 als zweitgrößte deutsche Stadt 1,85 Millionen Einwohner. Seit 2011 kann die norddeutsche Metropole jährlich einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Das Wiedererstarken und die Bedeutungszunahme von Kernstädten wie Hamburg lässt sich dem Trend der „Reurbanisierung“ als räumlicher Entwicklungsprozess zwischen Stadt und Land beschreiben. Doch diese Form der Landflucht durch Zuzüge in die urbanen Zentren lässt sich nicht ohne eine gleichzeitige Stadtflucht denken, welche die entgegengesetzte Entwicklung, die „Suburbanisierung“, meint. Besonders der städtische Raum profitiert durch Familienzuzüge in seiner demografischen und sozioökonomischen Weiterentwicklung von diesem Prozess.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Reurbanisierung und Suburbanisierung als Prozesse des sozioökonomischen Wandels
- 2.1 Kennzeichen der Reurbanisierung
- 2.2 Kennzeichen der Suburbanisierung
- 3. Die Reurbanisierung Hamburgs und Suburbanisierung des städtischen Raums: Veränderung der kommunalen Struktur durch demografischen Wandel
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prozesse der Reurbanisierung und Suburbanisierung in Hamburg und dem umliegenden Raum im Kontext des demografischen Wandels. Ziel ist es, die Kennzeichen beider Prozesse zu identifizieren und ihren Einfluss auf die kommunale Struktur zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Faktoren, die Menschen in die Stadt (Pull-Faktoren) und aus der Stadt (Push-Faktoren) ziehen, als auch die demografischen Entwicklungen, die diese Prozesse beeinflussen.
- Reurbanisierung in Hamburg
- Suburbanisierung im Umland Hamburgs
- Pull- und Push-Faktoren bei Re- und Suburbanisierung
- Einfluss des demografischen Wandels auf die kommunale Struktur
- Hamburg als Beispiel für Großstadtentwicklung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen von Re- und Suburbanisierung auf die kommunale Struktur Hamburgs im Kontext des demografischen Wandels. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den methodischen Ansatz, der auf der Analyse statistischer Daten und Fallbeispielen (Hamburg und Landkreis Stade) beruht. Die Arbeit fokussiert auf die Identifizierung von Pull- und Push-Faktoren sowie die Berücksichtigung demografischer Entwicklungen im größeren Kontext der deutschen Großstadtlandschaft.
2. Reurbanisierung und Suburbanisierung als Prozesse des sozioökonomischen Wandels: Dieses Kapitel definiert Re- und Suburbanisierung und analysiert deren sozioökonomische Kennzeichen. Es werden Statistiken und Daten herangezogen, um die Charakteristika beider Prozesse zu belegen. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen den beiden Entwicklungen, der Erläuterung von Wanderungsbewegungen und der Identifikation von Faktoren, die diese Prozesse antreiben. Hamburg dient als Beispiel für Reurbanisierung, während der Landkreis Stade als Beispiel für Suburbanisierung dient, um die gegenläufigen Trends aufzuzeigen.
2.1 Kennzeichen der Reurbanisierung: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Analyse der Reurbanisierung in Hamburg, indem er sozioökonomische Faktoren untersucht, die junge Menschen in die Stadt ziehen. Hier werden die wirtschaftliche Stärke Hamburgs, das breite Angebot an Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten sowie das große Angebot an Hochschulen und Universitäten als wesentliche Pull-Faktoren hervorgehoben. Der Abschnitt zeigt die Attraktivität Hamburgs als Wohn- und Arbeitsort für Berufseinsteiger auf und ordnet die Stadt anhand der Typologie der Bertelsmann-Stiftung ein, um ihre Position innerhalb der deutschen Großstadtlandschaft zu verdeutlichen.
2.2 Kennzeichen der Suburbanisierung: Dieser Abschnitt analysiert die Suburbanisierung am Beispiel des Landkreises Stade. Es werden Faktoren beleuchtet, die Familien dazu bewegen, aus der Stadt in das Umland zu ziehen, beispielsweise die Verfügbarkeit von Einfamilienhäusern und ein familienfreundlicheres Umfeld. Der Abschnitt setzt die Suburbanisierung in Relation zur Reurbanisierung und veranschaulicht, wie beide Prozesse parallel ablaufen und die demografische Entwicklung beeinflussen. Die Typologie der Bertelsmann-Stiftung wird auch hier verwendet, um die Stellung des Landkreises Stade im Vergleich zu anderen Gemeinden zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Reurbanisierung, Suburbanisierung, demografischer Wandel, Hamburg, Landkreis Stade, Pull-Faktoren, Push-Faktoren, kommunale Struktur, sozioökonomischer Wandel, Großstadtentwicklung, Binnenwanderung, Wirtschaftskraft, Lebensqualität, Bildungswanderung, Familienstrukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reurbanisierung und Suburbanisierung in Hamburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Prozesse der Reurbanisierung und Suburbanisierung in Hamburg und dem umliegenden Raum, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels. Sie analysiert die Kennzeichen beider Prozesse und deren Einfluss auf die kommunale Struktur.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Identifizierung der Kennzeichen von Reurbanisierung und Suburbanisierung in Hamburg und Umgebung. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die Menschen in die Stadt (Pull-Faktoren) und aus der Stadt (Push-Faktoren) ziehen, und untersucht den Einfluss demografischer Entwicklungen auf diese Prozesse und die kommunale Struktur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Reurbanisierung in Hamburg, die Suburbanisierung im Umland (am Beispiel des Landkreises Stade), die relevanten Pull- und Push-Faktoren, den Einfluss des demografischen Wandels auf die kommunale Struktur und Hamburg als Beispiel für Großstadtentwicklung in Deutschland.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Analyse der sozioökonomischen Kennzeichen von Re- und Suburbanisierung, Abschnitte zu den spezifischen Kennzeichen der Reurbanisierung in Hamburg und der Suburbanisierung im Landkreis Stade, sowie ein Fazit und Ausblick. Die Analyse basiert auf statistischen Daten und Fallbeispielen.
Was sind die zentralen Ergebnisse bezüglich der Reurbanisierung in Hamburg?
Die Analyse der Reurbanisierung in Hamburg hebt die wirtschaftliche Stärke, das breite Angebot an Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten sowie das umfangreiche Angebot an Hochschulen und Universitäten als wesentliche Pull-Faktoren hervor. Diese Faktoren machen Hamburg für Berufseinsteiger attraktiv.
Was sind die zentralen Ergebnisse bezüglich der Suburbanisierung im Landkreis Stade?
Die Analyse der Suburbanisierung im Landkreis Stade fokussiert auf Faktoren wie die Verfügbarkeit von Einfamilienhäusern und ein familienfreundlicheres Umfeld als Gründe für den Umzug von Familien aus der Stadt ins Umland. Die Arbeit zeigt, wie Reurbanisierung und Suburbanisierung parallel ablaufen und die demografische Entwicklung beeinflussen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse statistischer Daten und Fallbeispielen (Hamburg und Landkreis Stade). Die Typologie der Bertelsmann-Stiftung wird verwendet, um die Position Hamburgs und des Landkreises Stade im Kontext der deutschen Großstadtlandschaft einzuordnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Reurbanisierung, Suburbanisierung, demografischer Wandel, Hamburg, Landkreis Stade, Pull-Faktoren, Push-Faktoren, kommunale Struktur, sozioökonomischer Wandel, Großstadtentwicklung, Binnenwanderung, Wirtschaftskraft, Lebensqualität, Bildungswanderung, Familienstrukturen.
Wie wird der demografische Wandel berücksichtigt?
Der demografische Wandel wird als wichtiger Einflussfaktor auf die Prozesse der Re- und Suburbanisierung betrachtet und in die Analyse der Wanderungsbewegungen und deren Auswirkungen auf die kommunale Struktur integriert.
Welche Rolle spielt die Bertelsmann-Stiftung Typologie?
Die Typologie der Bertelsmann-Stiftung dient dazu, die Position Hamburgs und des Landkreises Stade im Vergleich zu anderen Gemeinden in Deutschland einzuordnen und die Ergebnisse im größeren Kontext der deutschen Großstadtentwicklung zu verorten.
- Quote paper
- Thies Meyer (Author), 2022, Reurbanisierung und Suburbanisierung im Kontext des demografischen Wandels. Hamburg und sein städtischer Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326516