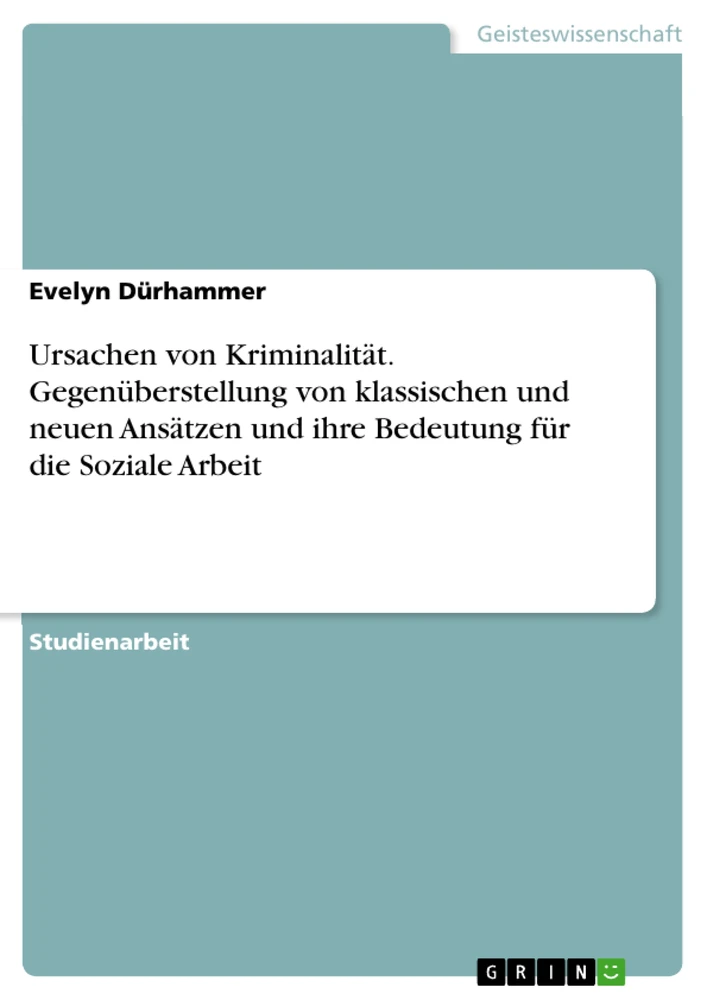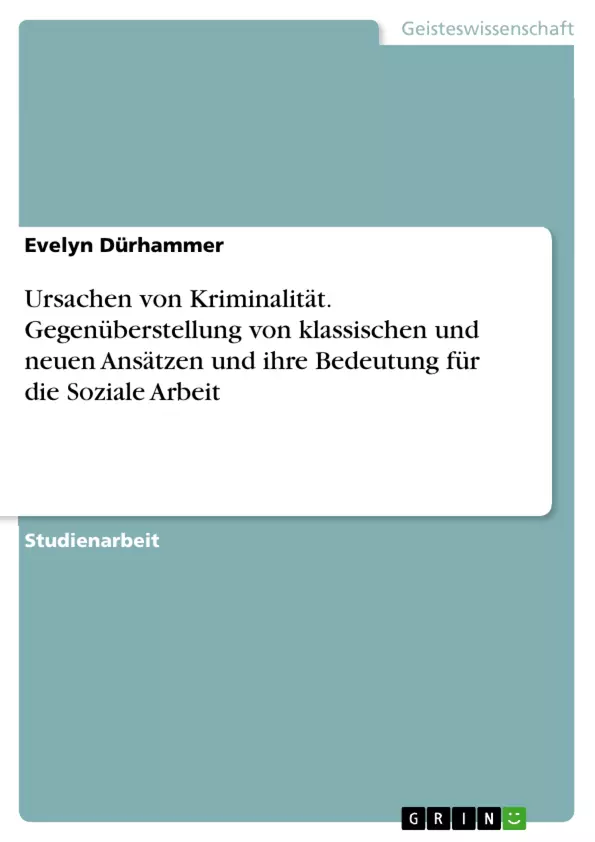Das Ziel der Hausarbeit ist, die Ursachen von Kriminalität durch Theorieklassiker nachzuvollziehen und im Anschluss auf die Rolle der Sozialen Arbeit einzugehen. Der Fokus der Hausarbeit liegt demnach einerseits auf Anomie- und Lerntheorien und anderseits auf der Selbstkontrolltheorie. Die Anomie-, und Lerntheorie gehören zu dem Mainstream der Kriminalsoziologie und haben gemeinsam, dass sie die Ursachen von Kriminalität in den sozialen Positionen und sozialen Beziehungen der Täter sehen, die quasi als Produkt ihrer Umwelt gesehen werden.
Alle Ansätze gehen jedoch von unterschiedlichen Menschenbildern aus. Leitend für die Hausarbeit soll das Zusammenwirken von Ursachen der Kriminalität und Handlungsanweisungen für die Soziale Arbeit sein. Bei den klassischen Theorieansätzen wird Kriminalität in erster Linie als Folge von Benachteiligungen und Sozialisationsdefiziten gesehen. Gemeinsamkeit der klassischen Methoden ist das „übersozialisierte Konzept“ des Menschen. Neue Theorieansätze stellen die individuellen Handlungsentscheidungen in den Mittelpunkt, zu der grundlegenden Annahme der Willensfreiheit bezogen darauf, dass sich Menschen trotz bestimmter äußerer Einflüsse für oder gegen einen Normbruch entscheiden können.
Welche Ursachen von Kriminalität lassen sich nach neuen und klassischen Theorien unterscheiden und was sind jeweils die Konsequenzen für die Soziale Arbeit? Der Mensch lernt schon in einem frühen Alter, welches Verhalten als konform gilt und welches nicht. Wie kommt es daher dazu, dass Menschen gegen das Normverhalten handeln und kriminell werden? Häufig ist Kriminalität auf verschiedene Faktoren zurückzuführen und kann ebenfalls verschiedene Formen annehmen. Um das Thema ideal einzugrenzen, stelle ich kriminologischen Theorien eine soziologische Sichtweise gegenüber, in Form von klassischen und neuen Ansätzen. Sozialarbeiter:Innen begleiten ihre Klient:Innen insbesondere in solchen schwierigen Lebensphasen. Es ist deshalb auch wichtig zu zeigen, inwiefern sich Kriminalität auf Sozialarbeiter:Innen auswirkt und wo möglicherweise die Grenzen der Sozialen Arbeit sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Klassische Ansätze
- 2.1 Anomietheorien
- 2.2 Lerntheorien
- 2.3 Die Rolle der Sozialen Arbeit
- III. Neue Ansätze
- 3.1 Selbstkontrolltheorie
- 3.2 Die Rolle der Sozialen Arbeit
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Ursachen von Kriminalität mithilfe klassischer und neuer Theorien und beleuchtet die daraus resultierende Bedeutung der Sozialen Arbeit. Der Fokus liegt auf Anomie- und Lerntheorien sowie der Selbstkontrolltheorie. Ziel ist es, die Handlungsanweisungen für die Soziale Arbeit im Kontext von Kriminalität aufzuzeigen.
- Klassische Ansätze: Anomie- und Lerntheorien
- Neue Ansätze: Selbstkontrolltheorie
- Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von Kriminalität
- Unterschiedliche Menschenbilder in den Theorien
- Bedeutung von sozialer Ungleichheit und strukturellen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Fragestellung der Hausarbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Kriminalität im Kontext des menschlichen Verhaltens und erläutert die Notwendigkeit, klassische und neue Ansätze zur Analyse von Kriminalität heranzuziehen. Zudem wird die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Kriminalität und ihre Grenzen thematisiert.
II. Klassische Ansätze
2.1 Anomietheorien
Dieser Abschnitt beschreibt die Anomietheorien als Makroebenen-Erklärungen abweichenden Verhaltens. Besonders Robert K. Merton's Erweiterung von Durkheim's Annahmen wird erläutert. Die Theorie verdeutlicht den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Kriminalität sowie die Entstehung eines anomischen Zustands, der durch die Diskrepanz zwischen kulturell vorgegebenen Zielen und den Mitteln zu deren Erreichung entsteht.
2.2 Lerntheorien
Dieser Abschnitt soll später hinzugefügt werden.
2.3 Die Rolle der Sozialen Arbeit
Dieser Abschnitt soll später hinzugefügt werden.
III. Neue Ansätze
3.1 Selbstkontrolltheorie
Dieser Abschnitt soll später hinzugefügt werden.
3.2 Die Rolle der Sozialen Arbeit
Dieser Abschnitt soll später hinzugefügt werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Kriminalität, Anomietheorien, Lerntheorien, Selbstkontrolltheorie, Soziale Arbeit, soziale Ungleichheit, Normbruch, abweichendes Verhalten, Menschenbild, Handlungsanweisungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Kriminalität laut Anomietheorie?
Kriminalität entsteht durch die Diskrepanz zwischen kulturellen Zielen (z.B. Wohlstand) und den fehlenden legalen Mitteln, diese zu erreichen.
Wie erklären Lerntheorien kriminelles Verhalten?
Kriminelles Verhalten wird wie jedes andere Verhalten in sozialen Interaktionen erlernt, insbesondere durch den Kontakt mit kriminellen Bezugspersonen.
Was besagt die Selbstkontrolltheorie?
Kriminalität resultiert aus einer niedrigen individuellen Selbstkontrolle, die oft durch mangelhafte Erziehung in der frühen Kindheit bedingt ist.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei Kriminalität?
Sozialarbeiter begleiten Klienten in schwierigen Lebensphasen und versuchen, durch Prävention und Intervention soziale Benachteiligungen abzumildern.
Gibt es Grenzen für die Soziale Arbeit in der Kriminalitätsprävention?
Ja, strukturelle Faktoren wie tief sitzende soziale Ungleichheit oder individuelle Handlungsentscheidungen können die Wirksamkeit sozialarbeiterischer Maßnahmen begrenzen.
- Quote paper
- Evelyn Dürhammer (Author), 2020, Ursachen von Kriminalität. Gegenüberstellung von klassischen und neuen Ansätzen und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326541